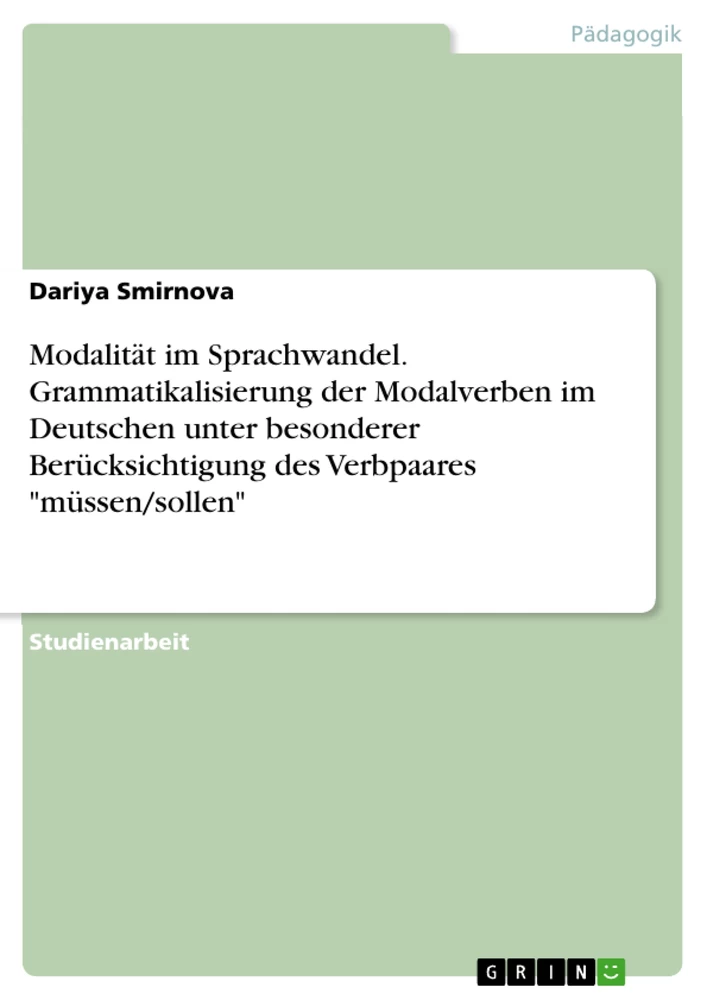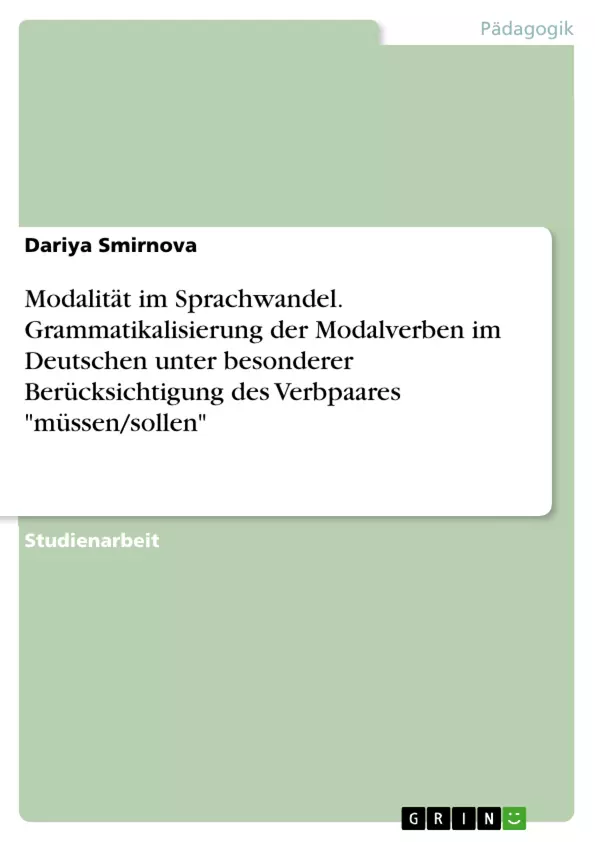Zu Beginn der Arbeit werden die Begriffe „Modalität“, „Grammatikalisierung“ und „Deixis“ aufgrund der besonderen Relation zwischen den Phänomenen erläutert, wobei besonders auf das Verhältnis von Grundmodalität und epistemischer Modalität eingegangen wird. Anschließend erfolgt eine Beschreibung der Gebrauchsweisen der Modalverben und der Oppositionen des Modussystems. Des Weiteren werden die grundlegenden Inhalte des Grammatikalisierungsprozesses, und zwar seine Parameter und Phasen beschrieben. Danach wird die Theorie zur Grammatikalisierung in Hinblick auf die Modalverben müssen und sollen konkretisiert. Abschließend folgt eine Zusammenfassung der vorliegenden Arbeit mit einem knappen Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Modalität“, „Grammatikalisierung“ und Deixis - Begriffsbestimmung
- 3. Die Modalverben als Klasse der modalen Ausdrucksmittel
- 3.1 Die Gebrauchsweisen
- 3.2 Oppositionen des erweiterten Modussystems im Deutschen
- 4. Entwicklung des deiktischen Gebrauchs von Modalverben
- 4.1 Parameter der Grammatikalisierung
- 4.2 Ablaufphasen der Grammatikalisierung
- 4.3 Grammatikalisierung von müssen und sollen
- 4.3.1 müssen
- 4.3.2 sollen
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Grammatikalisierungsprozess der Modalverben im Deutschen, mit besonderem Fokus auf die Verben „müssen“ und „sollen“. Ziel ist es, die aktuellen Gebrauchsweisen der Modalverben zu beleuchten und Einblicke in den Grammatikalisierungsprozess zu gewinnen. Die Arbeit analysiert die Entwicklung deiktischer Verwendung von Modalverben und untersucht die Zusammenhänge zwischen Modalität, Grammatikalisierung und Deixis.
- Grammatikalisierungsprozess der Modalverben
- Gebrauchsweisen der Modalverben „müssen“ und „sollen“
- Begriffsdefinitionen von Modalität, Grammatikalisierung und Deixis
- Unterscheidung zwischen Grundmodalität und epistemischer Modalität
- Parameter und Phasen der Grammatikalisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Sprachwandels im Deutschen ein, mit besonderem Fokus auf die Grammatikalisierung. Sie hebt die Bedeutung der Modalverben und ihrer Modalitätsausdrücke hervor und benennt das Ziel der Arbeit: die Klärung aktueller Gebrauchsweisen und die Erforschung des Grammatikalisierungsprozesses von „müssen“ und „sollen“. Der einleitende Abschnitt stellt die Forschungsfrage nach der Entwicklung und den Besonderheiten des Modalverbssystems im Deutschen dar und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. „Modalität“, „Grammatikalisierung“ und „Deixis“ - Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Definition von „Modalität“, wobei die Unterscheidung zwischen Grundmodalität (deontisch) und epistemischer Modalität im Mittelpunkt steht. Es werden verschiedene Definitionsansätze vorgestellt und anhand von Beispielen die Unterschiede zwischen subjekt- und sprecherorientierter Modalität verdeutlicht. Der Unterschied in der Zeitbewertung und dem Skopus (VP vs. CP) wird ebenfalls herausgearbeitet. Abschließend wird der Begriff der Grammatikalisierung im Kontext des Sprachwandels definiert und eingeordnet.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Grammatikalisierung der Modalverben im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Grammatikalisierungsprozess der deutschen Modalverben, insbesondere von „müssen“ und „sollen“. Sie beleuchtet die aktuellen Gebrauchsweisen dieser Verben und analysiert die Entwicklung ihrer deiktischen Verwendung. Die Arbeit untersucht auch die Zusammenhänge zwischen Modalität, Grammatikalisierung und Deixis.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den Grammatikalisierungsprozess der Modalverben, die Gebrauchsweisen von „müssen“ und „sollen“, die begriffliche Abgrenzung von Modalität, Grammatikalisierung und Deixis, die Unterscheidung zwischen Grundmodalität und epistemischer Modalität sowie die Parameter und Phasen der Grammatikalisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Begriffsbestimmung von Modalität, Grammatikalisierung und Deixis, die Modalverben als Klasse modalen Ausdrucksmittels, Entwicklung des deiktischen Gebrauchs von Modalverben und eine Zusammenfassung. Kapitel 3 und 4 sind weiter unterteilt in Unterkapitel, die sich mit den Gebrauchsweisen der Modalverben, Oppositionen des Modussystems, Parametern und Phasen der Grammatikalisierung sowie der detaillierten Analyse von „müssen“ und „sollen“ befassen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die aktuellen Gebrauchsweisen der Modalverben „müssen“ und „sollen“ zu beleuchten und Einblicke in ihren Grammatikalisierungsprozess zu gewinnen. Sie zielt darauf ab, die Entwicklung der deiktischen Verwendung dieser Verben zu analysieren und die Zusammenhänge zwischen Modalität, Grammatikalisierung und Deixis zu untersuchen.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Arbeit definiert die zentralen Begriffe Modalität (mit Unterscheidung zwischen Grund- und epistemischer Modalität), Grammatikalisierung und Deixis. Es werden verschiedene Definitionsansätze vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert.
Welche Aspekte der Modalverben werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des deiktischen Gebrauchs von Modalverben, die Parameter und Phasen der Grammatikalisierung und die Unterschiede in der Zeitbewertung und dem Skopus (VP vs. CP) bei der Modalität.
Welche Modalverben stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf die Modalverben „müssen“ und „sollen“, analysiert aber auch das Modalverbensystem im Deutschen im Allgemeinen.
Wie wird die Grammatikalisierung in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht den Grammatikalisierungsprozess der Modalverben im Detail. Sie analysiert die Parameter und Phasen dieses Prozesses und beschreibt die Entwicklung der Modalverben von ihrer ursprünglichen Bedeutung hin zu ihren heutigen Funktionen.
- Quote paper
- Dariya Smirnova (Author), 2016, Modalität im Sprachwandel. Grammatikalisierung der Modalverben im Deutschen unter besonderer Berücksichtigung des Verbpaares "müssen/sollen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384262