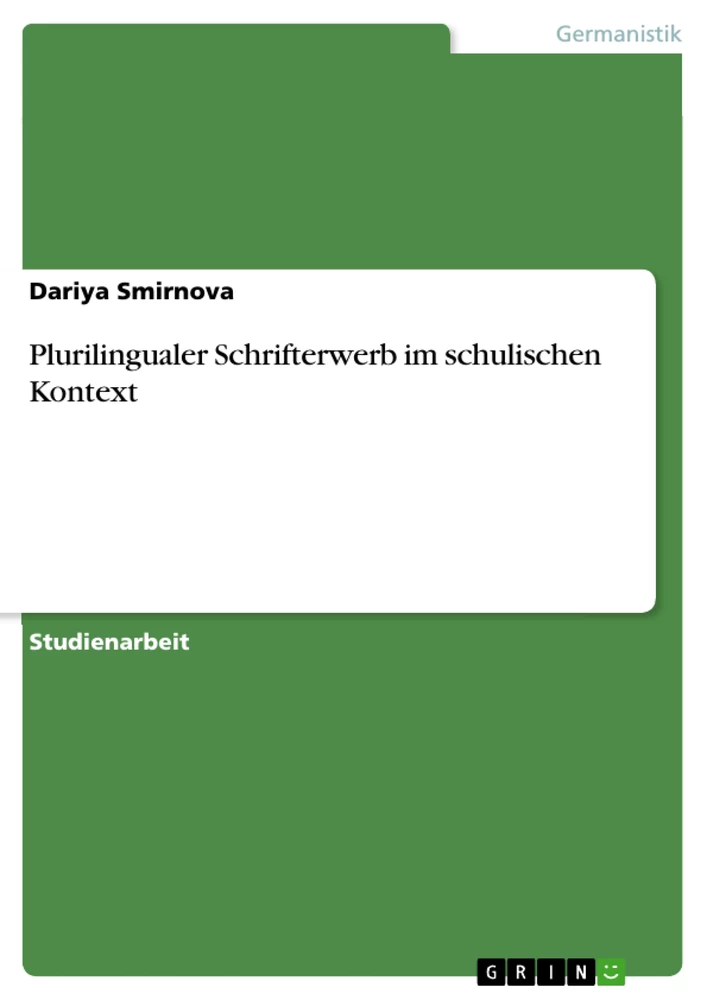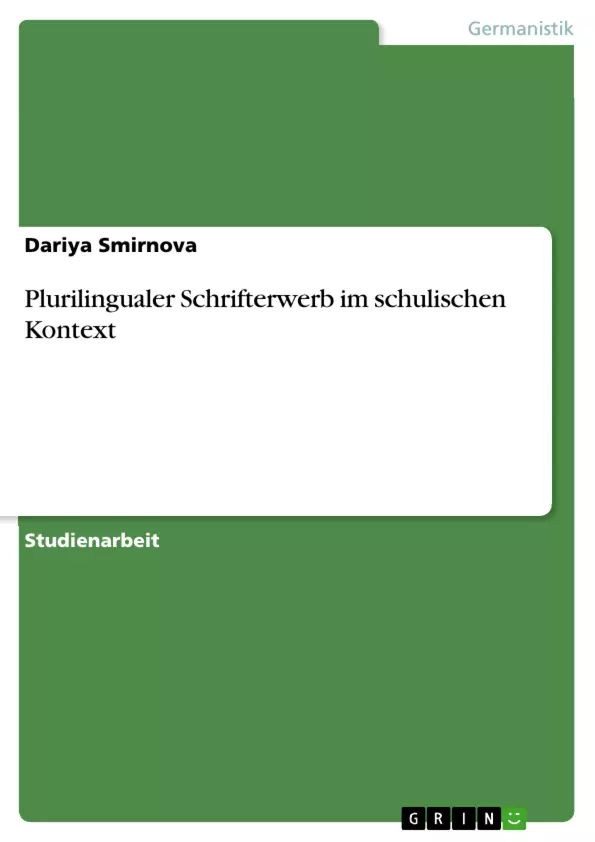Die heutige Gesellschaft wird oft der internationalen Mobilität auf der sprachlichen und kulturellen Ebene gegenübergestellt. Eine besonders starke Tendenz zur Interkulturalität zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt und in verschiedenen Einrichtungen des Bildungsbereichs wie Universitäten und Hochschulen, deren Tätigkeitsfeld sich weltweit ausdehnt. Von diversen Sprachen und Kulturen wird auch häufig im Rahmen des schulischen Kontexts gesprochen, da immer mehr Lehr- und Lernpersonen zu verschiedenen Kulturwelten gehören und dementsprechend vielsprachig sind. So spielt das Phänomen der Mehrsprachigkeit zweifelsohne eine bedeutende Rolle in der alltäglichen Realität und ist somit eine der aktuellsten Forschungsfragen, was sich in der Publikationsdichte von Studien dieser Thematik erkennen lässt.
Die Mehrsprachigkeit bietet ein breites Untersuchungsspektrum für die Fremdsprachenforscher und wird in Bezug auf alle sprachlichen Ressourcen von zwei- und mehrsprachigen Sprechern analysiert. In dieser Arbeit wird aber deren Verhältnis zur Schreibkompetenz bei mehrsprachigen SchülerInnen in den Mittelpunkt gestellt. Dabei werden die Fragen behandelt, ob die Entwicklung des plurilingualen Schriftspracherwerbs mit den traditionellen Modellen der monolingualen Schreibentwicklung in Einklang zu bringen ist und ob die Schreibkompetenz mehrsprachiger Schüler förderbedürftig ist.
Zu Beginn der Arbeit werden die Begriffe „Mehrsprachigkeit“ und „Mehrschriftlichkeit“ zum besseren Verständnis des zu untersuchenden Gegenstandes erläutert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Bedeutung von konzeptioneller Schriftlichkeit gewidmet, die im darauffolgenden Punkt analysiert wird. Anschließend folgt ein Überblick über verschiedene Modelle der einsprachigen Schreibentwicklung. Des Weiteren wird der Unterschied zwischen der multi- und monolingualen Schreibkompetenzentwicklung anhand von Schreibprodukten mehrsprachiger Schüler kontrastiv aufgezeigt. Im Folgenden werden Konsequenzen aus der Untersuchung gezogen und die Förderungsmöglichkeiten der Schreikompetenz im schulischen Kontext erläutert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist plurilingualer Schrifterwerb?
Es bezeichnet den Prozess, bei dem mehrsprachige Schüler gleichzeitig oder nacheinander Schreibkompetenzen in verschiedenen Sprachen entwickeln.
Unterscheiden sich mehrsprachige Schüler von monolingualen Schreibern?
Ja, mehrsprachige Schüler nutzen oft Ressourcen aus all ihren Sprachen, was zu anderen Entwicklungsverläufen führt als bei rein einsprachigen Modellen.
Was bedeutet konzeptionelle Schriftlichkeit?
Es beschreibt eine Form der Sprache, die unabhängig vom Medium (geschrieben oder gesprochen) durch hohe Planung und Präzision gekennzeichnet ist.
Welche Modelle der Schreibentwicklung werden im Text genannt?
Die Arbeit bezieht sich unter anderem auf Bereiter (1980), Feilke & Augst (1989) sowie Becker-Mrotzek & Böttcher (2006).
Wie kann Schreibkompetenz in mehrsprachigen Klassen gefördert werden?
Durch gezielte Fördermaßnahmen, die die Mehrsprachigkeit als Ressource anerkennen und sowohl narrative als auch argumentative Schreibfähigkeiten trainieren.
- Quote paper
- Dariya Smirnova (Author), 2016, Plurilingualer Schrifterwerb im schulischen Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384265