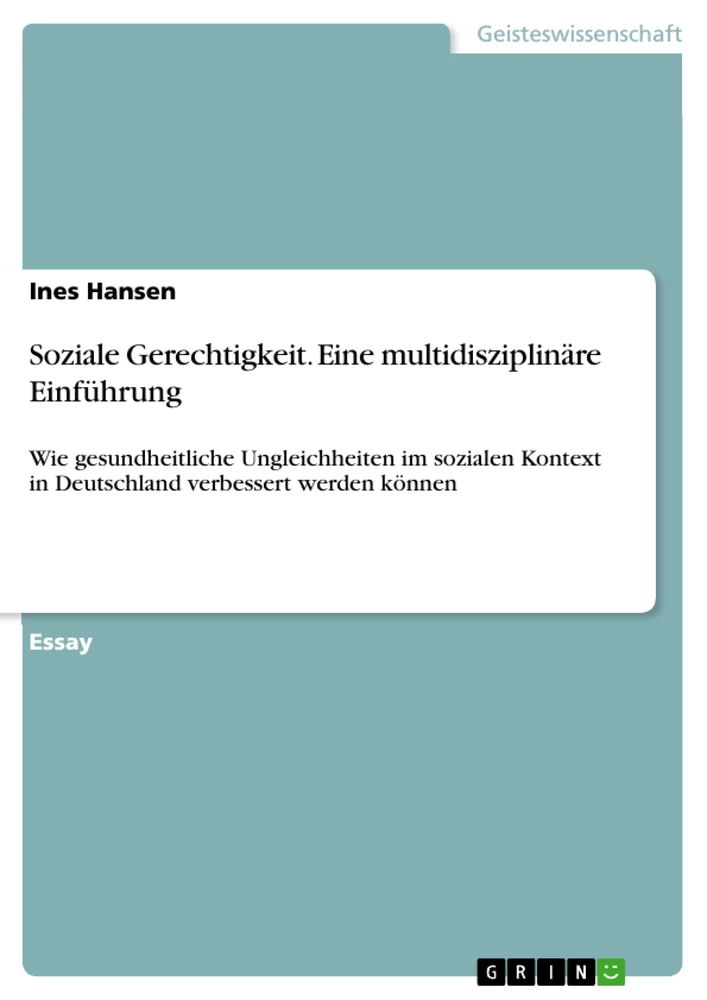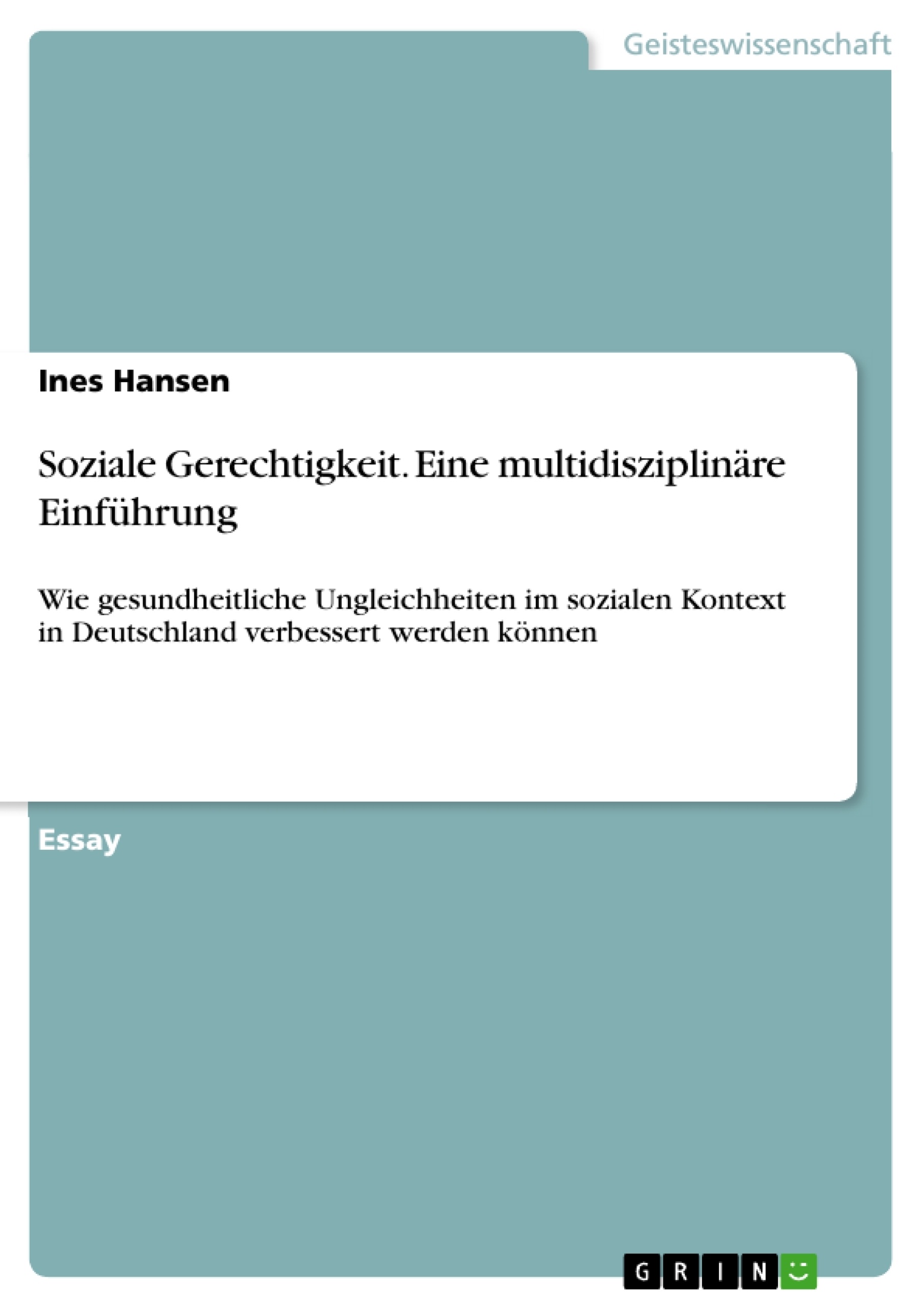Die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit, die zu gesundheitlicher Ungleichheit führen, sind, zum Beispiel auch durch das RKI, OECD und den Armutsbericht, statistisch belegt. Spezifische Verhaltensmuster in „ungesundem Konsum“ bzw. Entstehung von Suchtproblemen finden sich oft zum Beispiel in Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, Armut und niedrigem sozioökonomischem Status.
Die Frage nach der Entscheidungsfreiheit, für oder gegen ein Suchtverhalten bzw. gesundheitsabträgliches Verhalten wird in dieser Arbeit näher betrachtet sowie Erklärungs- und Lösungsansätze näher untersucht. Mit der Frage wie gesundheitliche Ungleichheiten im sozialen Kontext in Deutschland verbessert werden können, setze ich mich mit Gerechtigkeitstheorien auseinander.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1.Leistungsanspruch und Entscheidungsfreiheit
1.1 Anspruch an die Solidargemeinschaft.
1.2 soziale Gerechtigkeit und Recht auf Entscheidungsfreiheit.
2. Gerechtigkeitstheorie
2.1 Ansatz einer Theorie in der Gesundheitsförderung
3.Lösungsideen
Resümee
Literaturverzeichnis
Einleitung:
Die Zusammenhänge zwischen sozialer Ungleichheit und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit, die zu gesundheitlicher Ungleichheit führen, sind, zum Beispiel auch durch das RKI, OECD und den Armutsbericht, statistisch belegt. Spezifische Verhaltensmuster in „ungesundem Konsum“ bzw. Entstehung von Suchtproblemen finden sich oft zum Beispiel in Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, Armut und niedrigem sozioökonomischem Status
(vgl. Armutsbericht 2016, S.44, Armutsbericht 2008, S.223). Die Frage nach der Entscheidungsfreiheit, für oder gegen ein Suchtverhalten bzw. gesundheitsabträgliches Verhalten wird in dieser Arbeit näher betrachtet sowie Erklärungs- und Lösungsansätze näher untersucht. Mit der Frage wie gesundheitliche Ungleichheiten im sozialen Kontext in Deutschland verbessert werden können, setze ich mich mit Gerechtigkeitstheorien auseinander.
1. Leistungsanspruch und Entscheidungsfreiheit:
1.1. Anspruch an die Solidargemeinschaft:
Definition Solidarität (vgl. Fachlexikon der soz. Arbeit, 2007, S.827): Solidarität beschreibt einen gesellschaftlichen Zustand, in dem die Beziehungen zwischen den Einzelnen und dem Gemeinwesen gleichermaßen durch Eigenständigkeit und Verantwortung der Individuen und durch Anspruch und Verantwortung des Gemeinwesens gekennzeichnet sind. Auch Art. 1 und 3 des Grundgesetzes unseres Sozialstaates, bringen die Vorstellungen der sozialen Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft zum Ausdruck. Auch Gesundheit ist ein Recht nach SGB V § 20: “Leistungen zur Verhinderung und Verminderung von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie zur Förderung des selbstbestimmten gesundheitsorientierten Handelns der Versicherten (Gesundheitsförderung) vor. Die Leistungen sollen insbesondere zur Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesundheitschancen beitragen.“.
Auch SGB IX, §1 beschreibt das Recht auf Hilfe bzw. Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe bei von Behinderung bedrohten Menschen. Somit ist die Frage, ob ein Leistungsanspruch besteht, eindeutig geklärt. Suchtkranke haben ein Recht auf Hilfe.
1.2. soziale Gerechtigkeit und Recht auf Entscheidungsfreiheit:
Der Begriff der sozialen Gerechtigkeit wird im Fachlexikon der sozialen Arbeit als optimale Mischung des Grundrechtes aus freie Entfaltung und diversen Gerechtigkeitskonzepten das Verhältnis von Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und sozialer Ressourcenabhängigkeit akzentuiert (vgl. Fachlexikon der soz. Arbeit, 2007, S.851).
Die Ungleichheit ist nicht nur ein moralisches, sondern auch ein ökonomisches Problem. Der Armutsbericht 2016 und der OECD Bericht 2011 weisen klar auf die Zunahme der Armut, der Ungleichverteilung der Einkommen und der damit einhergehenden sozialen Ungleichheit hin. Mielck unterscheidet nach der vertikalen Ungleichheit (beruflicher Status, Einkommen, Bildung) der diversen sozialen Schichten und der horizontalen Ungleichheiten wie nach Gruppen wie Alter, Geschlecht, Nationalität und Familienstand (vgl. Mielck, 2000, S.18). Der Zusammenhang zwischen Gesundheitszustand und sozialer Ungleichheit ist sehr komplex. Das bedeutet, dass viele äußere Faktoren, wie Lebensbedingungen (Arbeitslosigkeit, Arbeitsbedingungen, soziales Umfeld u.a) und auch das Gesundheitsverhalten den Gesundheitszustand bzw. die soziale Ungleichheit beeinflussen. (vgl. Mielck, 2000, S. 158, S.172-173). Diese Faktoren/Handeln haben auch Wechselwirkung, d.h. Verhalten prägt soziale Strukturen und umgekehrt. Zu Entscheidungsfreiheit: Als angehende SozialarbeiterInnen sollten wir Sucht auch als Krankheit definieren, denn dahinter liegen ja die unterschiedlichsten Ursachen. Aber egal, wie man Sucht definiert, das Recht auf ein gerechtes Leben, wird auch durch ein gesundheitsabträgliches Verhalten nicht verwirkt. Auch in der Ottawa Charta (1986) liegt der Grundsatz zugrunde, dass Individuen ihr Gesundheitsverhalten selbst miterschaffen: …“Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben „ Das bedeutet auch, dass der Mensch befähigt sein soll selbst sein Ziel zu bestimmen und eine Entscheidung zu einer verhaltensbezogenen Änderung hin zum gesundheitsfördernden Verhalten zu treffen und umzusetzen.
2. Gerechtigkeitstheorien
Gerechtigkeitstheorien haben als Ziele die gesundheitliche Chancengleichheit und die damit verknüpfte soziale Gerechtigkeit.
Mit dem Ausbau des Sozialstaates sind Menschen nichtmehr auf die Barmherzigkeit und Gaben angewiesen, sondern haben einen Rechtsanspruch auf Hilfen und dass ihnen gegenüber der Gesellschaftsvertrag (vgl. Rousseau) eingehalten wird. Rawls hat in seiner egalitaristischen Gerechtigkeitstheorie die Ressourcen als Ansätze genommen. Er ging davo n aus, dass durch die Gleichheitsverteilung von Ressourcen, gleichen Zugangschancen zu Ämtern und Positionen und dass durch Ungleichheiten beim Wettbewerb um Güter, die den am schlechtesten Gestellten zugutekommen, Gleichheit hergestellt werden kann. Das beutete nach Rawls, dass „die Ungleichheitsverteilung von Ressourcen einen Einfluss auf das gesundheitliche Wohlergehen hat“ (vgl. Abel, Schori; ÖZS 2009, S.52). Der das humanistische Gerechtigkeitskonzept vertretende Michael Walzer kritisiert Rawls universell geltendes Gerechtigkeitsprinzip bzw. die gleichmachende Verteilung. Eine Weiterentwicklung der Gerechtigkeitstheorien ist der Capability Approach(CA). Wichtige Vertreter sind Amartya Sen und Martha Nussbaum. Hier werden nicht die Ressourcen sondern die persönlichen Verwirklichungschancen (Sen: Capabilities) sowie die individuellen Handlungsoptionen und Entwicklung von Fähigkeiten (Nussbaum: Capabilities) in den Vordergrund gestellt (vgl. DIW Berlin,2006, S.35). Der Grundgedanke ist, dass Armut/Wohlstand nicht am Lebensstandard sondern an den individuellen Verwirklichungschancen gemessen wird. Das Ziel des CA ist, die Menschen zu befähigen, für sich ein gutes Leben zu führen. Die Entscheidung, was für einem selbst ein gutes Leben ist, geht wiederum von dem Recht aus, das für sich selbst zu entscheiden. Ein Ansatz des CA ist auch, nicht allgemeingültig festzulegen, was gerecht ist, sondern setzt auf selbstwirksame Menschen, die aufgrund realer Verwirklichungschancen ein ansteckendes Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Die Voraussetzung beim CA ist, ungleiche Fähigkeiten und Voraussetzungen zu berücksichtigen, damit alle befähigt werden können, ihre Chancen zu nutzen (vgl. OECD 2011, S.10).
2.1 Ansatz einer Theorie in der Gesundheitsförderung
Der Ansatz der CA ist also auf der individuellen Ebene und auf der gesellschaftlichen Ebene gleichzeitig zu betrachten. Die Perspektive ist eine Verbesserung der individuellen und gesellschaftlichen Verwirklichungschancen. Das Individuum soll durch die eigene Befähigung, bedingt durch gesellschaftliche Veränderungen (Entfaltung gesellschaftlicher Teilhabe) zu Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit befähigt werden. Verhaltensbezogene Ansätze bei der Gesundheitsförderung, wie Empowerment und Partizipation; sollten dazu führen, dass es den Menschen möglich macht, bewusste gesundheitsfördernde Entscheidungen zu treffen und auch nachhaltig umzusetzen. Das bedeutet auch, dass das Ziel, einer gesundheitsfördernden Verhaltensweise (abnehmen, mehr bewegen, Rauchen aufhören, Suchtverhalten ändern etc.) vom Menschen individuell selbst entschieden wird. Für dieses Ziel sollten dann die entsprechenden Umsetzungsmöglichkeiten vorhanden sein oder geschaffen werden. Somit hängen die individuellen Handlungsspielräume zur Gesundheitsförderung auch signifikant mit den persönlichen Ressourcen der drei Kapitalsorten nach Bourdieu (vgl. Basistext O6,2008, S.28) zusammen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit?
Statistiken zeigen, dass Armut, Arbeitslosigkeit und niedriger sozioökonomischer Status oft zu gesundheitlicher Ungleichheit und spezifischen Verhaltensmustern wie Suchtproblemen führen.
Was besagt der „Capability Approach“ (Befähigungsansatz)?
Nach Amartya Sen und Martha Nussbaum misst dieser Ansatz Wohlstand nicht am Lebensstandard, sondern an den individuellen Verwirklichungschancen und Handlungsoptionen eines Menschen.
Haben Suchtkranke einen rechtlichen Anspruch auf Hilfe?
Ja, Gesetze wie das SGB V und SGB IX verankern das Recht auf Leistungen zur Verminderung von Krankheitsrisiken und zur Förderung der Teilhabe, unabhängig vom Verhalten des Einzelnen.
Wie definiert John Rawls soziale Gerechtigkeit?
Rawls setzt auf eine gerechte Verteilung von Ressourcen und gleichen Zugangschancen, wobei Ungleichheiten nur zulässig sind, wenn sie den am schlechtesten Gestellten nützen.
Was bedeutet „Empowerment“ im Kontext der Gesundheitsförderung?
Es bedeutet, Menschen zu befähigen, bewusste gesundheitsfördernde Entscheidungen zu treffen und Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände zu erlangen.
Welche Rolle spielt die Ottawa-Charta für die Gesundheitsgerechtigkeit?
Die Ottawa-Charta von 1986 betont, dass Gesundheit durch Selbstbestimmung und die Sorge für sich und andere entsteht, was soziale Unterstützung voraussetzt.
- Arbeit zitieren
- Ines Hansen (Autor:in), 2016, Soziale Gerechtigkeit. Eine multidisziplinäre Einführung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384431