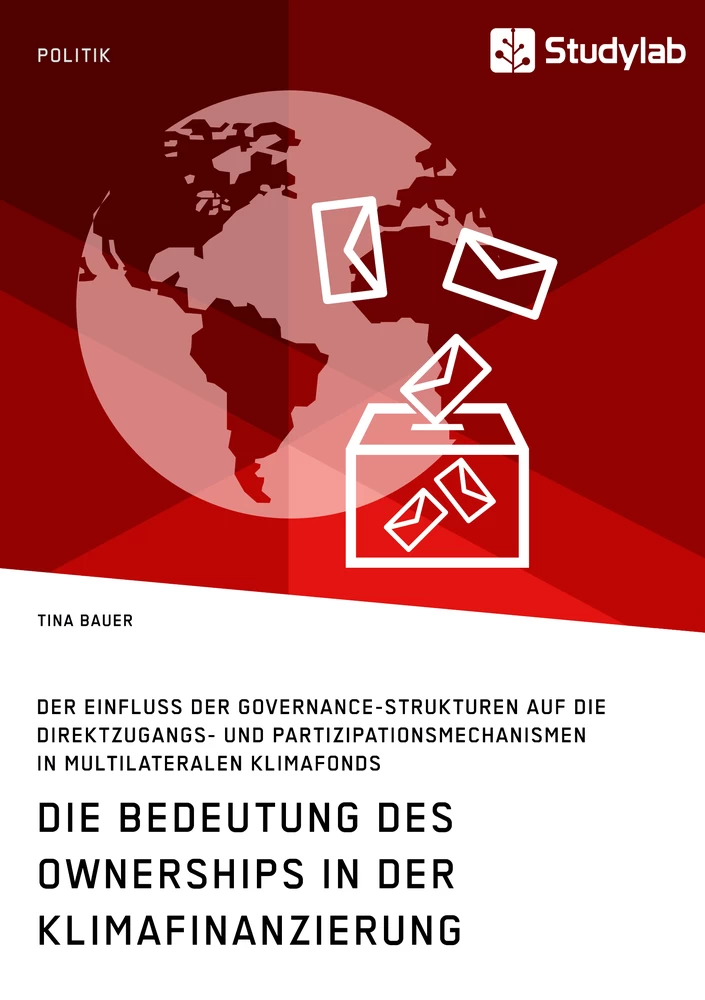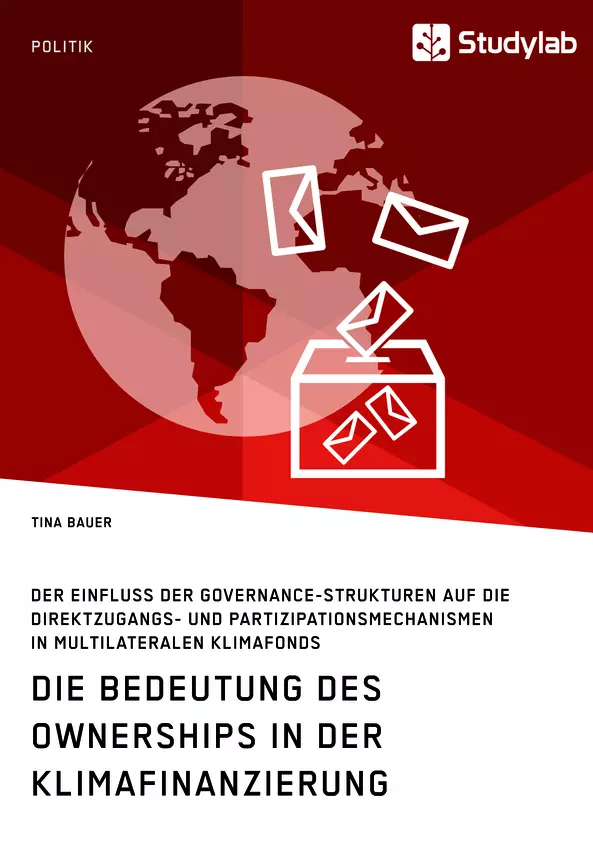Das Thema Klimawandel ist allgegenwärtig. Die Folgen sind vor allem in Ländern südlich des Äquators sichtbar und sowohl akademische, als auch politische Debatten drehen sich um unsere Erde. In dem 2015 entstandenen Abkommen in Paris verpflichteten sich insbesondere Industrieländer dazu, innerhalb der nächsten 10 Jahre 100 Milliarden USD pro Jahr für Unterstützungsmaßnahmen für Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen zu mobilisieren. Auch nationale Organisationen der betroffenen Länder haben mittlerweile einen Direktzugang zu den multilateralen Klimafonds. Hierbei stellt sich die Frage, ob die Interessen der Geberländer in der Verwaltung der Fonds eine schwache Ausprägung der „Ownership-Policies“ und Unterstützungsmaßnahmen nationaler Institutionen begünstigen.
In ihrem Buch untersucht Tina Bauer den Einfluss der Sitz- und Stimmverteilung zwischen Geldgebern und -empfängern auf die Unterstützungsmaßnahmen der Fonds. Doch auch die Rolle von Vertretern der Zivilgesellschaft wird von der Autorin umfassend thematisiert. Durch einen Fallvergleich dreier multilateraler Klimafonds deckt sie fesselnde Fakten in unserer Klimapolitik auf und liefert zugleich eine machtkritische Analyse der Governance-Strukturen unserer internationalen politischen Ökonomie.
Aus dem Inhalt:
Klimawandel;
Fonds;
Ownership-Prinzip;
Ökonomie;
Finanzierung
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Zusammenfassung
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Untersuchungsgegenstand
- 2.1 Fallauswahl: multilaterale Anpassungsfonds
- 2.2 Entstehung und Organisationsstruktur der Fonds
- 2.2.1 Least Developed Country Fund
- 2.2.2 Adaptation Fund
- 2.2.3 Green Climate Fund
- 3 Problemstellung: Beteiligung nationaler Akteure in der Anpassungsfinanzierung
- 3.1 Hintergrund: Anpassungsfinanzierung in multilateralen Institutionen
- 3.2 Geberdominanz in der Governance
- 3.3 Ownership: Hintergrund und Relevanz in der Anpassungsfinanzierung
- 3.3.1 Direktzugang: Status quo
- 3.3.2 Stakeholder- Partizipation: Status quo
- 4.1 Forschungsstand- und Lücke
- 4.2 Begriffsdefinitionen und Operationalisierung
- 4.2.1 Governance
- 4.2.2 Ownership: Direktzugang und Stakeholder-Partizipation
- 4.4 Anwendung auf den Untersuchungsgegenstand
- 4.4.1 Ideologien und Interessen
- 4.4.2 Durchsetzung: Macht
- 5.1 Polity und Politics in der Governance
- 5.2 Ownership- Policies: Direktzugangs- und Partizipationsmechanismen
- 5.3 Analyse der Daten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit beleuchtet die Herausforderungen bei der Umsetzung des „Ownership-Prinzips“ in multilateralen Klimafonds. Der Fokus liegt auf dem unzureichenden Direktzugang nationaler Institutionen aus Entwicklungsländern zu den Mitteln der Fonds sowie der geringen Einbeziehung von Projektbeteiligten im Projektzyklus. Die Theorie der internationalen politischen Ökonomie bildet die Grundlage für die Untersuchung, ob dominierende Interessen der Geber gegenüber denen der Empfängerländer und Bevölkerungsgruppen in der Governance der Fonds zu einer schwachen Ausprägung der Ownership-Policies und unterstützenden Maßnahmen nationaler Institutionen führen.
- Analyse des Einflusses der Sitz- und Stimmverteilung zwischen Geber- und Empfängerländern auf die Ausprägung der Direktzugangsmechanismen sowie die finanziellen und technischen Unterstützungsmaßnahmen und Anreize seitens der Fonds.
- Bewertung der Rolle von Beobachtern aus der Zivilgesellschaft in der Governance und deren Einfluss auf die Ausprägung der bestehenden Policies zur Stakeholder-Partizipation.
- Komparative Perspektive auf die Governance und Ownership-Policies von drei multilateralen Klimafonds: Least Developed Country Fund (LDCF), Adaptation Fund (AF) und Green Climate Fund (GCF).
- Identifizierung von Korrelationen zwischen Governance-Strukturen und Ownership-Policies sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Verbesserung der Effektivität der Fonds.
- Beitrag zum Verständnis der politischen Ökonomie der Klimafinanzierung und deren Auswirkungen auf die Eigenverantwortung der Empfängerländer und Stakeholder.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 stellt die drei untersuchten Fonds – LDCF, AF und GCF – vor, beschreibt deren Auswahl und erläutert Entstehungsgeschichte, Organisationsstruktur und Projektzyklus. Kapitel 3 beleuchtet den Hintergrund der Anpassungsfinanzierung und die Relevanz des Ownership-Prinzips für die effektive Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Die Problematik der Geberdominanz in der Governance und die Kritik am Status quo der Direktzugangs- und Partizipationsmechanismen werden diskutiert. Kapitel 4 setzt den theoretischen Rahmen für die Analyse der Governance-Strukturen und deren Einfluss auf die Ownership-Policies, indem die Theorie der internationalen politischen Ökonomie vorgestellt wird. Es werden relevante Begriffsdefinitionen und Operationalisierungen der Variablen Governance und Ownership vorgenommen und anhand der Theorie Hypothesen für die Analyse abgeleitet. Kapitel 5 beschreibt die Konzepte für die Analyse der Governance und des Ownership sowie das methodische Vorgehen. Die Datenquellen und deren Verwertung werden skizziert. Kapitel 6 untersucht die beiden Dimensionen der Governance – Polity und Politics – und analysiert die Ausprägung der Ownership-Policies in Form von Direktzugangsmechanismen und Stakeholder-Partizipation. Kapitel 7 vergleicht die Ergebnisse der Analyse der drei Fonds und untersucht die Korrelation zwischen Governance-Strukturen und Ownership-Policies.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Klimafinanzierung, Anpassungsfinanzierung, Multilaterale Klimafonds, Ownership, Governance, Direktzugang, Stakeholder-Partizipation, Internationale Politische Ökonomie, Geberinteressen, Empfängerländer, Zivilgesellschaft, LDCF, Adaptation Fund, Green Climate Fund.
- Citation du texte
- Tina Bauer (Auteur), 2018, Die Bedeutung des Ownerships in der Klimafinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384442