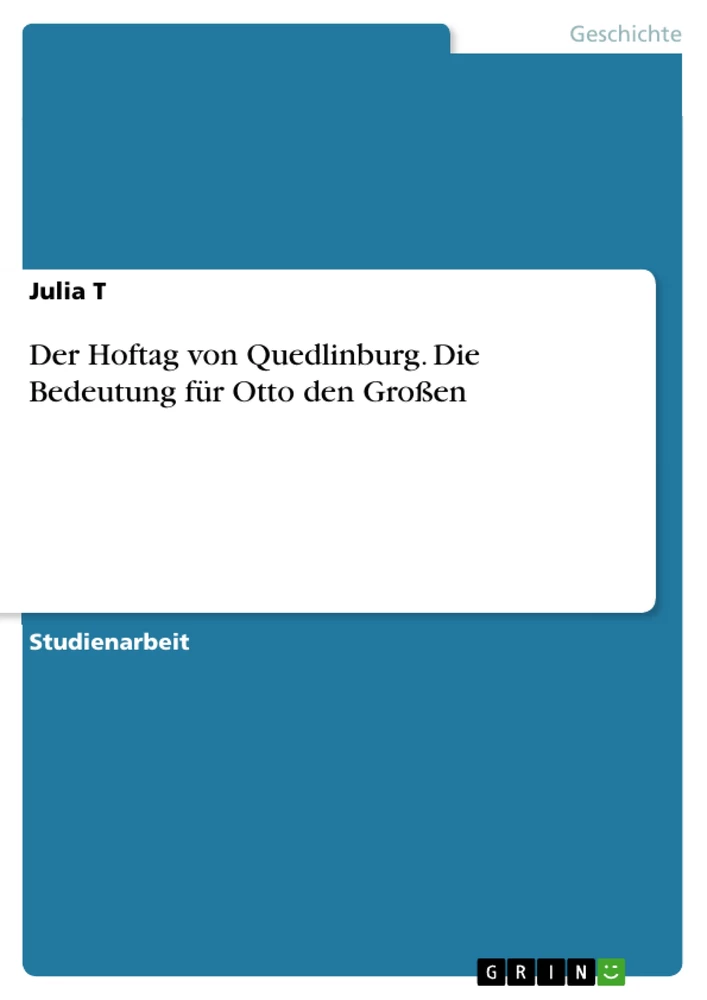In dieser Arbeit soll untersucht werden, welche Bedeutung der Hoftag von Quedlinburg für die ausgehende Herrschaft Ottos I hatte und weshalb dort besonders die slawischen Völker geladen wurden. So waren dort unter anderem die Ungarn vertreten, die in der Schlacht auf dem Lechfeld 955 durch Otto vernichtend geschlagen worden waren. Außerdem kamen die Polen und die Böhmen nach Quedlinburg.
Um die Thematik entsprechend darzustellen, soll zuerst die Ostpolitik Ottos in den Blick genommen werden, um zu zeigen, wie Otto versuchte den Osten an das Reich zu binden und um zu klären, warum die slawischen Völker zum Hoftag in Quedlinburg geladen wurden. Danach soll ein Blick auf Ottos Kaiserkrönung geworfen werden und geklärt werden, wie er heim nach Sachsen kehrte. Hierzu wird gesondert eine Begebenheit um den Sachsenherzog Hermann Billung analysiert. Was den Hoftag betrifft, so soll der Tagungsort Quedlinburg, die Zeit, der Ostersonntag 973, und die Teilnahme der slawischen Völker am Hoftag betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Otto I. und die Ostpolitik
- Vor dem Hoftag - Ottos Kaiserwürde
- Schritte zum Kaisertum Ottos I.
- Die provozierte Heimkehr: Hermann Billung und der Kaiser...
- Der Hoftag von Quedlinburg 973
- Quedlinburg als Tagungsort
- Ostern als gewählter Zeitpunkt
- Die Teilnahme der slawischen Völker
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Hoftag von Quedlinburg im Jahr 973 und untersucht seine Bedeutung für die ausgehende Herrschaft Ottos I. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, warum Otto zahlreiche slawische Völker zum Hoftag eingeladen hat und welche Rolle diese im Kontext der politischen und strategischen Ziele Ottos spielten.
- Die Ostpolitik Ottos I. und seine Bemühungen, den Osten an das Reich zu binden.
- Ottos Kaiserkrönung und sein Verhältnis zu Hermann Billung.
- Der Hoftag von Quedlinburg als Ort der Machtdemonstration und der Huldigung Ottos.
- Die Bedeutung des Hoftags für die politische und gesellschaftliche Ordnung im 10. Jahrhundert.
- Die Rolle der slawischen Völker im Kontext der ottonischen Herrschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Hoftags von Quedlinburg ein und beleuchtet die Quellenlage sowie die Forschung zu diesem Ereignis. Kapitel 2 analysiert Ottos Ostpolitik und erläutert die Gründe für seine Bemühungen um die Christianisierung und Eingliederung der slawischen Völker. Kapitel 3 widmet sich den Vorbereitungen auf den Hoftag, insbesondere der Kaiserkrönung Ottos und seiner Beziehung zu Hermann Billung. Die einzelnen Punkte des Hoftags werden in Kapitel 4 detailliert dargestellt, darunter der Tagungsort Quedlinburg, die Zeit des Osterfestes 973 und die Teilnahme der slawischen Völker.
Schlüsselwörter
Hoftag von Quedlinburg, Otto I., Ostpolitik, slawische Völker, Kaiserkrönung, Hermann Billung, Christianisierung, Machtdemonstration, politische Ordnung, 10. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Hoftag von Quedlinburg 973?
Es war eine der bedeutendsten Versammlungen unter Otto dem Großen, die als Machtdemonstration und Ort der Huldigung nach seiner Kaiserkrönung diente.
Warum wurden slawische Völker zum Hoftag geladen?
Otto wollte den Osten fest an das Reich binden und seine Oberhoheit über Völker wie die Polen, Böhmen und Ungarn demonstrieren.
Welche Rolle spielte Hermann Billung bei Ottos Heimkehr?
Die Arbeit analysiert eine spezielle Begebenheit um den Sachsenherzog Hermann Billung, die im Zusammenhang mit Ottos Rückkehr aus Italien steht.
Warum wurde Quedlinburg als Tagungsort gewählt?
Quedlinburg war ein zentraler Ort der ottonischen Familiengeschichte und bot den passenden repräsentativen Rahmen für das Osterfest.
Welche Bedeutung hatte der Hoftag für Ottos Herrschaft?
Er markierte den glanzvollen Höhepunkt und gleichzeitig den Abschluss der Herrschaft Ottos I., kurz vor seinem Tod im selben Jahr.
- Quote paper
- Julia T (Author), 2014, Der Hoftag von Quedlinburg. Die Bedeutung für Otto den Großen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384478