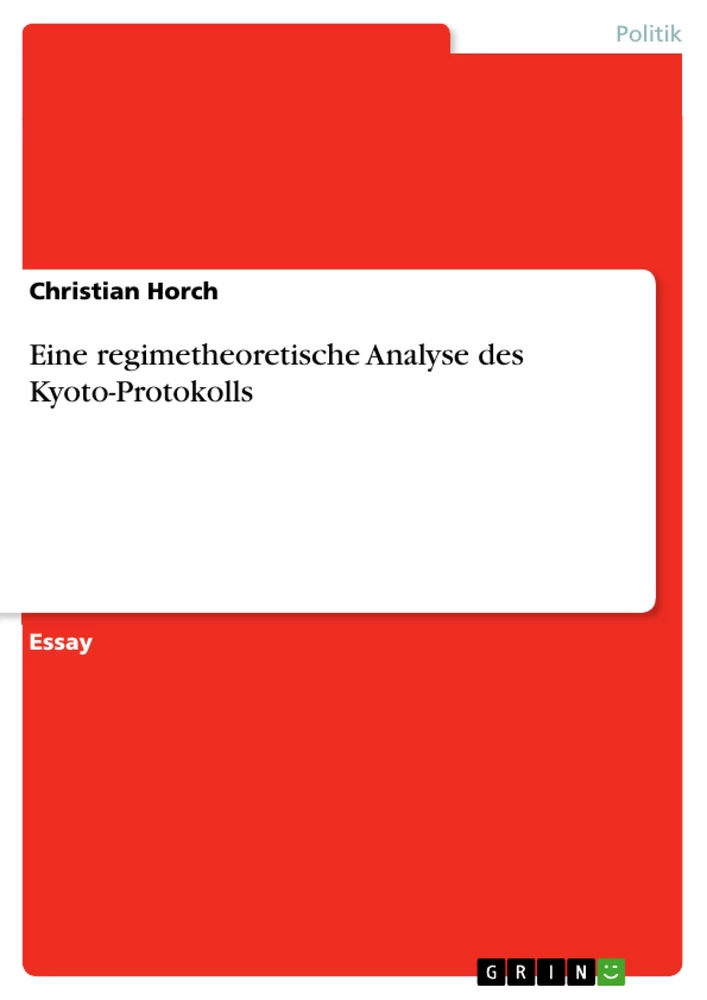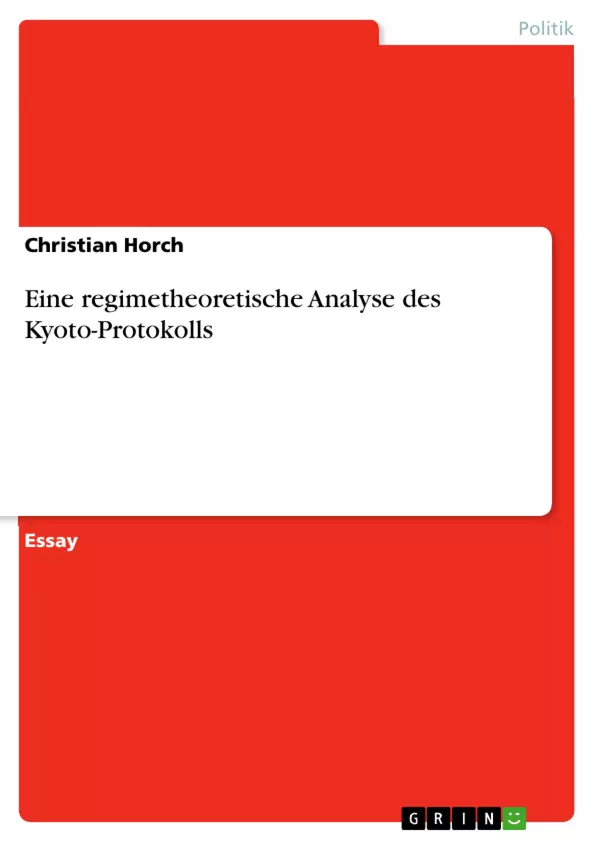Die klimatischen Bedingungen unserer Umwelt befinden sich im Wandel, wobei der Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen in weiten Teilen unseres Planeten den grundlegenden Anstoß bildet. Diese Veränderungen manifestieren sich unter anderem durch weltweit beobachtbare Zunahme von extremen Klimaereignissen, wie einer zunehmenden Anzahl schwerer Regenfälle, Überschwemmungen, Vergrößerung der Wüstengebiete, längerer Trockenphasen, Rückgang der Eismassen in Gletscher- und Polarregionen, Anstieg des Meeresspiegels und einer Verschiebung von Klimazonen. Als Ursache für diese Phänomene ist auf der einen Seite das natürliche Durchlaufen verschiedener Klimaphasen zu identifizieren, auf der anderen Seite die seit der Industrialisierung steigenden Mengen an Treibhausgasen (THG), die als Nebenprodukt des menschlichen Wirtschaftens in die Atmosphäre abgesondert werden.
Auf Basis dieser Erkenntnisse ergab sich für die internationale Staatengemeinschaft eine Problemstellung, deren Auswirkungen langfristig jeder Staat ausgesetzt sein wird, gleichwohl ob er am Ausstoß von THG maßgeblich beteiligt ist oder nicht. Weiterhin bedeutet dies auch, dass nicht nur die Staaten, die als Verursacher auftreten, Interesse an einer Lösung dieses Problems haben, vielmehr wird die gesamte Menge aller Staaten eine Abwendung der negativen Folgen des Klimawandels bewirken wollen wird und damit zu einem Teil ihrer internationalen Politik machen.
Als direkte Manifestation dieser Interessenlage entstanden im vergangenen zwanzigsten Jahrhundert, nach der ersten Weltklimakonferenz im Jahr 1979, eine Reihe an internationalen Organisationen, Abkommen und Institutionen, welche mit dem zentralen Ziel eingerichtet wurden, sich unter anderem mit Fragen des Klimawandels zu befassen, so zum Beispiel das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) und die daraus entstandene Klimarahmenkonvention UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) (UNFCCC 2013). Jedoch wurde nach Verabschiedung einer Rahmenkonvention erst einige Jahre später mit dem Kyoto-Protokoll 1997 eine Übereinkunft getroffen, welche sich konkret mit der Beschränkung des Ausstoßes von THG und hierfür angesetzten Zeitrahmen auseinandersetzt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Regimetheorie
- Das Kyoto-Protokoll
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Kyoto-Protokoll aus regimetheoretischer Perspektive und untersucht, wie das Zustandekommen und der Aufbau des Abkommens mithilfe der Theorie erklärt werden können. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das Kyoto-Protokoll als Beispiel für internationale Kooperation zur Bewältigung globaler Umweltprobleme zu betrachten und die Rolle von Institutionen in diesem Prozess zu beleuchten.
- Die Entstehung und Bedeutung des Kyoto-Protokolls
- Die Rolle der Regimetheorie in der Erklärung internationaler Kooperation
- Die Anwendung der Regimetheorie auf das Kyoto-Protokoll
- Die Analyse der Funktionsmechanismen des Kyoto-Protokolls im Hinblick auf die Reduktion von Transaktionskosten
- Die Herausforderungen und Perspektiven der internationalen Zusammenarbeit im Bereich des Klimaschutzes
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beschreibt den Klimawandel als ein globales Problem, das sowohl natürliche als auch anthropogene Ursachen hat. Sie stellt das Kyoto-Protokoll als internationales Abkommen zur Beschränkung des Ausstoßes von Treibhausgasen vor und erläutert die Herausforderungen, die mit der internationalen Kooperation in diesem Bereich verbunden sind. Die Einleitung stellt außerdem die Regimetheorie als geeignetes theoretisches Framework zur Analyse des Kyoto-Protokolls vor.
Regimetheorie
Dieses Kapitel stellt die Regimetheorie als eine neoinstitutionalistische Theorie vor, die die Bedeutung von Institutionen in der internationalen Kooperation hervorhebt. Es werden die grundlegenden Konzepte der Regimetheorie erläutert, wie z.B. die Definition von Regimen, die Bildung von Regimen, die Funktionsmechanismen von Regimen und die Rolle von Transaktionskosten.
Das Kyoto-Protokoll
Das dritte Kapitel analysiert das Kyoto-Protokoll aus regimetheoretischer Perspektive. Es wird gezeigt, dass das Abkommen als eine kooperative internationale Institution mit spezifischen Prinzipien, Normen und Regeln zu betrachten ist, die auf die gemeinsame Zielsetzung der Reduktion von Treibhausgasen ausgerichtet sind.
Schlüsselwörter
Kyoto-Protokoll, Regimetheorie, internationale Kooperation, Klimawandel, Treibhausgase, Transaktionskosten, Interdependenz, Institutionen, Normen, Regeln, Umweltschutz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kyoto-Protokoll?
Es ist ein 1997 beschlossenes internationales Abkommen, das erstmals verbindliche Zielwerte für den Ausstoß von Treibhausgasen in den Industrieländern festlegte.
Was ist die Regimetheorie?
Die Regimetheorie ist ein neoinstitutionalistischer Ansatz, der erklärt, wie Staaten durch internationale Regime (Normen, Regeln und Verfahren) trotz Anarchie weltweit kooperieren.
Wie hilft das Kyoto-Protokoll, Transaktionskosten zu senken?
Durch feste Regeln und Informationsaustausch innerhalb des Regimes müssen Staaten nicht mit jedem Partner einzeln verhandeln, was die Kosten für internationale Klimaschutzkooperationen reduziert.
Welche Rolle spielen Institutionen wie das IPCC?
Institutionen wie das IPCC liefern die wissenschaftliche Basis, auf der politische Abkommen wie die Klimarahmenkonvention (UNFCCC) und das Kyoto-Protokoll erst entstehen konnten.
Warum ist internationale Kooperation beim Klimawandel so schwierig?
Da das Klima ein globales Gut ist, besteht die Gefahr von Trittbrettfahrer-Verhalten. Die Regimetheorie zeigt auf, wie durch Überwachungsmechanismen dennoch Vertrauen und Kooperation entstehen können.
- Quote paper
- Christian Horch (Author), 2014, Eine regimetheoretische Analyse des Kyoto-Protokolls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384508