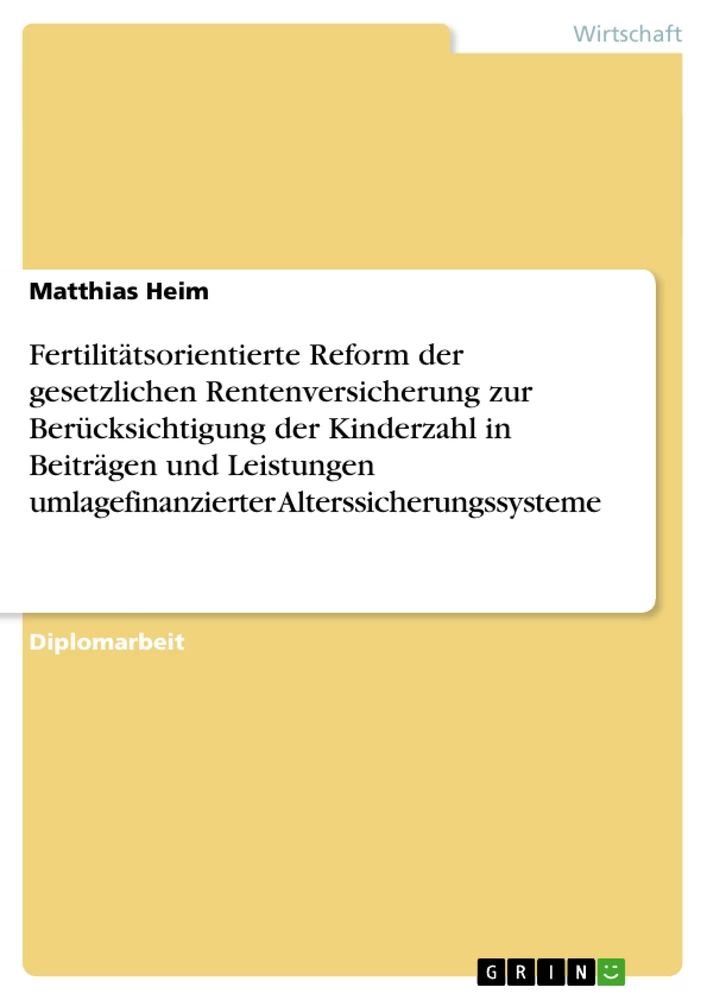[...]Zum derzeitigen Stand haben sich im gesetzlichen Umlagesystem Rentenansprüche in Höhe von etwa sechs Billionen Euro aufgebaut, denen jedoch nur rund 3,5 Billionen Euro an Beitragszahlungen gegenüber stehen. Um diesen Saldo ausgeglichener zu gestalten, stehen dem Gesetzgeber zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen kann er auf der Leistungsseite Kürzungen vornehmen, zum anderen auf der Einnahmenseite ansetzen, um das Beitragsaufkommen zu erhöhen. Letzteres lässt sich durch eine Vielzahl verschiedener Instrumente erreichen, die in der politischen Diskussion zumeist auch schon Beachtung gefunden haben. Dazu gehört neben einer forcierten Einwanderung, der Ausweitung des Pflichtversichertenkreises oder der Ausdehnung der Bemessungsgrundlage auf alle Einkunftsarten auch die Steigerung der Fertilität. Obwohl die Höhe der Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung von mehreren Faktoren abhängt, sehen viele Autoren die Ursache des Problems in der zu niedrigen Kopfzahl der nächsten Generation. Mit dem Argument, ein Umlagesystem könne nur bei ausreichender Nachkommenschaft existieren, und vor dem Hintergrund des ihrer Ansicht nach falsch konstruierten Generationenvertrages fordern sie bevölkerungspolitische Maßnahmen innerhalb des Rentensystems mit dem Ziel der Steigerung der Geburtenzahlen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der Fertilität und Alterssicherung gibt (Kapitel 4) und widmet sich anschließend möglichen Reformvorschlägen, die das Geburtenverhalten positiv zu beeinflussen versuchen (Kapitel 5). Zuvor werden die beiden Teilbereiche Fertilität (Kapitel 2) und Alterssicherung (Kapitel 3) getrennt voneinander betrachtet. Nach einer Überprüfung der Wirksamkeit bevölkerungspolitischer Maßnahmen (Kapitel 6) wagt die Arbeit einen Blick über die Grenzen (Kapitel 7), bevor sie in Kapitel 8 mit einem Fazit schließt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fertilität
- Bestandsaufnahme
- Streuung der Fertilität
- Ursachen des Geburtenrückgangs
- Emanzipation der Frau
- Zunehmende Unfruchtbarkeit
- Finanzielle Belastung
- Weniger Ehen, mehr Scheidungen
- Modernisierung der Gesellschaft
- Sonstiges
- Empirische Beobachtungen
- Alterssicherung
- Bestandsaufnahme
- Grundprinzipien der GRV
- Finanzielle Probleme der GRV
- Anerkennung der Erziehungsleistung im heutigen System
- Fertilität und Alterssicherung
- Die mikroökonomische Fertilitätstheorie der Chicago school
- Das Qualitäts-Quantitäts-Modell
- Theorie der Zeitallokation
- Erklärung des Geburtenverhaltens im Zeitablauf
- Das Pennsylvania-Modell
- Das „natürliche Fertilitätsverhalten“
- Die Easterlin-Hypothese
- Empirische Befunde
- Spieltheoretische Analysen der Fruchtbarkeit
- Rückwirkungen der Sozialversicherung auf die Fertilität
- Implikationen für die Ausgestaltung einer politischen Maßnahme
- Die mikroökonomische Fertilitätstheorie der Chicago school
- Fertilitätsorientierte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung
- Externe Effekte von Kindern
- Steuer- versus Rentensystem
- Der vollständige Generationenvertrag
- Kinderleistungsausgleich
- Kindergeld- und Ausbildungskreditsystem
- Rekonstruktion des Generationenvertrages
- Leistungsseitige Reformideen
- Rente in Abhängigkeit von der Kinderzahl
- Vorschläge
- Pro-Argumente
- Contra-Argumente
- Fazit zur Rentendifferenzierung
- Elternrenten-Modelle
- Rente in Abhängigkeit von der Kinderzahl
- Einnahmenseitige Reformideen
- Beiträge in Abhängigkeit von der Kinderzahl
- Vorschläge
- Pro-Argumente
- Contra-Argumente
- Fazit zur Beitragsdifferenzierung
- Kinderjahre
- Beiträge in Abhängigkeit von der Kinderzahl
- Sonstige Vorschläge
- Voll eigenständiges System
- Flexibles System eigenständiger und leistungsbezogener Alterssicherung
- Erziehungsgehalt
- Ausweitung der Erziehungszeiten
- Zur Berücksichtigung der Qualität
- Zur Wirksamkeit bevölkerungspolitischer Maßnahmen
- Blick über die Grenzen
- Beispiel Frankreich
- Beispiel Ex-DDR
- Beispiel Norwegen
- Beispiel USA
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Alterssicherung in Deutschland und analysiert die Möglichkeiten einer fertilitätsorientierten Reform der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Ziel ist es, ein System zu entwickeln, das die Kinderzahl in Beiträge und Leistungen der umlagefinanzierten Alterssicherung berücksichtigt.
- Analyse der Ursachen für den Geburtenrückgang in Deutschland
- Untersuchung der mikroökonomischen Fertilitätstheorie und empirischer Befunde
- Bewertung der Auswirkungen des demografischen Wandels auf die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung
- Entwicklung von Reformkonzepten zur Einbeziehung der Kinderzahl in Beiträge und Leistungen der Rentenversicherung
- Beurteilung der Wirksamkeit verschiedener bevölkerungspolitischer Maßnahmen im internationalen Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Bestandsaufnahme der aktuellen Fertilitätsentwicklung in Deutschland. Sie beleuchtet die Ursachen des Geburtenrückgangs und analysiert die verschiedenen Faktoren, die das Geburtenverhalten beeinflussen. Anschließend wird die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) im Detail betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die Grundprinzipien der GRV, die finanziellen Probleme der GRV und die Anerkennung der Erziehungsleistung im aktuellen System. Im dritten Kapitel beschäftigt sich die Arbeit mit dem Zusammenhang zwischen Fertilität und Alterssicherung. Sie stellt verschiedene mikroökonomische Modelle zur Erklärung des Geburtenverhaltens vor und analysiert die Rückwirkungen der Sozialversicherung auf die Fertilität. Darüber hinaus werden empirische Befunde und spieltheoretische Analysen der Fruchtbarkeit vorgestellt. Das vierte Kapitel widmet sich der Frage, wie die gesetzliche Rentenversicherung reformiert werden kann, um die Kinderzahl in Beiträge und Leistungen zu berücksichtigen. Es werden verschiedene Reformkonzepte vorgestellt, die auf der Einnahmeseite (Beiträge) und der Ausgabeseite (Leistungen) der GRV ansetzen. Die Arbeit diskutiert die Vor- und Nachteile der einzelnen Reformideen und zieht ein Fazit zur Wirksamkeit bevölkerungspolitischer Maßnahmen. Schließlich wird ein Blick über die Grenzen geworfen, um die Erfahrungen anderer Länder mit fertilitätsorientierten Reformen zu analysieren.
Schlüsselwörter
Fertilität, demografischer Wandel, Alterssicherung, gesetzliche Rentenversicherung, Generationenvertrag, Reformkonzepte, Kinderzahl, Beiträge, Leistungen, externe Effekte, bevölkerungspolitische Maßnahmen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die Geburtenrate die Rentenversicherung?
In einem umlagefinanzierten System finanzieren die Jüngeren die Renten der Älteren. Eine niedrige Geburtenrate führt langfristig zu weniger Beitragszahlern und finanziellen Instabilitäten.
Was ist eine fertilitätsorientierte Rentenreform?
Ein Reformansatz, bei dem die Anzahl der Kinder direkten Einfluss auf die Höhe der Rentenbeiträge oder die späteren Rentenleistungen hat, um Erziehungsleistungen anzuerkennen.
Was versteht man unter dem „Generationenvertrag“?
Es ist die unausgesprochene Vereinbarung, dass die erwerbstätige Generation für die Rentner aufkommt, in der Erwartung, dass die nächste Generation dasselbe tut.
Welche Ursachen gibt es für den Geburtenrückgang in Deutschland?
Diskutiert werden Faktoren wie die Emanzipation der Frau, finanzielle Belastungen, die Modernisierung der Gesellschaft sowie Veränderungen in den Familienstrukturen.
Können Rentenreformen die Geburtenrate steigern?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit solcher Maßnahmen und vergleicht sie mit internationalen Beispielen wie Frankreich oder Norwegen, um zu prüfen, ob finanzielle Anreize im Rentensystem das Geburtenverhalten beeinflussen.
- Arbeit zitieren
- Matthias Heim (Autor:in), 2004, Fertilitätsorientierte Reform der gesetzlichen Rentenversicherung zur Berücksichtigung der Kinderzahl in Beiträgen und Leistungen umlagefinanzierter Alterssicherungssysteme, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38466