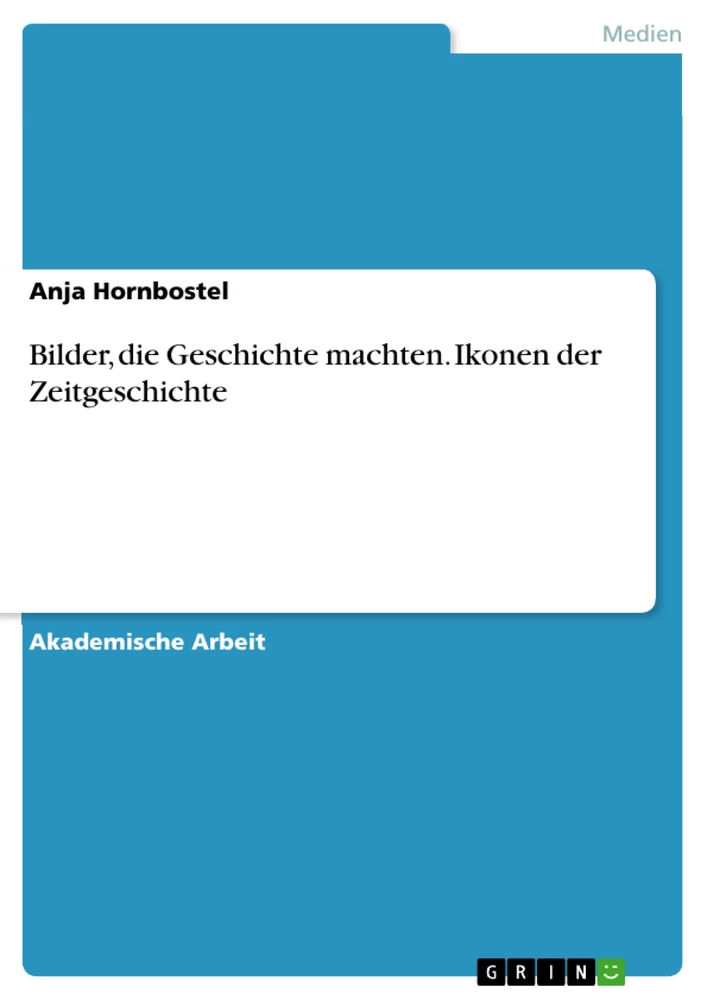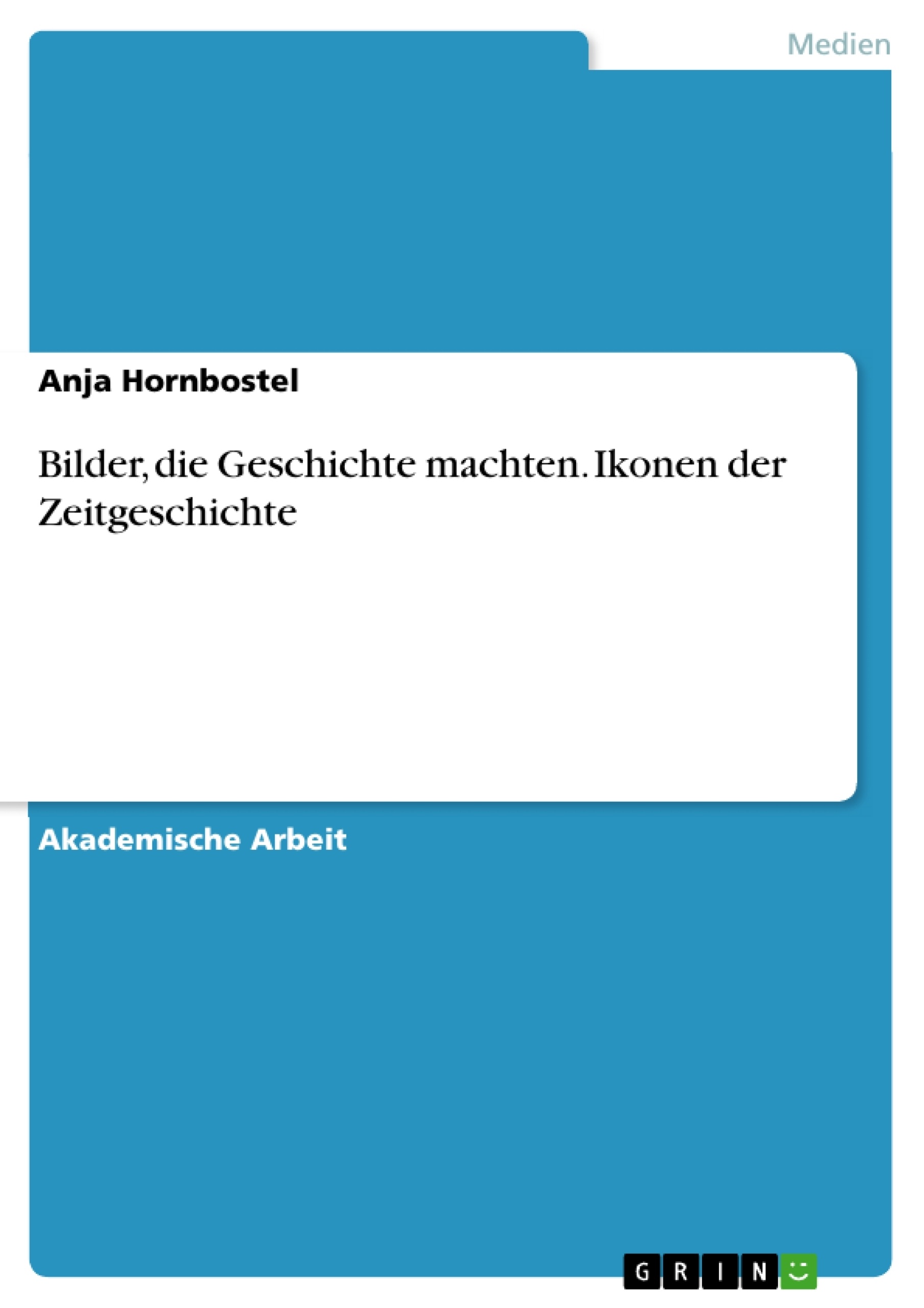Oft reichen ein paar Worte, um die Vorstellung der Menschen anzukurbeln und ein Bild in unser Vorstellungsvermögen zu rufen. Nach diesem Prinzip präsentierte das Magazin ‚STERN‘ vor mehr als zehn Jahren die Fotoausstellung ‚Pictures in our Minds‘. Das Besondere daran war, dass die Ausstellung der 40 bekanntesten Pressefotos keine Fotos zeigte. Anstelle der Bilder, wurden nur die Textbeschreibungen gezeigt. Dennoch: Jeder Besucher konnte die Bilder – dank Vorstellungskraft und Erinnerungsvermögen – ‚sehen‘. Jeder wusste – auch ohne die materielle Vorlage – welches Bild jeweils auf den Textbeschreibungen erläutert wurde.
Bilder sind mächtig. Sie überdauern Jahrhunderte und erzählen Geschichten, die längst vorüber sind. Dass unsere Wahrnehmung und unser Denken visuell bestimmt sind – spielt dem zu. Visuell wahrgenommenes wird leichter erinnert. An den Kniefall von Willy Brandt erinnern wir uns nur deshalb so gut, weil es hiervon Bilder gibt.
Aus der Masse an Bildern, die tagtäglich und weltweit erschaffen werden, stechen einige als besonders ausdrucksstark heraus. Diese Bilder gehen als Symbole ins kollektive Gedächtnis ein. Sie dienen als Repräsentanten von Ereignissen, als Darstellungen von Prozessen und Verankerungen von vielschichtigen Zusammenhängen. Dabei zeigen und schreiben sie selbst Geschichte. Brandts Kniefall ist ein gutes Beispiel dafür, dass dieses Bild – diese Bildikone – die Geschichte nicht nur darstellt, sondern nachhaltig veränderte.
Was aber macht ein Bild zur Ikone der Geschichte, zum Symbol eines historischen Moments, verankert im kollektiven Gedächtnis einer ganzen Gesellschaft? Weiterhin stellt sich die Frage, ob die ursprüngliche inhaltliche Bedeutung einer Bildikone erhalten bleibt, oder ob das Bild sich im Laufe der Zeit verselbstständigt? Können Bilder noch nach Jahrzehnten ihrem ursprünglichen Kontext zugeordnet werden? Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich die vorliegende Arbeit und soll hier Antworten liefern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Iconic Turn und Pictural Turn
- 3. Geschichte der Fotografie - die Erfindung der Fotografie als Voraussetzung für Bildikonen der Pressefotografie
- 4. Gegenstand der Arbeit
- 4.1 Definition: Bildikone
- 4.2 Bildikonen - Clusterbildung
- 5. Die Macht der Bilder
- 5.1 Geschichtliche Relevanz
- 5.2 Gesellschaftliche Relevanz - Schaffung einer gemeinsamen Identität
- 5.3 Gestik und Mimik: kulturell übergreifend und unmissverständlich? Ein gemeinsamer Kultureller Hintergrund als Voraussetzung einheitlicher Interpretation
- 5.4 Einordnung in einen Kontext
- 6. Voraussetzungen für Wahrnehmung und nachhaltige Erinnerung der Bilder
- 6.1 Vertrautes dient der Identifizierung des Gezeigten
- 6.2 Aufmerksamkeit der Zuschauer
- 6.2.1 Unerwarteter Überraschungsmoment als Aufmerksamkeitserhaschend
- 6.2.2 Bildeinsatz und Bildfunktion der Bilder begründen Erregung der Aufmerksamkeit – Einordnung in Kategorien
- 6.3 Emotionalisierung der Betrachter
- 6.4 Veröffentlichung der Bilder - Penetration und Konfrontation im Alltag
- 6.5 Selektion durch Rezipienten
- 6.6 Authentizität - Realität und Wahrheitsgehalt
- 6.6.1 Die Macht der Bilder durch Authentizität und Vermittlung der Realität
- 6.6.2 Authentizität, Realität und Wahrheit - am Beispiel Kim Phuc
- 6.7 Stilmittel der Fotografie
- 6.7.1 Bildaufbau
- 6.7.2 Personen: Mimik, Gestik
- 6.7.3 Körpersprache: Pathosformel als Interpretationsvorgabe
- 6.7.4 Pathos in Handschlag und Händedruck
- 6.8 Ökonomien der Aufmerksamkeit - Wirtschaftliche Aspekte
- 6.9 Bewegtbilder in Film und Fernsehen
- 6.10 Massenproduktion und Verbreitung - als Voraussetzung für hohen Bekanntheitsgrad
- 7. Bildikonen - Bilder die Geschichte machten
- 7.1 Der Mann im Mond
- 7.1.1 Historischer Hintergrund
- 7.1.2 Ikonisierung: Das Bild der Mondlandung und die Inszenierung der Wissenschaft
- 7.2 Der Junge von Warschau
- 7.2.1 Historischer Hintergrund
- 7.2.2 Ikonisierung: Symbol des Schreckens
- 7.3 Der Kniefall von Willy Brandt
- 7.3.1 Historischer Hintergrund
- 7.3.2 Ikonisierung: Der Kniefall - Geste der Unterwerfung
- 7.4 Der Tod des Benno Ohnesorg
- 7.4.1 Historischer Hintergrund
- 7.4.2 Ikonisierung: Symbol einer Freiheitsbewegung
- 7.5 Clinton, Rabin und Arafat – die Versöhnung
- 7.5.1 Historischer Hintergrund
- 7.5.2 Ikonisierung: Symbol des Friedens
- 7.1 Der Mann im Mond
- 8. Ungekrönte Thron-Anwärter - Bilder mit Potenzial, denen das „Gewisse Etwas“ fehlt
- 8.1 Ungebrochenes Pathos: Grundvoraussetzung für Siegesikonen
- 8.2 The Falling Man
- 8.2.1 Historischer Hintergrund
- 8.2.2 Ikonisierung: das Foto des „Falling Man“ wurde dennoch nicht zur Ikone
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, welche Faktoren ein Bild zu einer Ikone der Zeitgeschichte machen. Sie analysiert die Entstehung und Wirkung von Bildikonen, indem sie deren geschichtliche und gesellschaftliche Relevanz beleuchtet. Die Arbeit fragt nach den Voraussetzungen für die Wahrnehmung und nachhaltige Erinnerung solcher Bilder.
- Definition und Charakteristika von Bildikonen
- Die Rolle von Geschichte und Gesellschaft bei der Entstehung von Bildikonen
- Die Bedeutung von Wahrnehmung, Erinnerung und Emotionalisierung für die Ikonisierung
- Analyse ausgewählter Bildikonen und deren Ikonisierungsprozess
- Faktoren, die die nachhaltige Wirkung von Bildern beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und veranschaulicht die Macht von Bildern anhand eines Experiments und des Beispiels der Ausstellung „Pictures in our Minds“. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Faktoren, die ein Bild zu einer historischen Ikone machen, und skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit. Die Einleitung betont die nachhaltige Wirkung von Bildern auf das kollektive Gedächtnis und unser Verständnis von Geschichte.
2. Iconic Turn und Pictural Turn: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel hin zu einer visuell geprägten Gesellschaft, den „Iconic Turn“ und „Pictural Turn“. Es beschreibt die zunehmende Bedeutung von Bildern in allen Bereichen des Lebens und argumentiert, dass Bilder nicht mehr nur als Illustrationen, sondern als eigenständige Zeichensysteme fungieren. Der Fokus liegt auf der qualitativen Auswahl von Bildern aus der Flut visueller Informationen, die zu Bildikonen werden. Die Entstehung von Bildikonen wird im Kontext von gesellschaftlichen Umbrüchen und Konflikten, wie Kriegen, situiert.
4. Gegenstand der Arbeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Bildikone“ und untersucht die Clusterbildung von Bildern, die gemeinsame Merkmale aufweisen und somit als Gruppe von Ikonen betrachtet werden können. Es legt die methodologische Grundlage für die weitere Analyse und die Auswahl von Fallbeispielen.
5. Die Macht der Bilder: Dieses Kapitel analysiert die Macht von Bildern, sowohl in geschichtlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Es untersucht die Rolle von Gestik und Mimik in der Bildinterpretation und betont die Bedeutung des Kontextes für das Verständnis der Bilder. Der Schwerpunkt liegt auf der Fähigkeit von Bildern, eine gemeinsame Identität zu schaffen und kollektive Erinnerungen zu formen.
6. Voraussetzungen für Wahrnehmung und nachhaltige Erinnerung der Bilder: Dieses Kapitel untersucht die Faktoren, die zur Wahrnehmung und nachhaltigen Erinnerung von Bildern beitragen. Es analysiert die Rolle von Vertrautheit, Aufmerksamkeit (inklusive unerwarteter Momente), Emotionalisierung, Veröffentlichung, Selektion durch Rezipienten und Authentizität. Zusätzlich werden stilistische Mittel der Fotografie (Bildaufbau, Personen, Körpersprache, Pathos) und ökonomische Aspekte der Aufmerksamkeit sowie die Bedeutung der Massenproduktion und Verbreitung für die nachhaltige Wirkung von Bildern erörtert.
Schlüsselwörter
Bildikonen, Iconic Turn, Pictural Turn, Pressefotografie, visuelle Kommunikation, Geschichte, Gesellschaft, Wahrnehmung, Erinnerung, Emotionalisierung, Authentizität, Ikonisierung, kollektives Gedächtnis, Macht der Bilder, Stilmittel der Fotografie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Bildikonen der Zeitgeschichte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Faktoren, die ein Bild zu einer Ikone der Zeitgeschichte machen. Sie analysiert die Entstehung und Wirkung von Bildikonen, beleuchtet deren geschichtliche und gesellschaftliche Relevanz und fragt nach den Voraussetzungen für deren Wahrnehmung und nachhaltige Erinnerung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika von Bildikonen, die Rolle von Geschichte und Gesellschaft bei deren Entstehung, die Bedeutung von Wahrnehmung, Erinnerung und Emotionalisierung für die Ikonisierung, eine Analyse ausgewählter Bildikonen und deren Ikonisierungsprozess sowie die Faktoren, die die nachhaltige Wirkung von Bildern beeinflussen. Konzepte wie der "Iconic Turn" und "Pictural Turn" werden ebenso diskutiert wie die Macht der Bilder, Stilmittel der Fotografie, ökonomische Aspekte der Aufmerksamkeit und die Rolle von Massenproduktion und Verbreitung.
Welche Bildikonen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Bildikonen, darunter: "Der Mann im Mond", "Der Junge von Warschau", "Der Kniefall von Willy Brandt", "Der Tod des Benno Ohnesorg", "Clinton, Rabin und Arafat – die Versöhnung", und "The Falling Man" (als Beispiel eines Bildes mit Potenzial, das keine Ikone wurde).
Wie werden die Bildikonen analysiert?
Die Analyse der Bildikonen umfasst den historischen Hintergrund, den Ikonisierungsprozess, die Bedeutung der Bilder im gesellschaftlichen Kontext und die Faktoren, die zu ihrer nachhaltigen Wirkung beigetragen haben (oder eben nicht).
Welche Rolle spielen Geschichte und Gesellschaft?
Geschichte und Gesellschaft spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Wirkung von Bildikonen. Gesellschaftliche Umbrüche und Konflikte bilden oft den Kontext, in dem Bildikonen entstehen. Die Arbeit untersucht, wie Bilder eine gemeinsame Identität schaffen und kollektive Erinnerungen formen.
Welche Rolle spielen Wahrnehmung und Erinnerung?
Wahrnehmung und Erinnerung sind entscheidend für die Ikonisierung eines Bildes. Die Arbeit analysiert Faktoren wie Vertrautheit, Aufmerksamkeit (inklusive unerwarteter Momente), Emotionalisierung, Veröffentlichung, Selektion durch Rezipienten und Authentizität als Voraussetzungen für die nachhaltige Erinnerung an Bilder. Stilistische Mittel der Fotografie spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Bedeutung hat Authentizität?
Authentizität, Realität und Wahrheitsgehalt eines Bildes beeinflussen dessen Macht und Wirkung. Die Arbeit untersucht, wie Authentizität zur Vermittlung von Realität beiträgt und am Beispiel von Kim Phuc illustriert, wie die Authentizität eines Bildes dessen Ikonisierung prägt.
Welche Rolle spielen Stilmittel der Fotografie?
Die Arbeit untersucht verschiedene Stilmittel der Fotografie, wie Bildaufbau, Mimik und Gestik der abgebildeten Personen, Körpersprache und den Einsatz von Pathosformeln, um die Wirkung von Bildern zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildikonen, Iconic Turn, Pictural Turn, Pressefotografie, visuelle Kommunikation, Geschichte, Gesellschaft, Wahrnehmung, Erinnerung, Emotionalisierung, Authentizität, Ikonisierung, kollektives Gedächtnis, Macht der Bilder, Stilmittel der Fotografie.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel, die die Einleitung, den Iconic und Pictural Turn, die Definition von Bildikonen, die Macht der Bilder, die Voraussetzungen für Wahrnehmung und Erinnerung, Analysen ausgewählter Bildikonen und Bilder mit Potenzial, aber ohne Ikonenstatus, umfassen. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und eine Auflistung der Schlüsselwörter.
- Citar trabajo
- Anja Hornbostel (Autor), 2011, Bilder, die Geschichte machten. Ikonen der Zeitgeschichte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384930