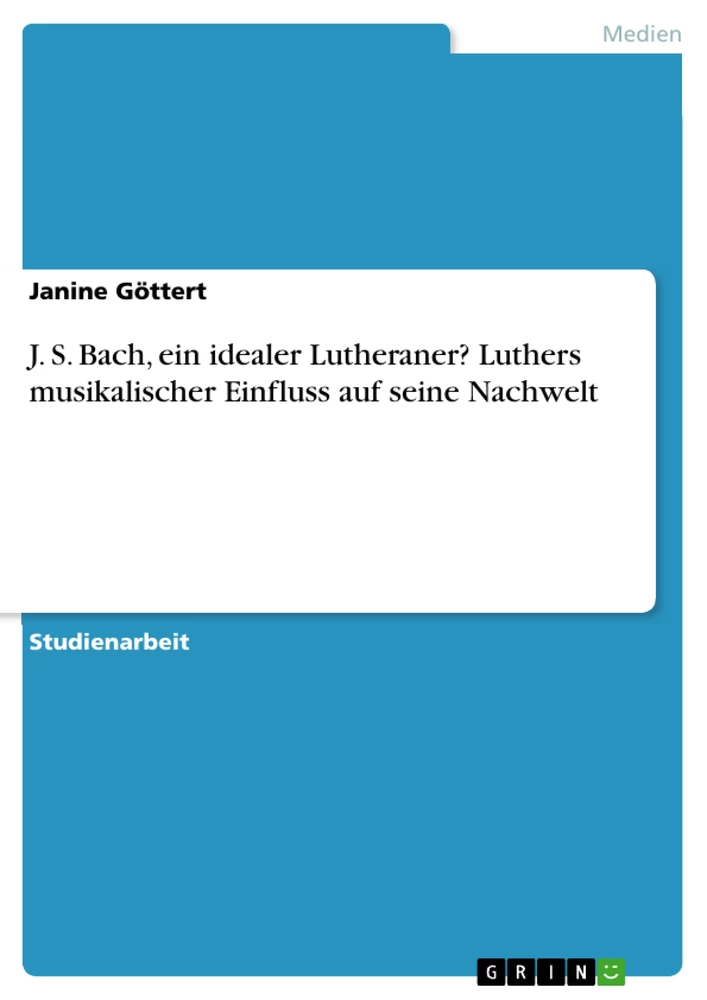Anlässlich des diesjährigen Lutherjubiläums, 500 Jahre Reformation, soll in der vorliegenden Hausarbeit der Frage auf den Grund gegangen werden, in wieweit Bach als ein Glaubensträger im lutherischen Sinne gesehen werden kann.
Bei der Beantwortung dieser Fragestellung muss zunächst Luthers Wertschätzung der Musik genauer betrachtet werden. Welche sind die musikalischen und theologischen Grundlagen Luthers? Welchen Zweck hat die Musik für ihn? Was soll mit der Musik zum Ausdruck gebracht werden? Wie wurde das reine Evangelium in der Musik verarbeitet? Beispielhaft soll Luthers Lied Ein neues Lied wir heben an im Vordergrund stehen, um die genannten Fragen zu beantworten.
Luther hatte nicht nur Einfluss auf die theologischen Aspekte in den Glaubensansichten vieler, sondern auch einen großen musikalischen Einfluss mit seinen Liedern auf seine Nachwelt. Der musikalische Aspekt soll neben Bach anhand von Kirchenlieddichtern wie Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude und Paul Gerhardt thematisiert werden, da diese sehr bekannten Kirchenlieddichter die Musik und Theologie Luthers sehr wertschätzten. Wie wurden Luthers Lieder und seine theologischen Grundsätze bei ihnen verarbeitet und zu welchem Zweck schrieben sie Kirchenmusik?
Um die These, dass Bach ein idealer Lutheraner sei, bestätigen zu können, muss der Begriff zunächst einmal mit Hilfe der vorherigen Ergebnisse definiert werden. Es soll sich weiterhin der Frage gewidmet werden, welchen Einflüssen Bach unterlag und welche Bedeutung die Musik Luthers für ihn persönlich hatte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1. Luthers Wertschätzung der Musik
- 2.2. Der Ausdruck des Textes durch die Musik
- 2.3. Luthers musikalischen Einflüsse
- 2.3.1. Definitionsversuch: Was ist ein idealer Lutheraner?
- 2.4. J. S. Bach in der lutherischen Tradition
- 3. Bach, ein idealer Lutheraner
- 4. Literaturverzeichnis
- 5. Anhang
- 5.1. Faksimile Ein neues Lied wir heben an...
- 5.2. Text: Ein feste Burg ist unser Gott (BWV 80)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht, inwiefern Johann Sebastian Bach als ein Glaubensträger im lutherischen Sinne betrachtet werden kann. Sie setzt sich mit Luthers Wertschätzung der Musik auseinander und analysiert seine musikalischen und theologischen Grundlagen. Dabei wird insbesondere das Kirchenlied „Ein neues Lied wir heben an“ von Luther betrachtet. Des Weiteren werden die musikalischen Einflüsse Luthers auf seine Nachwelt, insbesondere auf Bach, analysiert.
- Luthers Wertschätzung der Musik und seine theologischen Grundlagen
- Die Rolle der Musik in der Vermittlung des Evangeliums nach Luther
- Die Bedeutung der Musik für die Verbreitung des lutherischen Glaubens
- Der Einfluss Luthers auf die Kirchenmusik seiner Nachwelt
- Die Frage nach Bachs Rolle als „idealer Lutheraner“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Martin Luthers Kirchenliedern für Johann Sebastian Bach und stellt die These auf, dass Bach das Evangelium durch seine Kompositionen vermitteln wollte. Der Hauptteil untersucht zunächst Luthers Wertschätzung der Musik, seine theologischen Grundlagen und die Rolle der Musik in der Verkündigung des Evangeliums. Dabei wird auch die Bedeutung der Kirchenlieder Luthers für seine Nachwelt beleuchtet. Im Folgenden werden die musikalischen Einflüsse Luthers auf Kirchenlieddichter wie Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude und Paul Gerhardt analysiert. Schließlich wird die Frage gestellt, inwiefern Bach als ein Glaubensträger im lutherischen Sinne betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Kirchenlied, Evangelium, lutherische Tradition, Kirchenmusik, Johann Sebastian Bach, Glaubensträger, theologische Grundlagen, musikalischer Einfluss.
Häufig gestellte Fragen
War Johann Sebastian Bach ein "idealer Lutheraner"?
Die Arbeit untersucht diese These, indem sie Bachs Leben und Werk vor dem Hintergrund von Luthers theologischen und musikalischen Grundsätzen analysiert.
Welchen Stellenwert hatte Musik für Martin Luther?
Für Luther war Musik ein Geschenk Gottes und ein zentrales Mittel zur Verkündigung des „reinen Evangeliums“ und zur Stärkung des Glaubens.
Welchen Einfluss hatte Luther auf Komponisten nach ihm?
Luthers Kirchenlieder prägten die protestantische Kirchenmusik maßgeblich und beeinflussten Komponisten wie Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude und Paul Gerhardt.
Welches Lied Luthers wird in der Arbeit beispielhaft analysiert?
Luthers Lied „Ein neues Lied wir heben an“ dient als Beispiel für die Verarbeitung theologischer Inhalte in der Musik.
Welche Bedeutung hatte Luthers Theologie für Bach persönlich?
Bach sah sich in der lutherischen Tradition und nutzte seine Kompositionen (wie die Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“), um den christlichen Glauben musikalisch auszudrücken.
- Quote paper
- Janine Göttert (Author), 2017, J. S. Bach, ein idealer Lutheraner? Luthers musikalischer Einfluss auf seine Nachwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384942