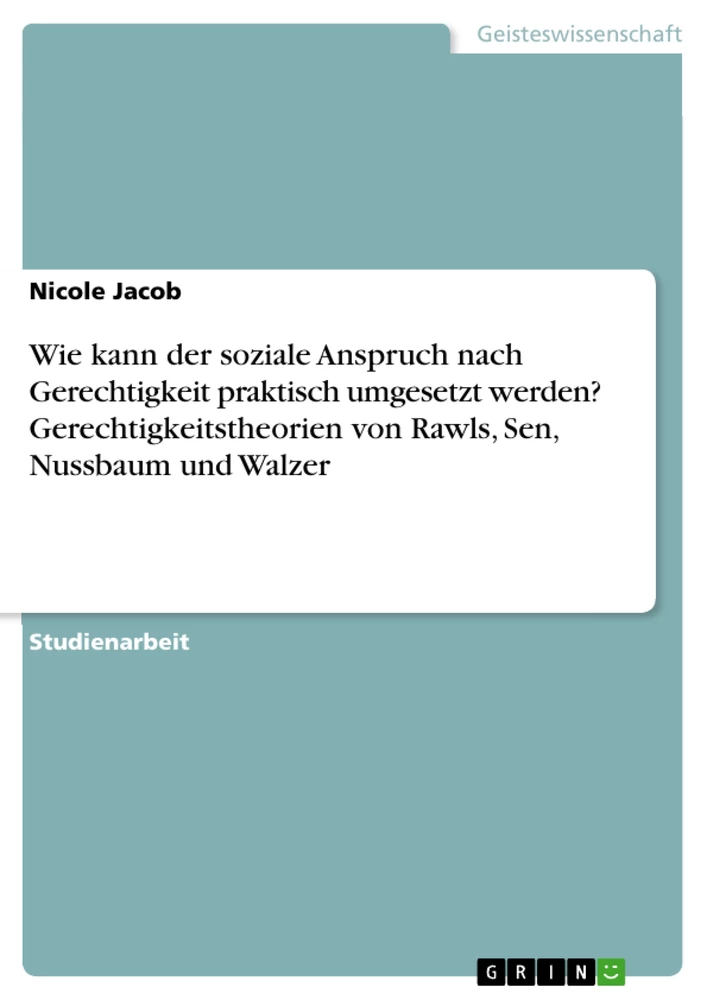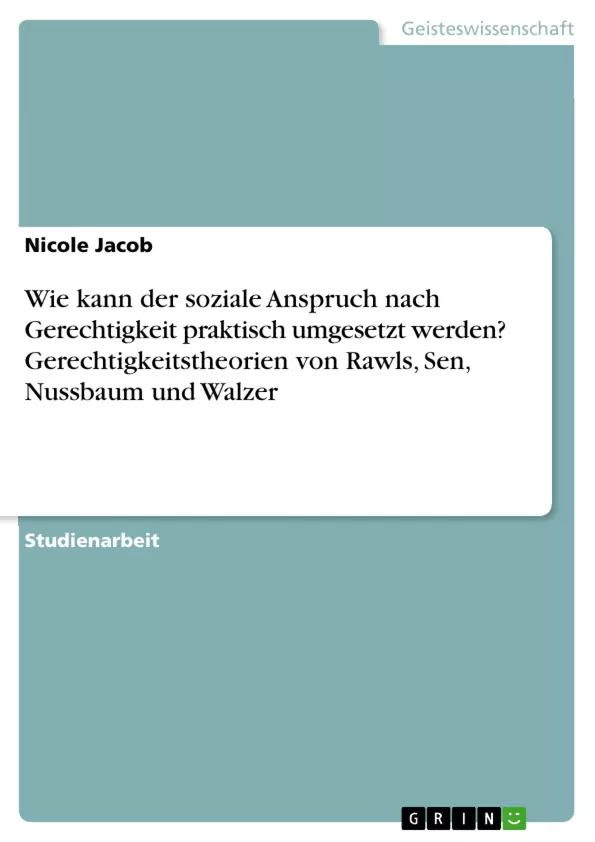Seit Jahrtausenden beschäftigt sich die Menschheit mit der Auseinandersetzung was Gerechtigkeit bedeutet. Die bekannten großen Philosophen der Antike beschäftigten sich mit der Thematik.
Die vorliegende Hausarbeit, die sich mit vier Gerechtigkeitstheorien befasst, wird im Rahmen des Studiums der Soziale Arbeit verfasst. Gerade in der Soziale Arbeit zählt die Förderung sozialer Gerechtigkeit, in Bezug auf die Gesellschaft im Allgemeinen sowie auf Klienten, als professionelle Verpflichtung.
Folglich werden die Hauptthesen der Theorien in sinnvoller Reihenfolge vorgestellt. Als erstes wird das Postulat von John Rawls beleuchtet, da dieser ein Konzept vorlegt, worauf sich die nachfolgenden Autoren beziehen. Amartya Sen hat einen Ansatz zu Verwirklichungschancen verfasst, der von Martha Nussbaum verändert bzw. erweitert wurde. Im Anschluss wird der Entwurf von Michael Walzer vorgestellt. Da diese Ansätze in der Literatur oftmals verglichen werden, werden die Bezüge- sprich Ähnlichkeiten und Unterschiede in den jeweiligen Unterpunkten mit abgehandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien der Gerechtigkeit
- John Rawls
- Amartya Sen und der Ansatz der Verwirklichungsmöglichkeiten
- Martha Nussbaum
- Michael Walzer
- Stellungnahme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Gerechtigkeit und untersucht vier verschiedene Theorien, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Hauptthesen dieser Theorien zu präsentieren und ihre Relevanz für die Soziale Arbeit zu beleuchten.
- Gerechtigkeit als Fairness (John Rawls)
- Verwirklichungschancen und menschliche Entwicklung (Amartya Sen)
- Fähigkeiten und soziale Gerechtigkeit (Martha Nussbaum)
- Verteilungsmodelle und soziale Strukturen (Michael Walzer)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema Gerechtigkeit ein und beleuchtet die historische Bedeutung des Begriffs. Sie stellt die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit dar und erläutert den Aufbau der Hausarbeit.
2.1 John Rawls
Dieses Kapitel präsentiert die Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. Es werden die beiden Prinzipien der Gerechtigkeit (Gleichheit der Grundrechte und Gerechte Verteilung) sowie das Konzept des „Schleiers der Unwissenheit“ erläutert.
2.2 Amartya Sen und der Ansatz der Verwirklichungsmöglichkeiten
In diesem Kapitel wird die Theorie von Amartya Sen vorgestellt, die sich mit der Bedeutung von Verwirklichungschancen für soziale Gerechtigkeit befasst. Es werden die Unterschiede zu Rawls' Ansatz aufgezeigt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht John Rawls unter „Gerechtigkeit als Fairness“?
Rawls postuliert, dass Gerechtigkeit durch faire Ausgangsbedingungen entsteht, symbolisiert durch den „Schleier der Unwissenheit“, bei dem niemand seine spätere soziale Stellung kennt.
Was ist der „Capability Approach“ von Amartya Sen?
Sen fokussiert auf die tatsächlichen Verwirklichungschancen eines Menschen, also die Freiheit und Fähigkeit, ein Leben zu führen, das man aus guten Gründen schätzt.
Wie erweitert Martha Nussbaum den Ansatz von Sen?
Nussbaum konkretisiert Sens Ansatz durch eine Liste von zehn zentralen menschlichen Fähigkeiten, die für ein würdevolles Leben und soziale Gerechtigkeit garantiert sein müssen.
Welchen Ansatz verfolgt Michael Walzer?
Walzer vertritt das Konzept der „sphärischen Gerechtigkeit“, bei dem verschiedene soziale Güter nach unterschiedlichen Maßstäben verteilt werden sollten, um Dominanz zu verhindern.
Warum sind diese Theorien für die Soziale Arbeit relevant?
Gerechtigkeitstheorien bieten die ethische Grundlage für die professionelle Verpflichtung der Sozialen Arbeit, soziale Gerechtigkeit zu fördern und Klienten zur Teilhabe zu befähigen.
- Arbeit zitieren
- Nicole Jacob (Autor:in), 2015, Wie kann der soziale Anspruch nach Gerechtigkeit praktisch umgesetzt werden? Gerechtigkeitstheorien von Rawls, Sen, Nussbaum und Walzer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385066