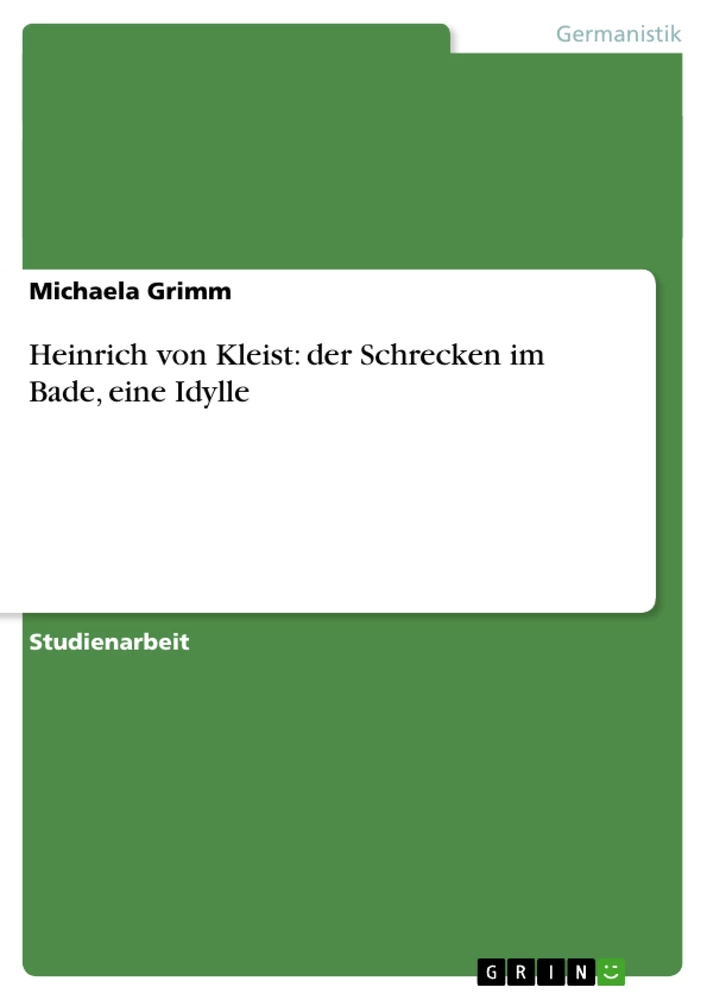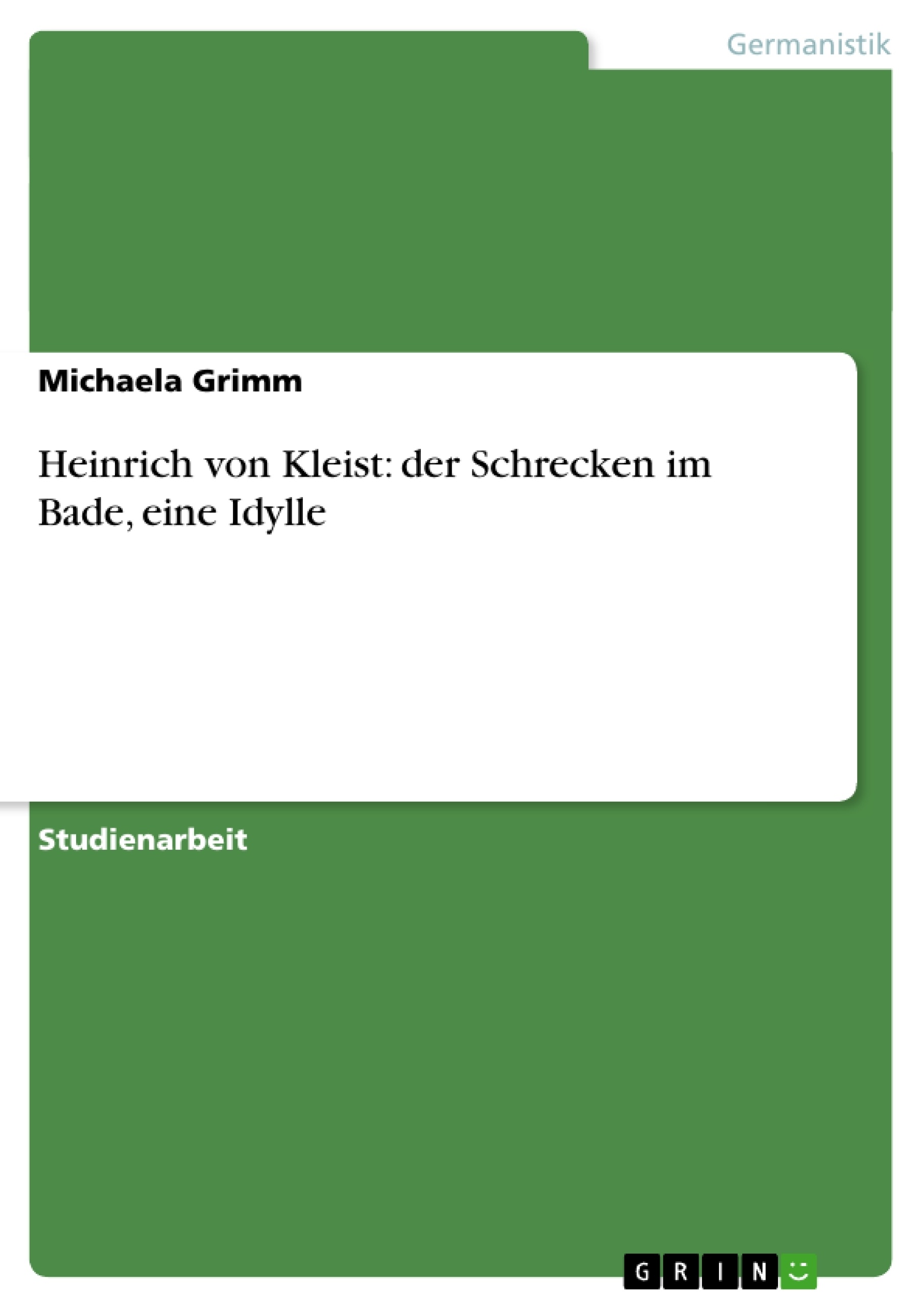Kleist, ein viel diskutierter, jedoch auch oft in Frage gestellter Autor. Er war bei seinen Zeitgenossen gleichermaßen beliebt wie verhasst. Doch wer war er, und was hat ihn bewegt, ein solches Stück wie seine einzige Idylle zu schreiben? Dies sind alles Fragen, die im Laufe dieser Arbeit geklärt werden sollen. Beginnen möchte ich mit einem kurzen Biographie- und Zeitgeschichtsausschnitt, um die damalig vorherrschende Situation darzustellen und somit vielleicht ein wenig Licht in das Dunkel von Kleists Beweggründen zu bringen. Kleist stieß auf Verständnislosigkeit bei großen Dichtern wie z. B. Goethe, da er keiner der damaligen Dichterschulen wie Klassik oder Romantik zuzuordnen war. Man begründete dies damit, das manche seiner Werke seelische Tiefen aufwühlten, die erst ein Jahrhundert später durch Sigmund Freud erforscht wurden. Sein Militärdienst erschien ihm als“ lebendiges Monument der Tyrannei“. 1801 geriet er in eine tiefe innere Krise: er sah in der Anstellung beim Staat keinen Sinn und sagte: „Ich soll tun was der Staat von mir verlangt, und doch soll ich nicht untersuchen, ob das, was er von mir verlangt, gut ist. Zu seinem unbekannten Zwecken soll ich bloßes Werkzeug sein- ich kann es nicht ( Brief an seine Braut Wilhelmine von Zenge). Hinzu, dass das Studium Kants ihn am Sinn der Wissenschaften und der Suche nach Wahrheit überhaupt verzweifeln ließ. Die zeitgenössische Philosophie schenkte der Literatur eine neue, tiefere Auffassung von der Bedeutung der Persönlichkeit, nachdem sie das Subjekt in den Mittelpunkt der Erkenntnis gerückt hatte. Sie vermittelte einen neuen Begriff sittlicher Ordnung, der auf der Einsicht in das Wesen der Sittlichkeit, frei vom Zwang vorgegebener Gebote ruhte. „ Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte“ nach Kant. So wurde der Idealismus zum neuen Eckstein des Humanismus. Er flüchtete daraufhin nach Paris. Wenig später wollte er sich seine eigene Idylle als Bauer aufbauen, was jedoch dazu führte, dass seine Verlobung aufgrund des unstandesgemäßen Lebenswandels in die Brüche ging. Seine Ziele hatten sich geändert und er beschloss nun Dichter zu werden.Geßner, Zoschke und und Wieland, seine Berner Freunde unterstützten ihn darin. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Der oft kritisierte jedoch auch begeisternde Autor Kleist
- Hauptteil:
- I, Die Idylle „Der Schrecken im Bade“
- A, Die Entstehung
- B, Der Inhalt
- C, Eine typische Idylle?
- II, Die Anregungen und ihre Funktionalität für Kleists Idylle
- A, Ovids Diana-Aktäon-Mythos
- B, Die Bibelstelle: Susanna im Bade
- C, Kleists eigene Erfahrung
- I, Die Idylle „Der Schrecken im Bade“
- Schluss: Die Bewertung der Idylle für die heutige Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich von Kleists einzige als Idylle bezeichnete Dichtung, „Der Schrecken im Bade“. Ziel ist es, Kleists Werk im Kontext seiner Biografie und der zeitgenössischen Literatur zu verstehen und seine Bedeutung für die heutige Zeit zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Entstehung, den Inhalt und die literarischen Bezüge der Idylle.
- Kleists Biografie und seine literarische Position
- Die literarischen Vorbilder und ihre Funktion in "Der Schrecken im Bade"
- Die Darstellung von Natur und Gesellschaft in der Idylle
- Das Thema der Sexualität und Identität
- Die Rezeption der Idylle in der Literaturwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Der oft kritisierte jedoch auch begeisternde Autor Kleist: Die Einleitung stellt Heinrich von Kleist als einen viel diskutierten und umstrittenen Autor vor, der sowohl Anerkennung als auch Ablehnung erfuhr. Sie kündigt die Klärung von Fragen zu Kleists Leben und den Beweggründen für das Schreiben seiner Idylle an. Die Einleitung skizziert kurz Kleists Biografie und den historischen Kontext, um seine Motivationen besser zu verstehen. Kleists Unzufriedenheit mit seinem Dienst beim Staat, seine Krise nach dem Studium Kants und seine gescheiterten Versuche, eine ländliche Idylle zu verwirklichen, werden als wichtige Faktoren für sein Schaffen dargestellt. Die Einleitung betont Kleists Unangepasstheit an die etablierten literarischen Schulen seiner Zeit und sein Auseinandersetzen mit existenziellen Fragen, die erst später von der Psychoanalyse aufgegriffen wurden.
I, Die Idylle „Der Schrecken im Bade“: Die Entstehung: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung von Kleists einziger selbst als Idylle bezeichneter Dichtung, „Der Schrecken im Bade“. Es wird die Entstehungszeit im Kontext von Kleists anderen Werken wie „Penthesilea“ und „Das Käthchen von Heilbronn“ eingeordnet und die negative Resonanz bei Zeitgenossen diskutiert. Die Veröffentlichung in der Zeitschrift „Der Phöbus“ wird detailliert beschrieben, ebenso Kleists eigene Absichten und die mögliche Intention, die hohe Pariser Gesellschaft zu kritisieren, welche die Natur nur oberflächlich genießt. Der eigene gescheiterte Versuch Kleists, eine ländliche Idylle zu schaffen, wird als Hintergrund erläutert. Das Kapitel spekuliert über die möglichen Bedeutungen des Werkes, darunter die Interpretation als Rat für Kleists Schwester und die Möglichkeit, dass es autobiografische Elemente bezüglich Kleists eigenen Sexualitätsfindungsprozesses enthält.
II, Die Anregungen und ihre Funktionalität für Kleists Idylle: Dieser Abschnitt untersucht die literarischen und mythischen Vorbilder, die Kleist für seine Idylle nutzte. Es wird detailliert auf Ovids Diana-Aktäon-Mythos und die biblische Geschichte von Susanna im Bade eingegangen, um die Transformation und Adaption dieser Stoffe in Kleists Werk zu analysieren. Die eigene Erfahrung Kleists und sein persönlicher Bezug zu den behandelten Themen werden ebenfalls beleuchtet, um das Verständnis für seine Motivationen zu vertiefen und die Verbindung zwischen seinem Leben und seinem literarischen Schaffen aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
Heinrich von Kleist, Idylle, „Der Schrecken im Bade“, Diana-Aktäon-Mythos, Susanna im Bade, Sexualität, Identität, Natur, Gesellschaft, Romantik, Klassik, Biographie, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich von Kleists "Der Schrecken im Bade"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Heinrich von Kleists einzige als Idylle bezeichnete Dichtung, "Der Schrecken im Bade". Sie untersucht die Entstehung, den Inhalt und die literarischen Bezüge der Idylle im Kontext von Kleists Biografie und der zeitgenössischen Literatur. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Werkes für die heutige Zeit und untersucht Themen wie Kleists literarische Position, seine literarischen Vorbilder, die Darstellung von Natur und Gesellschaft, Sexualität und Identität sowie die Rezeption der Idylle in der Literaturwissenschaft.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Kleists Biografie und seine literarische Position; die literarischen Vorbilder und ihre Funktion in "Der Schrecken im Bade"; die Darstellung von Natur und Gesellschaft in der Idylle; das Thema der Sexualität und Identität; die Rezeption der Idylle in der Literaturwissenschaft. Konkret werden Ovids Diana-Aktäon-Mythos und die biblische Geschichte von Susanna im Bade als literarische Vorbilder analysiert und deren Einfluss auf Kleists Werk untersucht. Die Arbeit beleuchtet auch die möglichen autobiografischen Elemente in der Idylle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Die Einleitung stellt Heinrich von Kleist als Autor vor und skizziert den Kontext seines Lebens und Schaffens. Der Hauptteil untersucht die Idylle selbst, ihre Entstehung und ihre literarischen Vorbilder (Ovids Diana-Aktäon-Mythos und die biblische Geschichte von Susanna im Bade). Es wird auch Kleists eigene Erfahrung und deren Einfluss auf das Werk beleuchtet. Der Schluss bewertet die Bedeutung der Idylle für die heutige Zeit.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit beinhaltet folgende Kapitel: Eine Einleitung, die Kleist als Autor vorstellt und die Arbeit einleitet. Kapitel I, "Die Idylle „Der Schrecken im Bade“: Die Entstehung", untersucht die Entstehung der Idylle im Kontext von Kleists Leben und Werk und diskutiert die Rezeption des Werkes. Kapitel II, "Die Anregungen und ihre Funktionalität für Kleists Idylle", analysiert die literarischen Vorbilder (Ovid, Bibel) und deren Einfluss auf Kleists Werk. Der Schluss bewertet die Idylle im Hinblick auf ihre heutige Relevanz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die die Arbeit beschreiben, sind: Heinrich von Kleist, Idylle, "Der Schrecken im Bade", Diana-Aktäon-Mythos, Susanna im Bade, Sexualität, Identität, Natur, Gesellschaft, Romantik, Klassik, Biographie, Literaturwissenschaft.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Kleists "Der Schrecken im Bade" im Kontext seiner Biografie und der zeitgenössischen Literatur zu verstehen und seine Bedeutung für die heutige Zeit zu beleuchten. Es geht um die Analyse der Entstehung, des Inhalts und der literarischen Bezüge der Idylle.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Leser gedacht, die sich für Heinrich von Kleist, seine Werke und die Literatur der Romantik interessieren. Sie eignet sich insbesondere für Studierende der Literaturwissenschaft und alle, die sich mit den Themen Sexualität, Identität, Natur und Gesellschaft in der Literatur auseinandersetzen möchten.
- Citar trabajo
- Michaela Grimm (Autor), 2004, Heinrich von Kleist: der Schrecken im Bade, eine Idylle, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38527