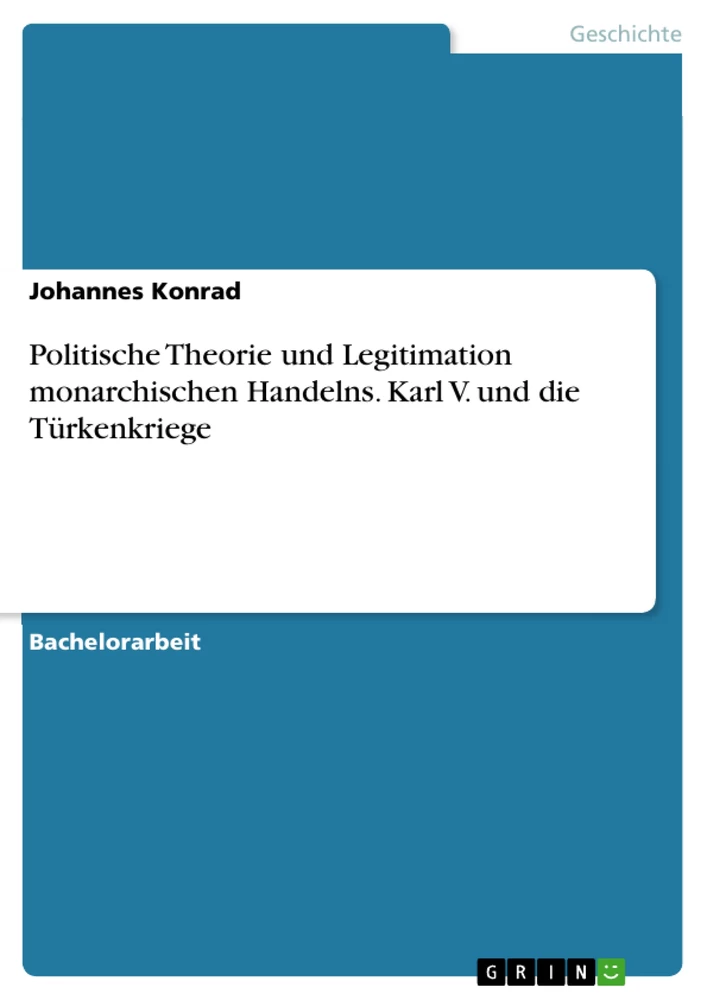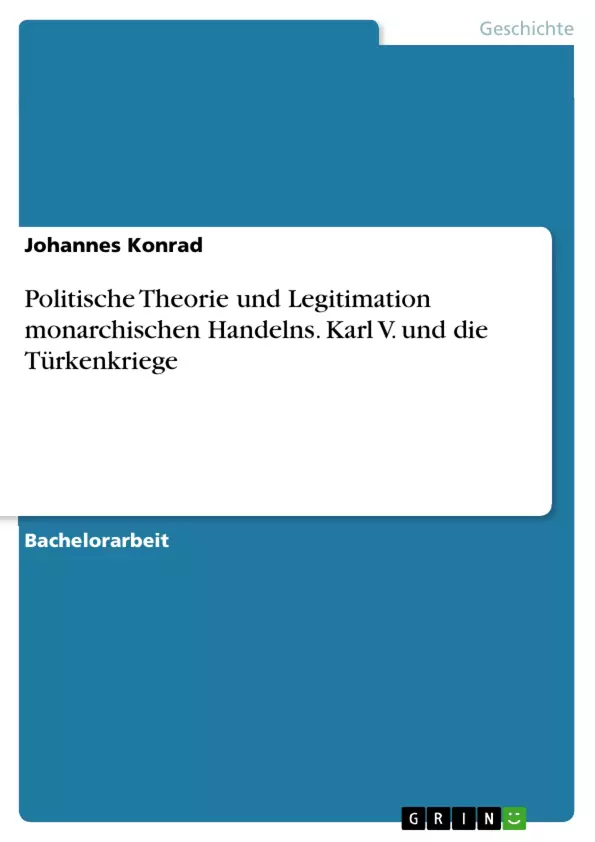Die Renaissance wird oft wahrgenommen als eine Zeitspanne des Aufbruchs im Zeichen der Emanzipation des Individuums. Die anthropozentrische Philosophie des Humanismus und der Anfang moderner Staatlichkeit im Sinne der Volkssouveränität, gelten dabei als Ecksteine der frühen Moderne. Diese Fortschrittsnarrative dominieren v.a. die populärwissenschaftliche Deutung. Ihnen steht in der historischen Forschung eine Interpretationsgeschichte gegenüber, welche die Renaissance als Krisenepoche betrachtet.
Die Grundlage für diese Krise sieht Jacob Burckhardt in der Erosion des Kaisertums und Papsttums, seit dem 14. Jahrhundert. Während die Kaiser zu keiner eigenständigen Italienpolitik mehr fähig waren, hatte das Papsttum durch seine Verwicklung in die verschiedenen politischen Konflikte an Glaubwürdigkeit verloren. Der Verfall dieser Instanzen führte nach Burckhard zu einem Legitimitätsverlust der dynastischen Feudalherrschaften. In dieses Vakuum traten nun die klassischen Renaissancefürsten als neuer Fürstentypus, zu denen er auch Karl V. zählt. Da dieser seine Herrschaft aber betont traditionell verstand, war der Charakter derselben stets umstritten. Gerade in der deutschen Historiographie, wie Arno Strohmeyer trefflich darstellt, oszillierte das Bild Karls V. zwischen Anachronismus und Modernismus. So ordnete Peter Rassow Karls Kaiseridee ganz dem Mittelalter zu, und grenzt sie von den entstehenden Nationalstaaten ab. Dagegen sieht Karl Brandi den dynastischen Gedanken des Kaisers als dominant an. In Kombination mit der universalen Kaiseridee habe dieser den Grundstein für den späteren Absolutismus gelegt, sodass er hier bereits ein Konzept von Staatsräson ausmacht. Johannes Burckhardt identifizierte unter Karl V. ebenso einen Staatsbildungsprozess, nur eben nicht auf nationaler Ebene. Zum ideengeschichtlichen Hintergrund der Herrschaftsidee Karls V. sind die Forschungen von Franz Bosbach und Hans-Joachim König wegweisend.
Von diesen Studien ausgehend lässt sich mit Rückblick auf Karl Brandi, die Universalmonarchie Karls V. als eine „alternative Staatsräson“ auf methanationaler Ebene verstehen. Als die Staatsräson eines gescheiterten Staatsbildungsprojektes. Nimmt man diese Prämisse an, so stellt sich die Frage ob hier auch Züge der Staatsräson zu tragen kommen, wie sie Friedrich Meinecke auf nationaler Ebene, beginnend mit Machiavelli, beschreibt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Politische Theorie des Humanismus
- 1. Erasmus von Rotterdam
- 1.1. Harmonie und Krieg
- 1.2. Respublica Christiana
- 1.3. Monarchisches Handeln
- 1.4. Gerechter Krieg und Türkenkrieg
- 2. Niccolò Machiavelli
- 2.1. Virtù und Fortuna
- 2.2. Der Monarch im Gemeinwesen
- 2.3. Monarchisches Handeln
- III. Erasmus und Machiavelli als Autoren der Staatsräson
- IV. Die Türkenkriege als Betätigungsfeld der Universalmonarchie
- 1. Verteidigung des Orbis Christianus
- 2. Behauptung auf dem europäischen Schauplatz
- 3. Verteidigung des Glaubens
- V. Fazit
- VI. Quellen- und Literaturverzeichnis
- 1. Quellen
- 2. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der politischen Theorie und Legitimation des monarchischen Handelns von Karl V. im Kontext der Türkenkriege. Sie analysiert den Einfluss des Humanismus, insbesondere die Schriften von Erasmus von Rotterdam und Niccolò Machiavelli, auf die Herrschaftsauffassung des Kaisers und die Legitimierung seiner Politik gegenüber der Osmanischen Bedrohung.
- Analyse der politischen Theorie des Humanismus im 16. Jahrhundert
- Untersuchung des Einflusses von Erasmus und Machiavelli auf die Staatsräson Karls V.
- Bedeutung der Türkenkriege für die Legitimation der Universalmonarchie
- Der Konflikt zwischen traditioneller dynastischer Herrschaft und modernen Staatsbildungsprozessen
- Die Rolle der Propaganda und Ideologie im Kontext der Universalmonarchie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Renaissance und die Rolle des Kaisertums in dieser Zeit. Im zweiten Kapitel wird die politische Theorie des Humanismus anhand der Schriften von Erasmus von Rotterdam und Niccolò Machiavelli analysiert. Dabei werden sowohl die Vorstellungen von Harmonie und Krieg als auch die Konzepte von Respublica Christiana, Virtù und Fortuna sowie die Rolle des Monarchen im Gemeinwesen beleuchtet.
Kapitel III befasst sich mit der Frage, inwieweit Erasmus und Machiavelli als Autoren der Staatsräson betrachtet werden können. Im vierten Kapitel werden die Türkenkriege als Betätigungsfeld der Universalmonarchie Karls V. untersucht. Dabei wird die Rolle des Kaisers bei der Verteidigung des Orbis Christianus, seiner Positionierung auf dem europäischen Schauplatz und seiner Verteidigung des Glaubens herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen wie: Humanismus, Staatsräson, Universalmonarchie, Türkenkriege, Karl V., Erasmus von Rotterdam, Niccolò Machiavelli, Legitimation, Monarchisches Handeln, Orbis Christianus, Propaganda, Ideologie.
Häufig gestellte Fragen
Wie legitimierte Karl V. sein Handeln in den Türkenkriegen?
Karl V. legitimierte seinen Kampf gegen das Osmanische Reich als Verteidigung des "Orbis Christianus" (der christlichen Welt) und des Glaubens. Er sah sich in der Tradition der universalen Kaiseridee als Beschützer der Christenheit.
Welchen Einfluss hatte Erasmus von Rotterdam auf die politische Theorie dieser Zeit?
Erasmus vertrat ein humanistisches Ideal der Harmonie und kritisierte den Krieg scharf. Er forderte vom Monarchen ein christliches Handeln, das auf das Gemeinwohl und die "Respublica Christiana" ausgerichtet ist.
Was unterscheidet Machiavellis Theorie von der des Erasmus?
Während Erasmus moralische Integrität forderte, fokussierte Machiavelli auf "Virtù" (Tatkraft) und den Erhalt der Macht. Er gilt als Wegbereiter der modernen Staatsräson, bei der das Handeln des Fürsten an der Notwendigkeit des Staates gemessen wird.
Was versteht man unter der "Universalmonarchie" Karls V.?
Es ist das Konzept einer übernationalen Herrschaft, die den Anspruch erhebt, die gesamte Christenheit politisch zu führen. In der Forschung wird sie oft als "alternative Staatsräson" auf metanationaler Ebene diskutiert.
Wie wurde die Renaissance als Krisenepoche gedeutet?
Jacob Burckhardt sah in der Renaissance eine Krise durch die Erosion von Kaisertum und Papsttum. Dies führte zu einem Legitimitätsverlust dynastischer Herrschaften, in den neue Fürstentypen und Machtkonzepte traten.
- Citar trabajo
- Johannes Konrad (Autor), 2017, Politische Theorie und Legitimation monarchischen Handelns. Karl V. und die Türkenkriege, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385534