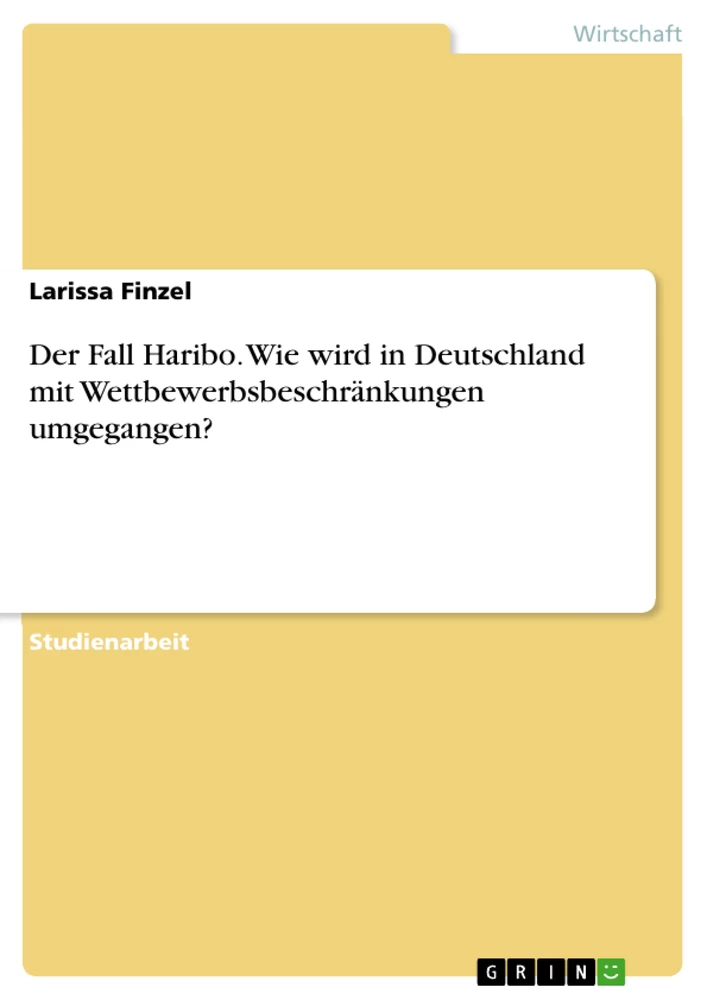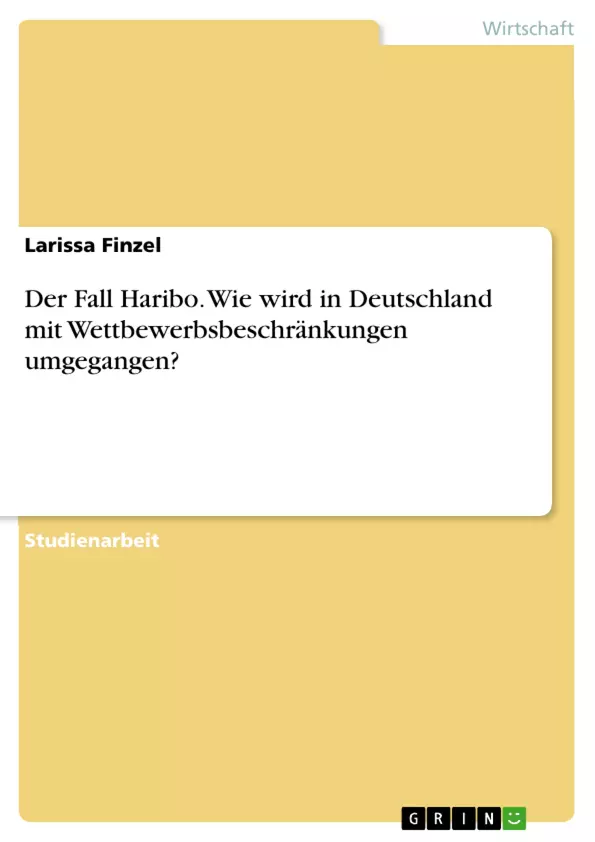Wie kann man in der Theorie und in der Praxis mit rechtswidrigen Wettbewerbsbeschränkungen umgehen? Welche Instrumente stehen dem Bundeskartellamt zur Verfügung? Und wie erfolgsversprechend sind diese im Kampf gegen rechtswidrige Kartelle? Diese Fragen widmet sich diese Arbeit.
Da es besonders Aufgabe der Wettbewerbspolitik ist, gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorzugehen, wirdzunächst auf ihre theoretischen Grundlagen eingegangen, um eine Einführung und somit auch ein Überblick über das Thema zu verschaffen. Im Anschluss daran werden die Grundlagen der Allokationspolitik erläutert, da diese sich in einigen Bereichen mit der Wettbewerbspolitik überschneidet und somit auch in Bezug auf Wettbewerbsbeschränkungen zu erwähnen ist. Daraufhin wird auf das Praxisbeispiel Haribo eingehen. Hierzu wird zunächst die Lage des Marktes schildern. Im Anschluss wird auf die Geschehnisse zwischen Haribo, den verwickelten Unternehmen und dem Bundeskartellamt eingegangen. Anschließend wird darauf eingegangen, wie der Begriff Wettbewerbsbeschränkung in der Praxis aufgefasst wird um daraufhin auf Maßnahmen des Bundeskartellamts einzugehen und diese zu bewerten. Zuletzt werden zusammenfassende Schlussbemerkungen aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Wettbewerbspolitik
- Leitbilder der Wettbewerbspolitik
- Das Modell der vollständigen Konkurrenz
- Das Modell des funktionsfähigen Wettbewerbs
- Mittel der Wettbewerbspolitik
- Kartellpolitik
- Fusionskontrolle
- Missbrauchsaufsicht
- Die Träger der Wettbewerbspolitik
- Allokationspolitik
- Aus der Praxis; der Fall Haribo
- Situation des Marktes des Lebensmitteleinzelhandels
- Ablauf der Geschehnisse
- Der Begriff Wettbewerbsbeschränkung in der Praxis
- Instrumente des Bundeskartellamts gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- Schlussbemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Problematik von Wettbewerbsbeschränkungen in Deutschland, insbesondere im Kontext des Falls Haribo. Die Analyse zielt darauf ab, die theoretischen Grundlagen der Wettbewerbspolitik zu beleuchten, die Instrumente des Bundeskartellamts im Kampf gegen rechtswidrige Kartelle zu erörtern und die Praxis des Falles Haribo zu analysieren.
- Theoretische Grundlagen der Wettbewerbspolitik
- Instrumente des Bundeskartellamts gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- Der Fall Haribo als Praxisbeispiel
- Rechtswidrige Kartelle und ihre Folgen
- Die Rolle des Bundeskartellamts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fall Haribo als Ausgangspunkt für die Untersuchung von Wettbewerbsbeschränkungen in Deutschland vor. Kapitel 2 widmet sich den theoretischen Grundlagen der Wettbewerbspolitik, wobei die Leitbilder der vollständigen Konkurrenz und des funktionsfähigen Wettbewerbs erläutert werden. Kapitel 3 geht auf die Mittel der Wettbewerbspolitik ein, darunter Kartellpolitik, Fusionskontrolle und Missbrauchsaufsicht. In Kapitel 4 wird der Fall Haribo im Detail beleuchtet, einschließlich der Situation des Lebensmitteleinzelhandels, des Ablaufs der Geschehnisse und der Instrumente des Bundeskartellamts gegen Wettbewerbsbeschränkungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Wettbewerbspolitik, Wettbewerbsbeschränkungen, Kartellgesetz, Bundeskartellamt, Lebensmitteleinzelhandel, Fall Haribo, vertikale Preisabsprachen, Rechtswidrigkeit, Sanktionen, Marktstruktur, Marktverhalten, Marktergebnis.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Kern des „Falls Haribo“?
Der Fall betraf rechtswidrige Wettbewerbsbeschränkungen und vertikale Preisabsprachen zwischen Haribo und Akteuren des Lebensmitteleinzelhandels.
Welche Instrumente hat das Bundeskartellamt gegen Kartelle?
Dem Bundeskartellamt stehen Mittel wie die Kartellpolitik, Fusionskontrolle, Missbrauchsaufsicht und die Verhängung von Bußgeldern zur Verfügung.
Was ist der Unterschied zwischen vollständiger Konkurrenz und funktionsfähigem Wettbewerb?
Vollständige Konkurrenz ist ein theoretisches Idealmodell; der funktionsfähige Wettbewerb ist das realistische Leitbild der deutschen Wettbewerbspolitik.
Warum sind Preisabsprachen für den Markt schädlich?
Sie führen zu künstlich hohen Preisen, behindern den fairen Wettbewerb und schaden letztlich dem Verbraucher sowie der Markteffizienz (Allokationspolitik).
Welche Rolle spielt die Missbrauchsaufsicht?
Sie stellt sicher, dass marktbeherrschende Unternehmen ihre Stellung nicht ausnutzen, um Wettbewerber zu verdrängen oder unangemessene Konditionen zu diktieren.
- Arbeit zitieren
- Larissa Finzel (Autor:in), 2017, Der Fall Haribo. Wie wird in Deutschland mit Wettbewerbsbeschränkungen umgegangen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385536