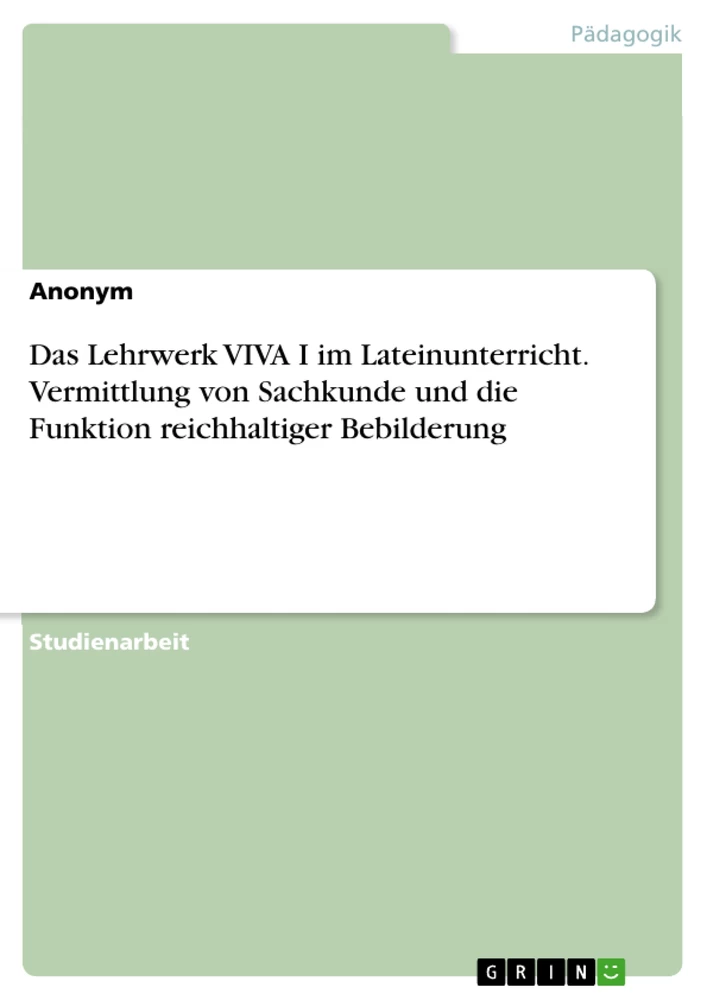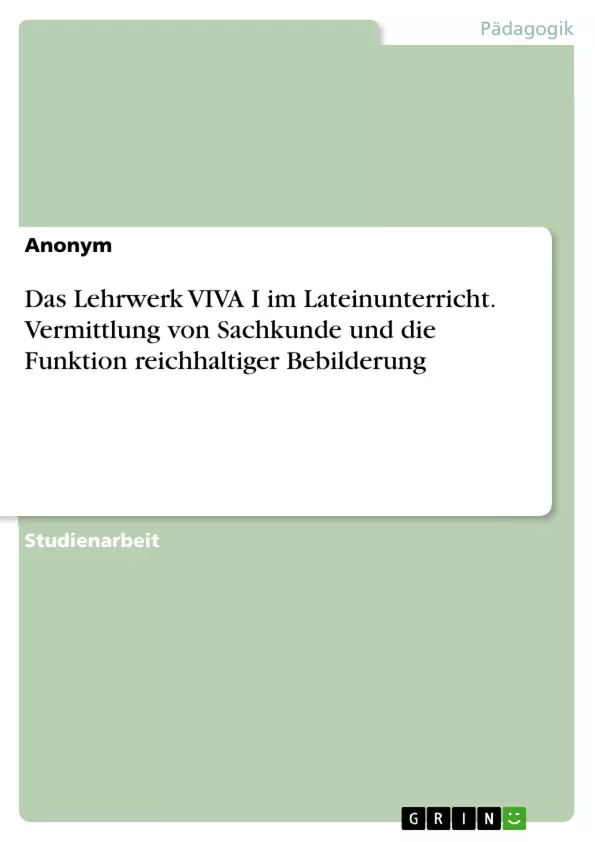Die vorliegende Arbeit widmet sich den Anfangslektionen des Lehrbuches VIVA I. Der besondere Fokus dabei richtet sich auf die Vermittlung sachkundlicher Themen und behandelt darüber hinaus ebenfalls die auffällige und reichhaltige Bebilderung des Buches.
Zu diesem Zwecke werden zunächst die theoretischen Grundlagen reflektiert: Sinn und Legitimation von Sachkunde im Lateinunterricht werden ebenso behandelt wie Einsatz und Nutzen von Bildern. Anschließend folgt eine kurze Übersicht zum behandelten Lehrwerk, die bewusst lediglich den Schwerpunkt auf die sachdienlichen Themen dieser Hausarbeit legt. Darauffolgend sollen die ersten drei Lektionen von VIVA I sowie der an diese anschließende Informationstext einer näheren Betrachtung unterzogen werden. Hier geht es primär um die Bebilderung der einzelnen Passagen sowie deren Zusammenhang mit Inhalt und historischen Kontext, da das Layout des Buches als auffällig bezeichnet werden kann und dieses sich darin von anderen Lehrwerken durchaus unterscheidet. Darüber hinaus wird die Lehrbuchfamilie Selicii als ähnlich prägender Part des Lehrbuches auf deren Zweck hin untersucht, da sie als Instrument der Vermittlung sachkundlicher Themen dient. Abschließend erfolgen die Bewertung der zuvor analysierten Bestandteile sowie ein reflektierendes Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachkunde im Lateinunterricht
- Altertumskunde, Realienkunde und Sachkunde
- Legitimation von Sachkunde
- Anschaulichkeit durch Bilder
- Sachkunde und Bebilderung in VIVA I
- Konzeption und Ersteindruck
- Sachkunde und Bebilderung
- Darstellung der Familie
- Bewertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Anfangslektionen des Lehrbuches VIVA I, mit besonderem Fokus auf die Vermittlung von Sachkunde und die Verwendung von Bildern. Die Arbeit untersucht theoretische Grundlagen wie den Sinn und die Legitimation von Sachkunde im Lateinunterricht sowie den Einsatz und Nutzen von Bildern. Sie analysiert anschließend die ersten drei Lektionen von VIVA I, einschließlich des zugehörigen Informationstextes, und bewertet die Bebilderung und deren Zusammenhang mit Inhalt und historischem Kontext.
- Die Rolle von Sachkunde im Lateinunterricht
- Die Bedeutung von Bildern in der Vermittlung von Sachkunde
- Die Gestaltung von Sachkunde und Bebilderung in VIVA I
- Der Zusammenhang zwischen Bebilderung und Inhalt in VIVA I
- Die Analyse der Lehrbuchfamilie Selicii
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Lehrbuch VIVA I und die zentralen Themen vor: Sachkunde, Bebilderung und deren Zusammenhang mit Inhalt und historischem Kontext.
- Sachkunde im Lateinunterricht: Dieses Kapitel behandelt die Unterscheidung zwischen Altertumskunde, Realienkunde und Sachkunde und beleuchtet deren Bedeutung für den Lateinunterricht. Es beleuchtet auch die Legitimation von Sachkunde und die Rolle von Bildern in der Vermittlung von Sachkunde.
- Sachkunde und Bebilderung in VIVA I: Dieser Abschnitt beschreibt die Konzeption und den ersten Eindruck des Lehrbuches VIVA I und untersucht den Einsatz von Sachkunde und Bebilderung. Darüber hinaus analysiert es die Darstellung der Familie und die Nutzung von Bildern als Mittel zur Vermittlung von Sachkunde.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Sachkunde, Bebilderung, Altertumskunde, Realienkunde, VIVA I, Lehrbuch, lateinischer Unterricht, Anschaulichkeit, Visualisierung und historischer Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere am Latein-Lehrwerk VIVA I?
VIVA I zeichnet sich durch eine besonders reichhaltige und moderne Bebilderung sowie die konsequente Vermittlung von Sachkunde über eine fiktive Familie aus.
Warum sind Bilder im Lateinunterricht wichtig?
Bilder dienen der Veranschaulichung abstrakter Inhalte, fördern die Motivation und helfen dabei, eine Brücke zwischen der antiken Welt und der Lebensrealität der Schüler zu schlagen.
Welche Rolle spielt die Familie "Selicii" im Buch?
Die Familie dient als Instrument der Sachkundevermittlung. Durch ihre Erlebnisse lernen Schüler den römischen Alltag, soziale Strukturen und historische Kontexte kennen.
Was versteht man unter "Sachkunde" im Lateinunterricht?
Sachkunde umfasst das Wissen über die antike Kultur, Geschichte, Politik und den Alltag der Römer, was über das reine Erlernen der Sprache hinausgeht.
Wie wird die Legitimation von Sachkunde heute gesehen?
Sachkunde wird als essenziell betrachtet, um Texte im historischen Kontext zu verstehen und interkulturelle Kompetenzen durch den Vergleich mit der Gegenwart zu entwickeln.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Das Lehrwerk VIVA I im Lateinunterricht. Vermittlung von Sachkunde und die Funktion reichhaltiger Bebilderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385538