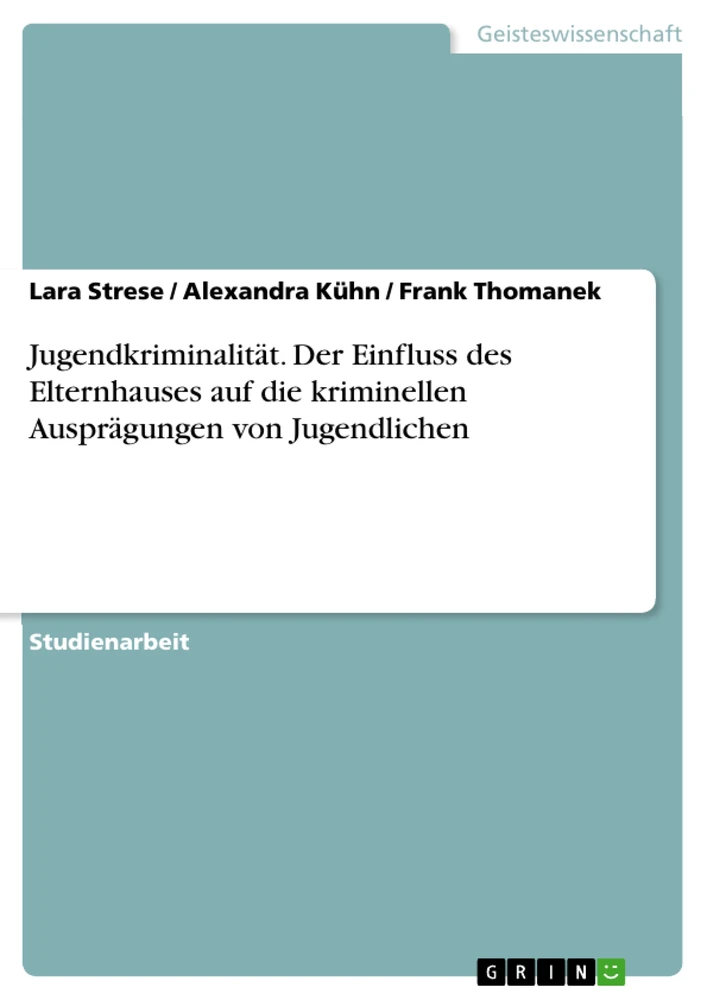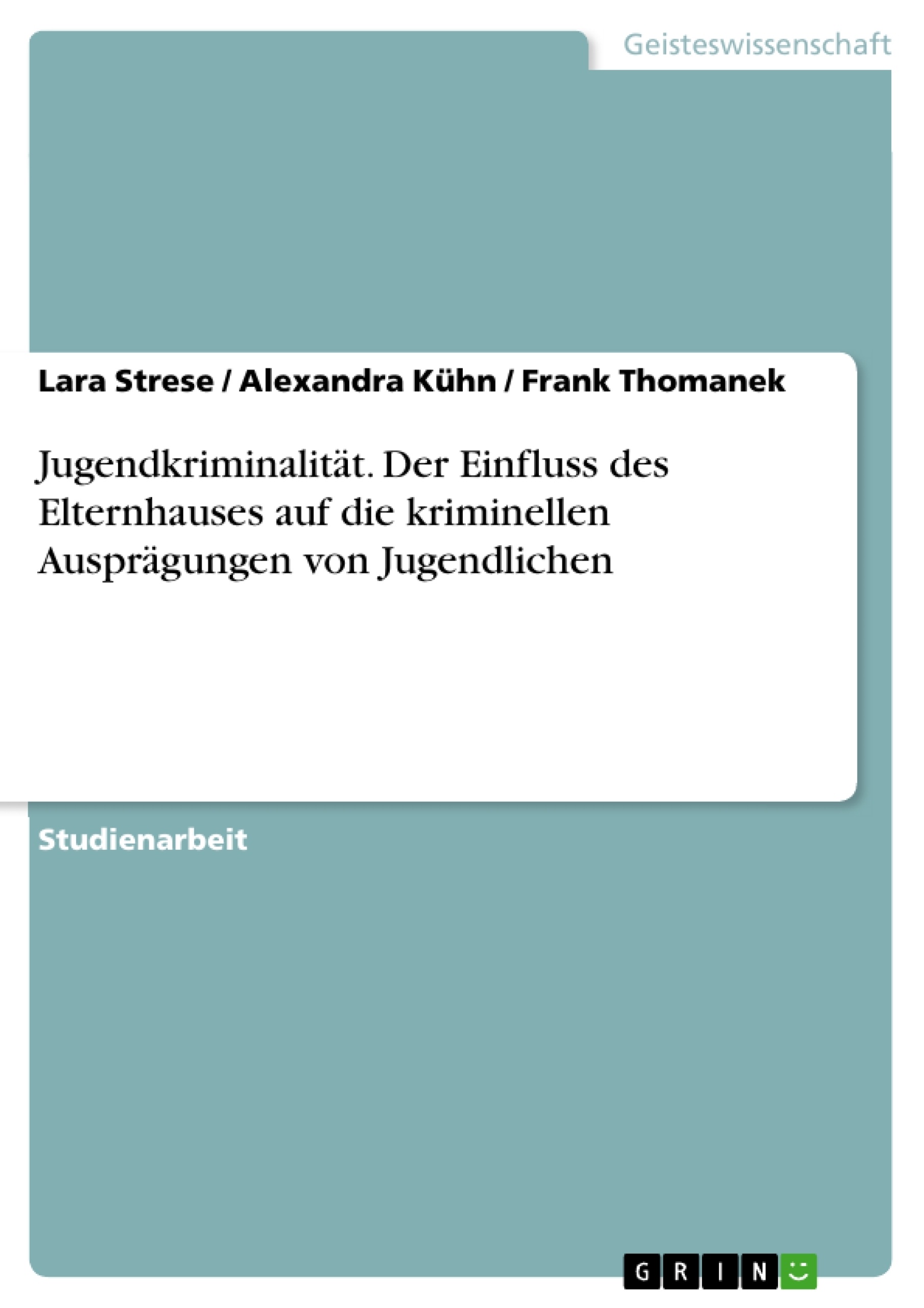Jugendkriminalität ist ein viel diskutiertes Thema in der heutigen Zeit. Diese Arbeit untersucht, ob die Einflüsse des Elternhauses dazu beitragen können, dass Jugendliche kriminell werden, oder ob Eltern verhindern können, dass ihre Kinder auf die kriminelle Bahn geraten.
Beginnend mit einer Definition der Jugendkriminalität werden die Ursachen mittels unterschiedlicher Theorien beleuchtet. Schließlich soll die Entstehung der Jugendkriminalität genauer betrachtet werden, um hieraus Möglichkeiten der Prävention zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist Kriminalität?
- 3 Jugendkriminalität
- 3.1 Was ist Jugendkriminalität?
- 3.2 Gibt es überhaupt „die“ Jugendkriminalität?
- 3.3 Strafrechtlicher Umgang mit Jugendkriminalität
- 4 Ursachen
- 4.1 Theorien zur Ursachenerklärung
- 4.1.1 Biologische Faktoren
- 4.1.2 Lerntheorien
- 4.1.3 Theorie der differentiellen Assoziation, Theorie des sozialen Modelllernens, Theorie der differentiellen Gelegenheit
- 4.1.4 Kontroll- und Bindungstheorien
- 4.1.5 Anomietheorien, Subkulturtheorien, Theorie der Neutralisierungstechniken
- 4.1.6 Kriminalitäts-/ Kriminalisierungstheorie
- 4.1.7 Ausgangspunkt: Konzept des symbolischen Interaktionismus
- 4.2 Faktoren, die Kriminalität beeinflussen
- 5 Entstehung der Jugendkriminalität
- 5.1 Der Teufelskreislauf, Modell nach Stephan Quensel
- 5.2 Präventionen der Jugendkriminalität
- 6 Fazit
- 7 Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Elternhauses auf jugendliche Kriminalität. Ziel ist es, die Ursachen von Jugendkriminalität zu beleuchten und präventive Maßnahmen zu identifizieren. Die Arbeit beginnt mit einer Definition von Jugendkriminalität und analysiert verschiedene Theorien zur Erklärung ihrer Ursachen.
- Definition und Abgrenzung von Jugendkriminalität
- Theorien zur Erklärung der Ursachen von Jugendkriminalität
- Einflussfaktoren des Elternhauses auf die Entstehung von Jugendkriminalität
- Möglichkeiten der Prävention von Jugendkriminalität
- Strafrechtlicher Umgang mit Jugendkriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Jugendkriminalität ein und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit. Sie benennt die zentrale Fragestellung nach dem Einfluss des Elternhauses und kündigt die methodische Vorgehensweise an, beginnend mit der Definition von Jugendkriminalität, über die Ursachenforschung bis hin zur Betrachtung der Entstehung und Prävention.
2 Was ist Kriminalität?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Kriminalität im Kontext sozialer Normen und Kontrolle. Es erklärt die Rolle des Strafrechts als letzten Bestandteil des Systems sozialer Kontrolle und erläutert die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen verschiedenen Formen abweichenden Verhaltens. Der fließende Übergang zwischen verschiedenen Delikten und die Herausforderungen der Kriminalpolitik bei der Definition von Straftatbeständen werden hervorgehoben, am Beispiel von Homosexualität und Stalking veranschaulicht.
3 Jugendkriminalität: Dieses Kapitel definiert Jugendkriminalität im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und analysiert die Überrepräsentanz jugendlicher Straftäter in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Es wird der Unterschied zwischen Jugendkriminalität und der Kriminalität Erwachsener herausgearbeitet, insbesondere hinsichtlich der Art der Delikte und deren Häufigkeit. Die kontroverse Diskussion um den Begriff „die“ Jugendkriminalität und die Schwierigkeiten ihrer Erforschung aufgrund individueller Unterschiede wird angesprochen.
4 Ursachen: Dieses Kapitel befasst sich mit Theorien zur Ursachenerklärung von Kriminalität. Es betont die Vielzahl der Faktoren und die Komplexität der Ursachen, wobei die Bedeutung des freien Willens im Kontext der Handlungsalternativen hervorgehoben wird. Die Arbeit erwähnt verschiedene Ansätze, von biologischen Faktoren über Lerntheorien bis hin zu Kontroll- und Bindungstheorien, und zeigt die Grenzen einzelner Erklärungsmodelle auf. Die Schwierigkeit, alle Formen von Kriminalität mit einer einzigen Theorie zu erklären, wird klargestellt.
5 Entstehung der Jugendkriminalität: Dieses Kapitel behandelt die Entstehung von Jugendkriminalität. Es wird voraussichtlich auf verschiedene Modelle und Faktoren eingehen, die zur Entstehung beitragen. Ein möglicher Schwerpunkt liegt auf der Betrachtung präventiver Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Elternhaus, Kriminalitätstheorien, Prävention, Strafrecht, Jugendgerichtsgesetz (JGG), soziale Kontrolle, Delinquenz, Risikofaktoren, Schutzfaktoren.
Häufig gestellte Fragen zu "Jugendkriminalität und der Einfluss des Elternhauses"
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Elternhauses auf jugendliche Kriminalität. Sie beleuchtet die Ursachen von Jugendkriminalität und identifiziert präventive Maßnahmen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Jugendkriminalität, Theorien zur Erklärung der Ursachen von Jugendkriminalität, Einflussfaktoren des Elternhauses auf die Entstehung von Jugendkriminalität, Möglichkeiten der Prävention von Jugendkriminalität und strafrechtlicher Umgang mit Jugendkriminalität.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und Definition von Kriminalität und Jugendkriminalität. Es folgt eine Analyse verschiedener Theorien zur Erklärung der Ursachen von Kriminalität, ein Kapitel zur Entstehung von Jugendkriminalität mit Fokus auf präventive Maßnahmen, und abschließend ein Fazit und Quellenverzeichnis.
Welche Theorien zur Ursachenerklärung von Kriminalität werden behandelt?
Die Arbeit behandelt diverse Theorien, darunter biologische Faktoren, Lerntheorien (soziale Modelllernen, differentielle Assoziation, differentielle Gelegenheit), Kontroll- und Bindungstheorien, Anomietheorien, Subkulturtheorien, die Theorie der Neutralisierungstechniken, und Kriminalitäts-/Kriminalisierungstheorien im Kontext des symbolischen Interaktionismus. Die Grenzen einzelner Erklärungsmodelle werden aufgezeigt.
Wie wird Jugendkriminalität definiert?
Jugendkriminalität wird im Rahmen des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) definiert und im Kontext der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) analysiert. Der Unterschied zu Kriminalität Erwachsener wird hinsichtlich der Art und Häufigkeit der Delikte herausgearbeitet. Die Arbeit thematisiert auch die Schwierigkeiten, den Begriff „die“ Jugendkriminalität aufgrund individueller Unterschiede zu fassen.
Welche Rolle spielt das Elternhaus?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des Elternhauses als zentralen Faktor auf die Entstehung von Jugendkriminalität. Dies ist die zentrale Fragestellung der Arbeit.
Welche präventiven Maßnahmen werden betrachtet?
Die Arbeit identifiziert und analysiert Möglichkeiten der Prävention von Jugendkriminalität. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Kapitel zur Entstehung von Jugendkriminalität.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Jugendkriminalität, Elternhaus, Kriminalitätstheorien, Prävention, Strafrecht, Jugendgerichtsgesetz (JGG), soziale Kontrolle, Delinquenz, Risikofaktoren, Schutzfaktoren.
Wie wird Kriminalität definiert?
Kriminalität wird im Kontext sozialer Normen und Kontrolle definiert. Die Rolle des Strafrechts als letztes Mittel der sozialen Kontrolle und die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zu abweichendem Verhalten werden erläutert. Beispiele wie Homosexualität und Stalking veranschaulichen die fließenden Übergänge und Herausforderungen der Kriminalpolitik.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet eine Zusammenfassung jedes Kapitels, die die Inhalte und Schwerpunkte prägnant beschreibt.
- Quote paper
- Lara Strese (Author), Alexandra Kühn (Author), Frank Thomanek (Author), 2016, Jugendkriminalität. Der Einfluss des Elternhauses auf die kriminellen Ausprägungen von Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385695