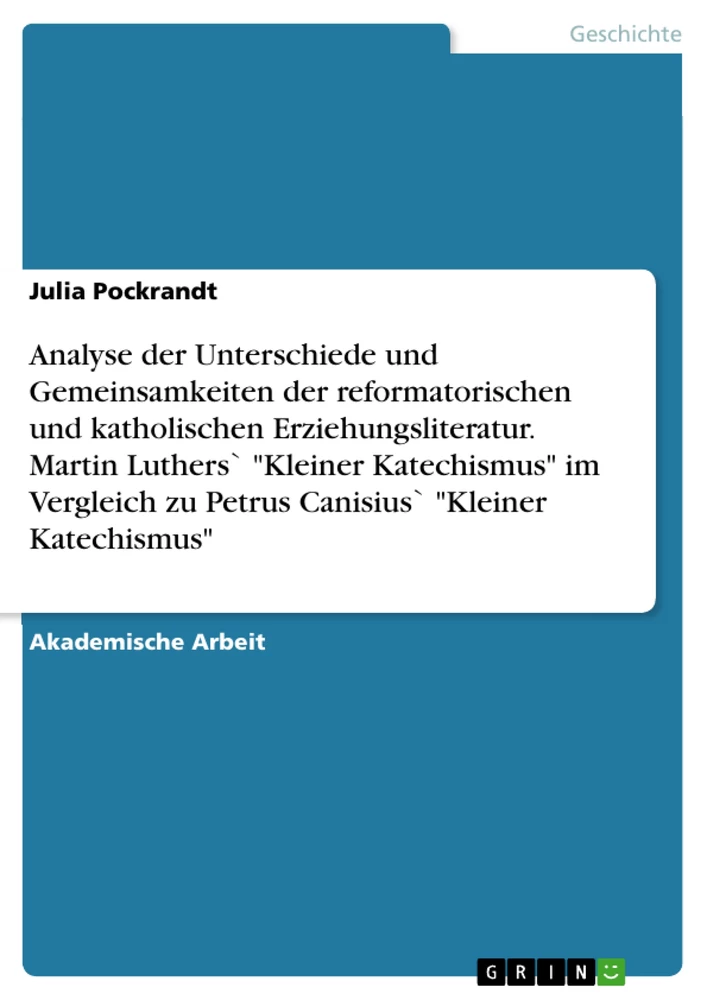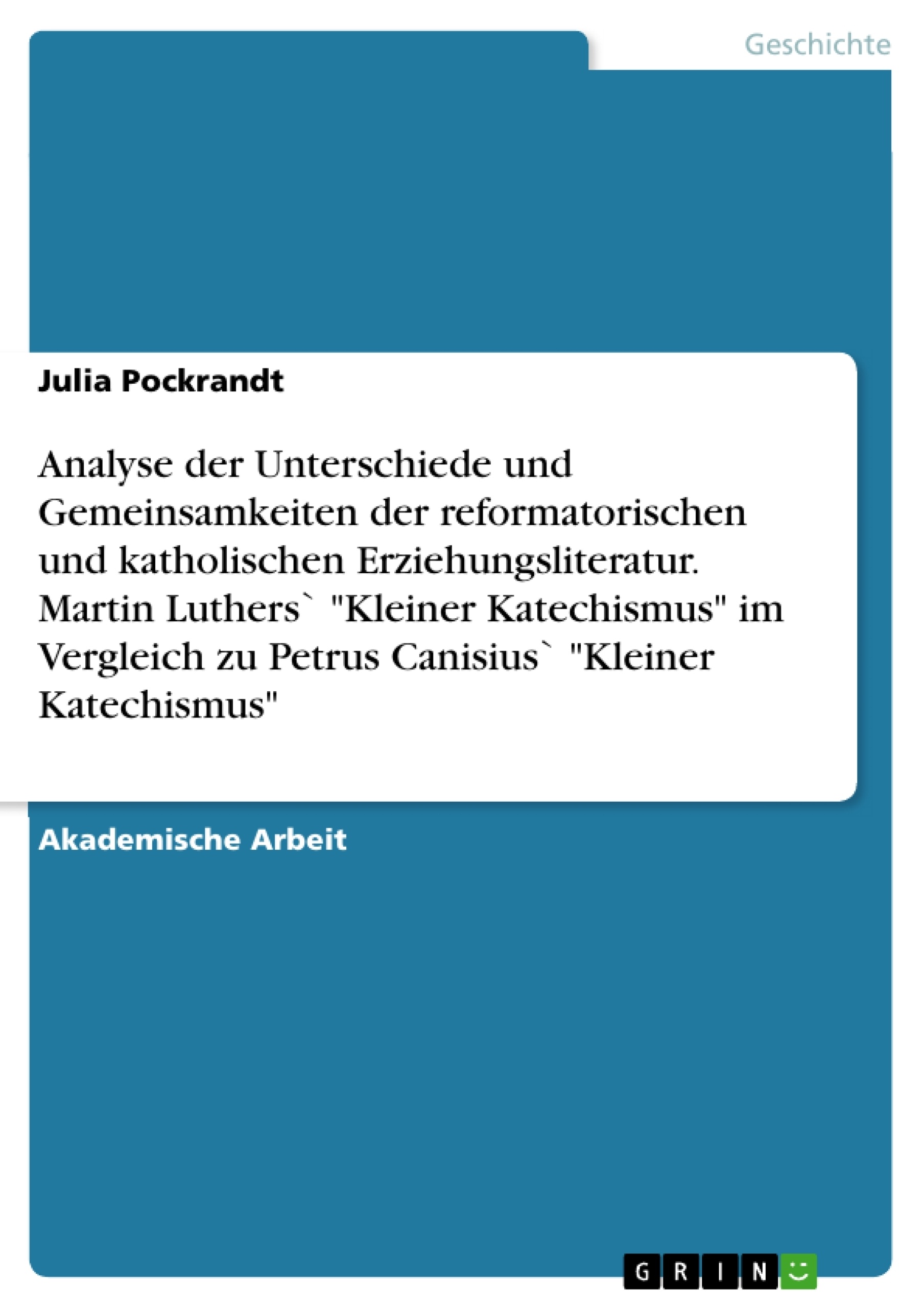Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Entstehung spezifischer katholischer und reformatorischer Lern- Katechismen, die ihren Ursprung in der Reformationszeit haben. Hauptbestandteil der Arbeit soll die Untersuchung des Kleinen Katechismus von Dr. Martin Luther und dessen Vergleich mit dem Kleinen Katechismus von Petrus Canisius sein. Die Analyse und Herausarbeitung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Werke aus einer interkonfessionellen Perspektive sollen hierbei im Mittelpunkt stehen. Sind die Inhalte der beiden Richtungen tatsächlich so verschieden, wie es die spätere Spaltung der Kirche vermuten lässt? Wo genau sind die Gemeinsamkeiten innerhalb der betrachteten Katechismen zu erkennen?
Luthers Kleiner Katechismus von 1529 wird für gut 450 Jahre zu Erziehungsbasis der evangelisch-lutherischen Kirche. Gleiches gilt für den gegenreformatorischen Kleinen Katechismus der Katholischen Kirche. Bis in die Gegenwart bleiben die Streitfragen beider Kirchen thematisch aktuell, welche aus den Katechismen inhaltlich hervor gehen.
Diese Arbeit wird anfänglich kurz auf die Definition und Entstehung des Katechismus im allgemeinen eingehen. Es folgt die ausführliche Beschäftigung mit dem historischen Hintergrund und der Entstehung von Martin Luthers Kleinem Katechismus. Anschließend wird dieser inhaltlich analysiert und interpretiert. Dieser Bearbeitung folgt die Skizzierung des Historischen Hintergrundes um die Entstehung des katholischen Kleinen Katechismus von Pertus Canisius, welcher im nächsten Schritt ebenfalls einer ausführlichen inhaltlichen Analyse unterzogen werden soll. Abschließend werden die beiden Katechismen im Detail vergleichen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauskristallisiert. Dieser Teil bildet neben der inhaltlichen Beschäftigung, den Schwerpunkt der Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Katechismus im 16. Jahrhundert
- Kleiner Katechismus von Martin Luther
- Luther Vater des Lern-Katechismus
- Martin Luthers' Kleiner Katechismus: Inhalt und Interpretation
- Kleiner Katechismus von Petrus Canisius
- Antwort der „,Gegenreformation“
- Inhaltliche Auseinandersetzung mit Canisius` Kleinem Katechismus
- Analyse: Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung spezifischer katholischer und reformatorischer Lern- Katechismen, die ihren Ursprung in der Reformationszeit haben. Die Arbeit untersucht den Kleinen Katechismus von Dr. Martin Luther und vergleicht ihn mit dem Kleinen Katechismus von Petrus Canisius. Im Mittelpunkt stehen die Analyse und Herausarbeitung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Werke aus einer interkonfessionellen Perspektive. Die Arbeit untersucht, ob die Inhalte der beiden Richtungen tatsächlich so verschieden sind, wie es die spätere Spaltung der Kirche vermuten lässt, und wo genau die Gemeinsamkeiten innerhalb der betrachteten Katechismen zu erkennen sind.
- Entstehung und Entwicklung des Katechismus im 16. Jahrhundert
- Analyse des Kleinen Katechismus von Martin Luther
- Analyse des Kleinen Katechismus von Petrus Canisius
- Vergleich der Inhalte und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
- Relevanz der Katechismen für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema der Arbeit und stellt die Forschungsfrage vor. Im zweiten Kapitel wird die Entstehung und Entwicklung des Katechismus im 16. Jahrhundert erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Kleinen Katechismus von Martin Luther, seiner Entstehung, seinem Inhalt und seiner Interpretation. Im vierten Kapitel wird der Kleiner Katechismus von Petrus Canisius behandelt, inklusive seines historischen Hintergrunds und einer detaillierten inhaltlichen Analyse. Abschließend werden die beiden Katechismen im fünften Kapitel miteinander verglichen, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Reformationszeit und der Konfessionalisierung, insbesondere dem Katechismus. Sie befasst sich mit den Werken von Martin Luther und Petrus Canisius, den bedeutenden Figuren der Reformation und Gegenreformation. Die Analyse konzentriert sich auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Katechismen in Bezug auf ihre Inhalte, ihre Didaktik und ihre Bedeutung für die religiöse Bildung. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz der Katechismen für die Geschichte der Kirche und ihre Bedeutung für die heutige Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen den Katechismen von Luther und Canisius?
Luthers Katechismus (1529) bildet die Basis der evangelischen Lehre, während der von Petrus Canisius als Antwort der Gegenreformation die katholischen Dogmen festigte.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Werken?
Ja, beide nutzen die Form des Lern-Katechismus (Frage-Antwort-Schema) und behandeln zentrale christliche Inhalte wie die Zehn Gebote, das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis.
Warum war der Katechismus im 16. Jahrhundert so wichtig?
Er diente als grundlegendes Instrument der religiösen Bildung und Erziehung in einer Zeit, in der die Konfessionalisierung die Gesellschaft spaltete.
Wie unterscheidet sich die Didaktik bei Luther und Canisius?
Luther legte Wert auf eine einfache, volksnahe Sprache für Hausväter, während Canisius' Werk präzise theologische Abgrenzungen zur "Gegenreformation" enthielt.
Sind diese historischen Katechismen heute noch relevant?
Ja, sie sind grundlegende Dokumente für das Verständnis der Kirchengeschichte und der interkonfessionellen Unterschiede, die bis heute nachwirken.
- Arbeit zitieren
- Julia Pockrandt (Autor:in), 2017, Analyse der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der reformatorischen und katholischen Erziehungsliteratur. Martin Luthers` "Kleiner Katechismus" im Vergleich zu Petrus Canisius` "Kleiner Katechismus", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385750