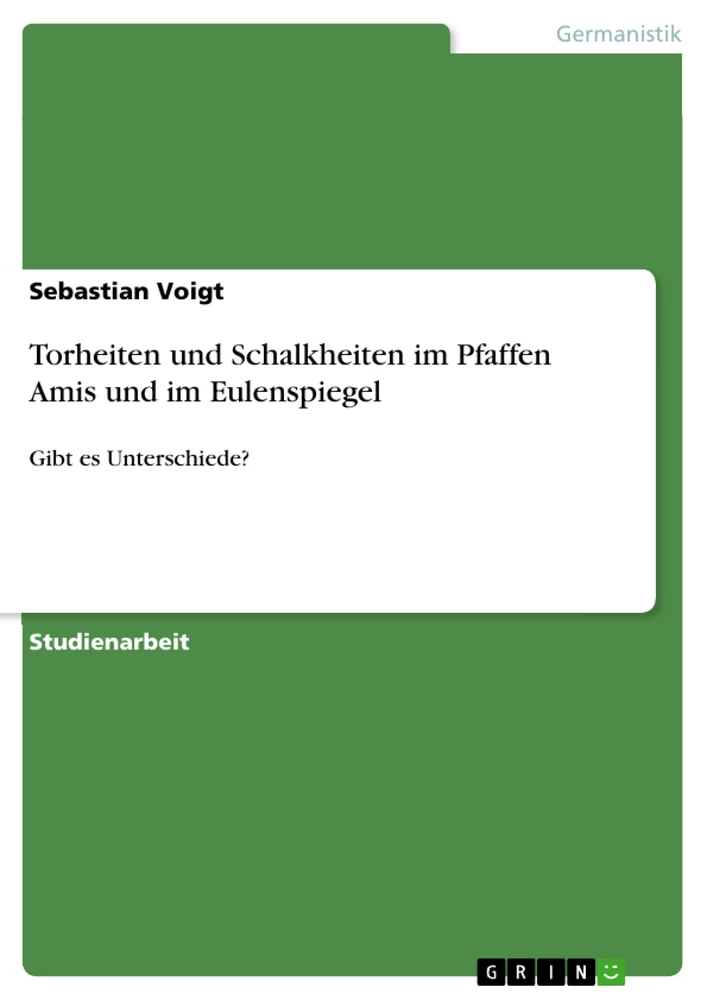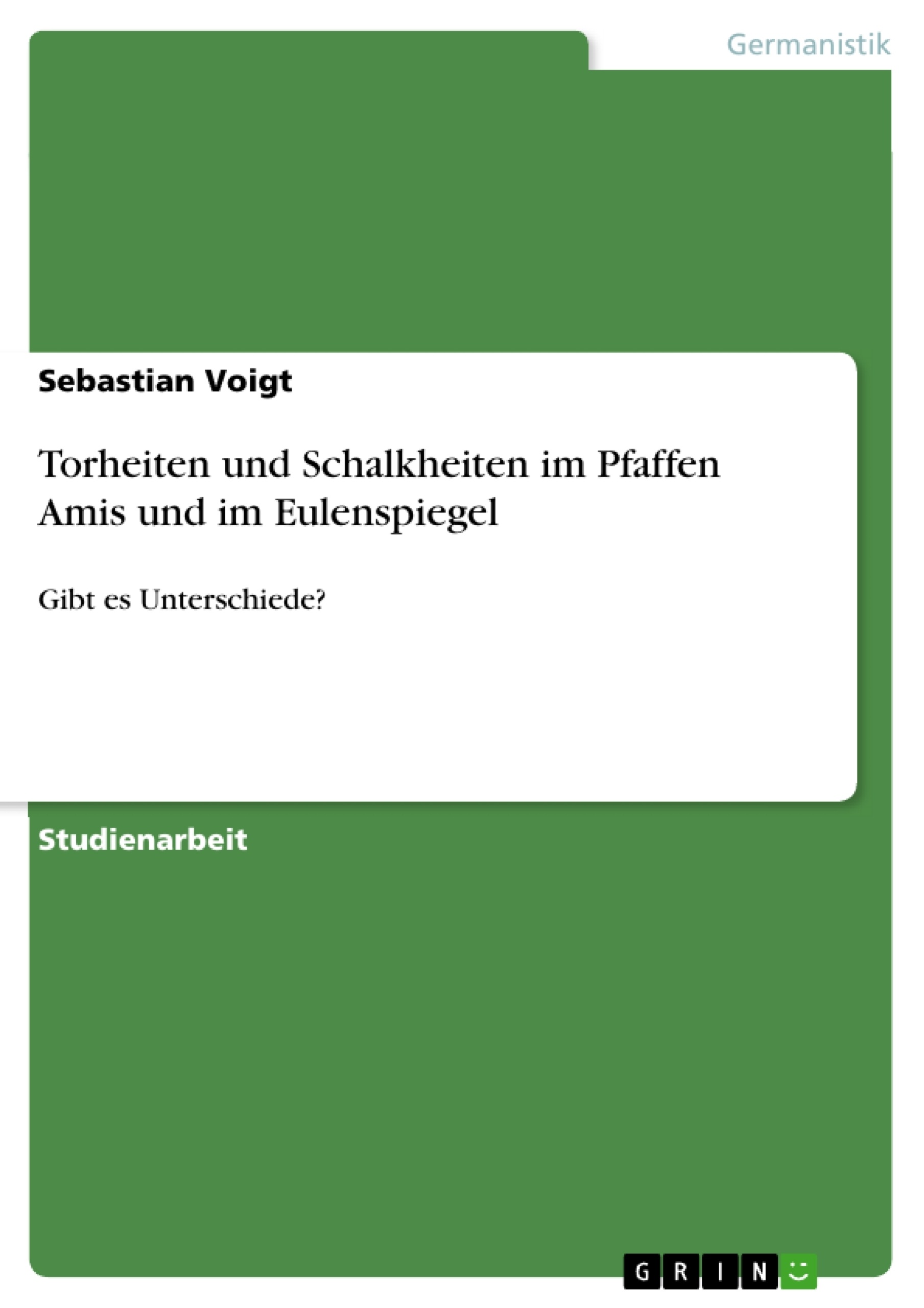Der Pfaffe Amis aus dem gleichnamigen Schwankroman und Till Eulenspiegel aus „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“ sind zwei Schwankhelden, die einige Gemeinsamkeiten, aber auch große Unterschiede aufweisen. Sie wandeln in einer Welt, in der die katholische Kirche versucht, Vernunft und Nachdenken zu unterbinden. Es reicht ein Streich oder wörtlich genommener Befehl, um alles aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hier wirken die von jeglicher Moral befreiten, hinterlistigen Spaßmacher wie heroische und aufklärerische Erlöser.
In dieser Arbeit werden die Motive der Schalkheit und der Torheit in beiden Romanen miteinander verglichen. Dazu werden zunächst die Begriffe Tor, Torheit und töricht sowie Schalk, Schalkheit und schalkhaft erläutert und voneinander abgegrenzt, sodass unter Berücksichtigung der Entstehungszeit der Erzählungen eine Untersuchung der Motive ermöglicht wird. Anschließend werden die beiden Protagonisten näher thematisiert und im Hinblick auf ihre Ausgangssituation und V orgehensweise miteinander konfrontiert. Zuletzt werden die Motivationen der beiden Helden unter dem Überbegriff der wîsen Schalckheiten miteinander verglichen und den tumben Thorheiten ihrer sündenhaften Opfer gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsabgrenzung
- Tor, Torheit, töricht
- Schalk, Schalkheit, schalkhaft
- Über die beiden Romane
- Über die beiden Helden
- Amis
- Eulenspiegel
- Über die Motive
- Wise Schalckheiten
- Tumbe Thorheiten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Vergleich der Motive von Schalkheit und Torheit in den Schwankromanen „Der Pfaffe Amis“ und „Ein kurtzweilig Lesen von Dil Ulenspiegel“. Ziel ist es, die beiden Helden Amis und Eulenspiegel in ihren Handlungsweisen und Motiven zu analysieren und die unterschiedlichen Bedeutungen von Schalkheit und Torheit im Kontext der jeweiligen Epochen zu beleuchten. Dabei wird auch die Bedeutung der Motive im Verhältnis zur katholischen Kirche und ihrem Einfluss auf die Gesellschaft erörtert.
- Vergleich der Motive von Schalkheit und Torheit in den beiden Romanen
- Analyse der Handlungsweisen und Motive von Amis und Eulenspiegel
- Untersuchung der Bedeutungen von Schalkheit und Torheit in den jeweiligen Epochen
- Bedeutung der Motive im Verhältnis zur katholischen Kirche und ihrem Einfluss auf die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die beiden Schwankhelden Amis und Eulenspiegel vor und beschreibt ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Fokus liegt auf der Analyse der Motive der Schalkheit und der Torheit in beiden Romanen.
Begriffsabgrenzung
In diesem Kapitel werden die Begriffe Tor, Torheit, töricht sowie Schalk, Schalkheit und schalkhaft erläutert und voneinander abgegrenzt. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Begriffe im Kontext der Entstehungszeit der Erzählungen.
Über die beiden Romane
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die beiden Romane und ihren Kontext.
Über die beiden Helden
Das Kapitel stellt die beiden Protagonisten Amis und Eulenspiegel vor und vergleicht ihre Ausgangssituation und Vorgehensweise.
Über die Motive
In diesem Kapitel werden die Motivationen der beiden Helden unter dem Überbegriff der wîsen Schalckheiten miteinander verglichen und den tumben Thorheiten ihrer sündenhaften Opfer gegenübergestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Schalkheit, Torheit, Schwank, Schwankliteratur, Amis, Eulenspiegel, katholische Kirche, Gesellschaft, Moral, Vernunft, Nachdenken, Epoche, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Begriffsabgrenzung, Motivanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wer war der „Pfaffe Amis“?
Der Pfaffe Amis ist der Held des ersten deutschen Schwankromans (13. Jh.), ein betrügerischer Priester, der durch List und Schalkheit zu Reichtum gelangt.
Was unterscheidet Till Eulenspiegel vom Pfaffen Amis?
Während Amis oft aus materieller Not oder Gier handelt, ist Eulenspiegel eher ein gesellschaftskritischer Provokateur, der die Sprache wörtlich nimmt, um andere bloßzustellen.
Was bedeutet „Schalkheit“ im mittelalterlichen Kontext?
Schalkheit bezeichnete ursprünglich eine hinterlistige oder böswillige List, entwickelte sich aber literarisch zu einer Form von intelligenter Überlegenheit durch Witz.
Warum ist die „Torheit“ ein zentrales Motiv?
Die Helden nutzen die Dummheit oder moralische Schwäche ihrer Opfer aus. Die Torheit der anderen ist die Voraussetzung für den Erfolg der Schalkheiten der Helden.
Welche Rolle spielt die Kirche in diesen Schwankromanen?
Die Kirche wird oft satirisch dargestellt. Die Helden zeigen die Diskrepanz zwischen religiösem Anspruch und dem tatsächlichen, oft törichten Verhalten des Klerus auf.
- Citar trabajo
- Sebastian Voigt (Autor), 2017, Torheiten und Schalkheiten im Pfaffen Amis und im Eulenspiegel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385762