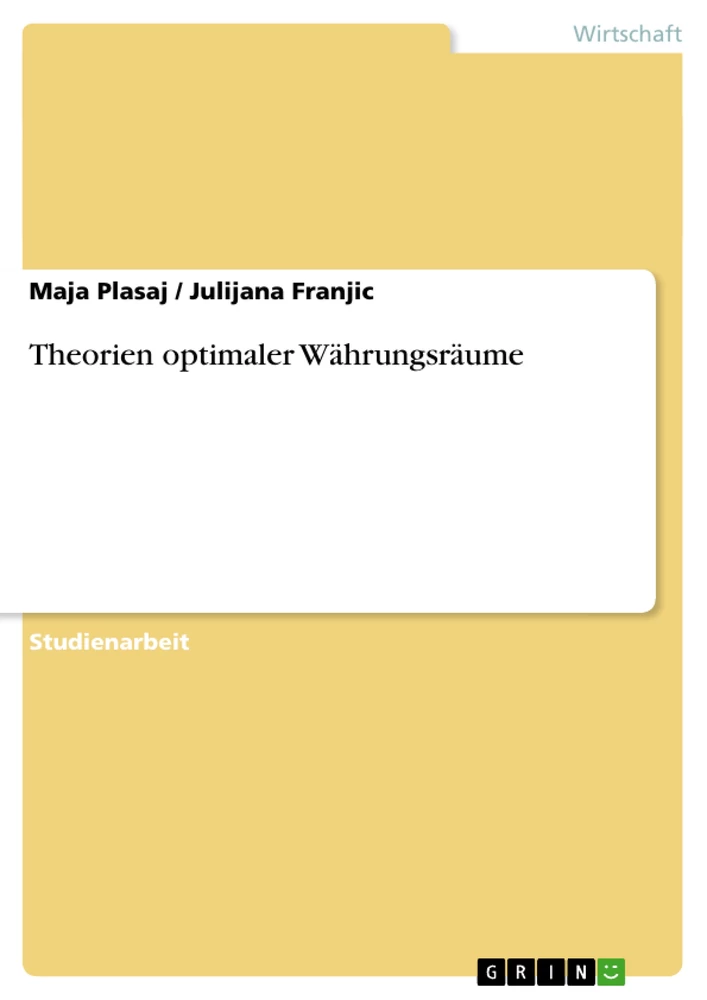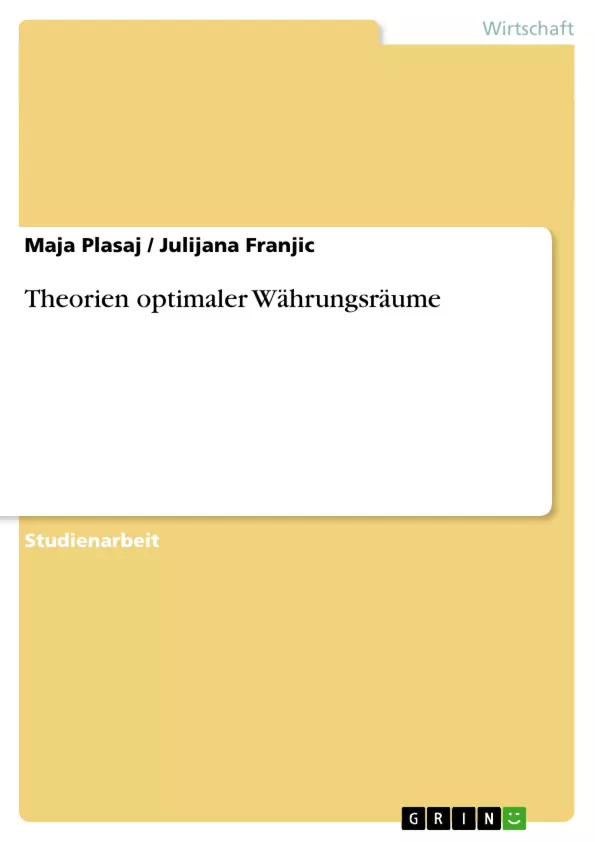Bei der Diskussion um die Theorie optimaler Währungsräume handelt es sich um die Bestimmung einer optimalen räumlichen Ausdehnung eines Gebietes mit einer einheitlichen Währung. Die Theorie optimaler Währungsräume entstand Anfang der 60er Jahre. Aufbauend auf den Ansätzen von Robert A. Mundell, Roland D. McKinnon, Peter B. Kenen und James C. Ingram beschäftigte diese Thematik die Wirtschaftswissenschaft bis in die 70er Jahre hinein. Danach wurde es etwas ruhiger um dieses Thema. Wieder neu belebt wurde die Theorie optimaler Währungsräume erst in den späten 80er bzw. Anfang der 90er Jahre. Dazu hat vor allem eine neuere Entwicklung in der makroökonomischen Theorie ihren Beitrag geleistet. Die ursprünglichen Ansätze haben nicht an Bedeutung verloren, jedoch wurden mit der Aufgabe eines langfristigen Trade-offs zwischen Inflation und Arbeitslosigkeit potentielle Kostenaspekte eines Beitritts zu einer Währungsunion in Frage gestellt. Ferner gaben die im Jahre 1991 beschlossenen Verträge von Maastricht konkrete Schritte zur Vollendung der monetären Integration in Europa bereits in unmittelbar absehbarer Zukunft vor.1 Die Abgrenzung der oben erwähnten optimalen Ausdehnung eines Gebietes wird mit Hilfe festgelegter Kriterien bestimmt, welche determinieren sollen, inwiefern Gebiete mit ursprünglich eigenen Währungen, zur Einführung einer gemeinsamen Währung geeignet sind. Ziel der vorliegenden Arbeit soll sein, einen Überblick über die Grundgedanken dieser Theorie zu geben und einige Probleme, Beispiele und Schlussfolgerungen vorzustellen. 1 Vgl. Tavlas (1993b), S. 663.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung optimaler Währungsraum
- Traditionelle Kriterien optimaler Währungsräume bei mikroökonomischen Störungen
- Der Ansatz von Mundell
- Das Modell
- Kritik an Mundells Modell
- Der Ansatz von McKinnon
- McKinnons Modellaufbau
- Kritik an McKinnons Modell
- Der Ansatz von Kenen
- Kenens Modellaufbau
- Kritik an Kenens Modell
- Der Ansatz von Ingram
- Ingrams Modell
- Kritik an Ingrams Modell
- Der Ansatz von Mundell
- Kosten-Nutzen-Konzept
- Kosten einer Währungsunion
- Nutzen einer Währungsunion
- Optimale Währungsräume im alten und neuen Umfeld
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Theorie optimaler Währungsräume und untersucht die Kriterien, die die optimale räumliche Ausdehnung eines Gebietes mit einer einheitlichen Währung bestimmen. Sie beleuchtet die Entwicklung dieser Theorie und die zentralen Ansätze von Mundell, McKinnon, Kenen und Ingram sowie deren Kritik.
- Bestimmung einer optimalen räumlichen Ausdehnung für ein Gebiet mit einheitlicher Währung
- Analyse der Kriterien für die Eignung von Gebieten mit eigenen Währungen zur Einführung einer gemeinsamen Währung
- Untersuchung der Kosten und Nutzen einer Währungsunion
- Bewertung der Theorie im Kontext der aktuellen Entwicklungen in der Makroökonomie
- Besprechung von Problemen, Beispielen und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Thematik der optimalen Währungsräume vor und beleuchtet den historischen Kontext ihrer Entstehung. Kapitel 2 definiert den Begriff des Währungsraumes und erörtert die Auswahl eines optimalen Wechselkurssystems im Hinblick auf die effiziente Ressourcenallokation und den Schutz vor externen und internen Schocks. Die Kapitel 3 bis 4 widmen sich den traditionellen Kriterien optimaler Währungsräume, indem sie die Ansätze von Mundell, McKinnon, Kenen und Ingram sowie deren Kritik beleuchten. Es werden sowohl die Modelle als auch deren Vor- und Nachteile analysiert. Schließlich betrachtet das Kapitel 5 die optimalen Währungsräume im alten und neuen Umfeld und diskutiert die Relevanz der Theorie im Kontext aktueller wirtschaftlicher Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Optimale Währungsräume, Wechselkurssystem, Währungsunion, Ressourcenallokation, externe Schocks, interne Schocks, Mundell, McKinnon, Kenen, Ingram, Kosten-Nutzen-Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Theorie optimaler Währungsräume?
Diese Theorie bestimmt die optimale geografische Ausdehnung eines Gebietes, in dem eine einheitliche Währung die wirtschaftliche Effizienz maximiert.
Welche Kriterien nannte Robert Mundell?
Mundell betonte vor allem die Mobilität der Produktionsfaktoren (wie Arbeit), um wirtschaftliche Schocks innerhalb einer Währungsunion ohne Wechselkursanpassungen auszugleichen.
Was sind die Kosten einer Währungsunion?
Der Hauptkostenfaktor ist der Verlust des Wechselkurses als Instrument zur Anpassung bei asymmetrischen wirtschaftlichen Schocks.
Welchen Nutzen bietet eine gemeinsame Währung?
Zu den Vorteilen zählen der Wegfall von Transaktionskosten, eine höhere Preistransparenz und die Eliminierung von Wechselkursrisiken im Handel.
Welche Rolle spielten die Verträge von Maastricht?
Die Verträge von 1991 legten die konkreten Schritte und Kriterien für die monetäre Integration in Europa und die Einführung des Euro fest.
- Arbeit zitieren
- Maja Plasaj (Autor:in), Julijana Franjic (Autor:in), 2004, Theorien optimaler Währungsräume, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38588