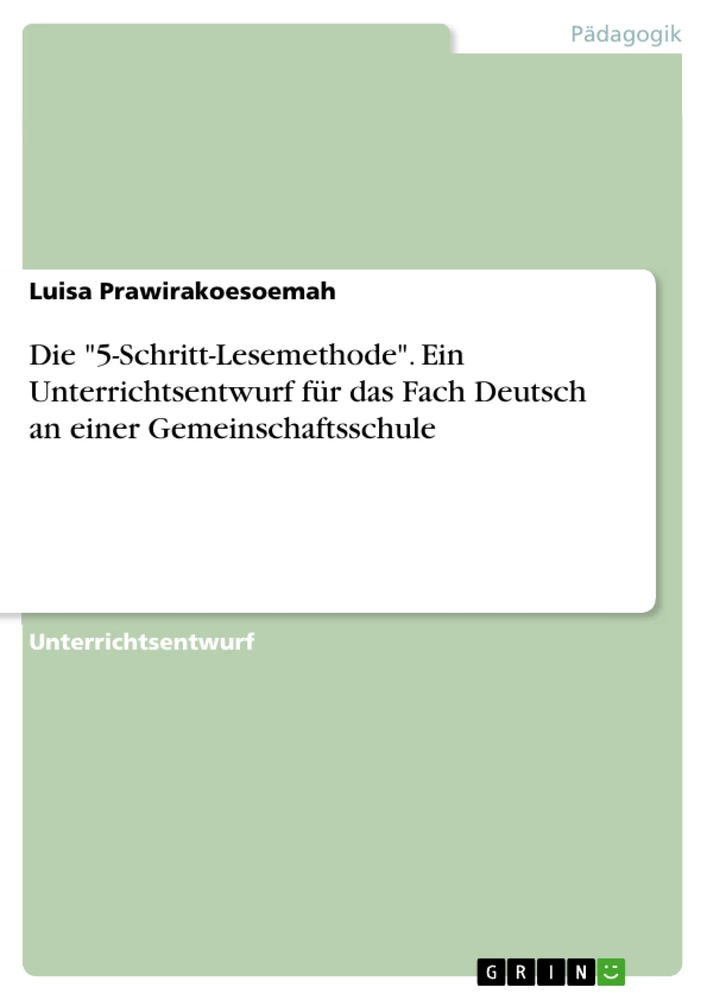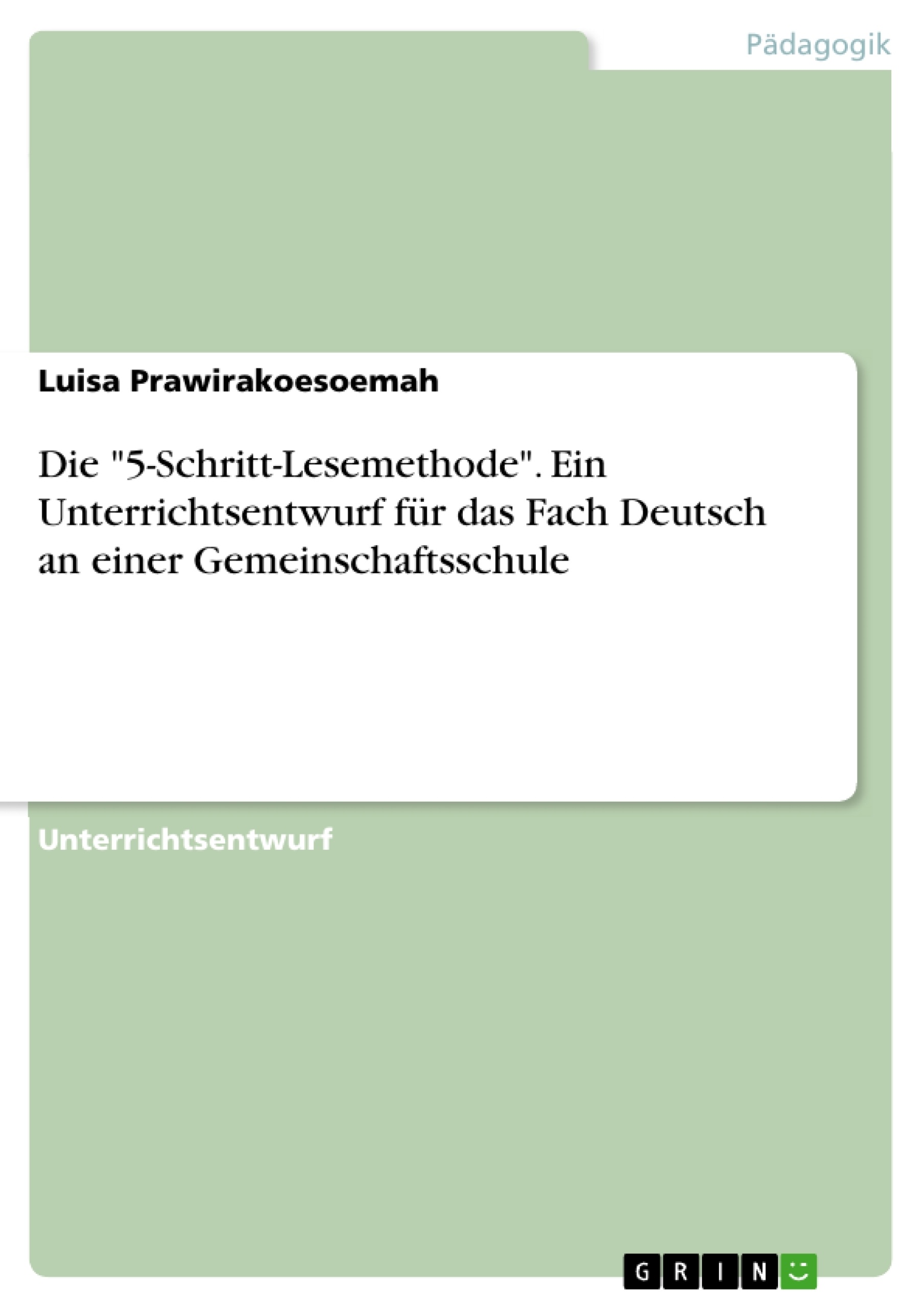Die 5-Schritt-Lesemethode ist eine beliebte Methode zur Erschließung von Sachtexten. Die Kategorie der Sachtexte beinhaltet in der Regel alle nicht-literarischen Texte. Ein Sachtext wird in der Regel dafür benutzt, um dem Leser Informationen und Fakten mitzuteilen. Wir begegnen Sachtexten täglich in unserem Alltag: eine Nachricht in der Morgenzeitung, daneben ein Kommentar zum Thema, das Buch als Publikation, eine spannende Reportage in einer Zeitschrift, ein Interview mit einem bekannten Sänger oder die Inhaltsangabe als Prüfungsaufgabe. Sachtexte sind quasi allgegenwärtig.
Wie bereits deutlich wurde, gibt es verschiedene Arten von Sachtexten, deren Aufbau und Regeln sich voneinander unterscheiden. Sachtexte, denen wir häufig begegnen sind z.B. Nachrichten, Reportagen, Interviews, Porträts, Rezensionen oder Inhaltsangaben. Allen Arten von Sachtexten ist gemeinsam, dass sie sich auf die Realität beziehen, also nicht fiktional sind. Abschließend lässt sich eines sagen: beinahe alle Texte, mit denen wir häufig in Berührung kommen, sind also Sachtexte.
Die Kompetenz, die in dieser Stunde hauptsächlich angebahnt werden soll, ist "Lesen/ Umgang mit Texten". Hierbei geht es um "sinnverstehend lesen", "Inhalte nacherzählen", "Informationen aus kontinuierlichen Texten entnehmen, sie verstehen und wiedergeben" sowie "Methoden der Texterschließung (unterstreichen, markieren, gliedern) anwenden". Dies sind quasi die Inhalte, welche die 5-Schritt-Lesemethode hauptsächlich ausmachen.
Ebenso nennenswert sind gewisse Methoden- und Medienkompetenzen aus dem Bereich "Schreiben". Zu diesen zählen "Informationen auswerten (unterstreichen, Schlüsselbegriffe suchen, Überschriften finden)" und "Verfahren zur Vorbereitung des Schreibens (Cluster und Mindmap) nutzen". Letzteres muss bei der 5-Schritt-Lesemethode jedoch nicht zwingend durchgeführt werden, es soll mehr zur Unterstützung der Lernenden dienen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zur Ausgangslage des Unterrichts
- 1.1 Institutionelle Bedingungen
- 2. Sachanalyse
- 2.1 Die 5-Schritt-Lesemethode zur Erschließung von Sachtexten
- 3. Didaktische Analyse
- 3.1 Bezug zum Bildungsplan
- 3.2 Begründung des Einsatzes der angewandten Verfahren im Unterricht
- 3.3 Einbettung der Lehr-Lernsequenz in die Unterrichtseinheit
- 4. Kompetenzen und Lernziele
- 5. Methodische Analyse
- 5.1 Einstieg
- 5.2 Hinführung zur Arbeitsphase
- 5.3 Arbeitsphase
- 5.4 Plenum / Abschluss
- 6. Anhang
- 6.1 Unterrichtsverlaufsskizze
- 6.2 Material
- 6.2.1 Kurzfilm
- 6.2.2. Alternativer Einstieg
- 6.2.3 Leselotse
- 6.2.4.Text und Arbeitsauftrag Basis-Standard
- 6.2.4.1 Hilfe-Box Basis-Standard
- 6.2.5. Text und Arbeitsauftrag Aufbau-Standard
- 6.2.5.1 Hilfe-Box Aufbau-Standard
- 6.2.6. Text und Arbeitsauftrag Experten-Standard
- 6.2.6.1 Hilfe-Box Experten-Standard
- 6.2.7 Schwierige Wörter
- 6.2.8 Bonus-Aufgaben
- 6.2.9 Bushaltestellen
- 6.2.10 Reflexionssätze
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Unterrichtsentwurf zielt darauf ab, Lernenden die 5-Schritt-Lesemethode näherzubringen und ihre Fähigkeit zur systematischen Analyse von Sachtexten zu verbessern. Der Entwurf beleuchtet die institutionellen Bedingungen an einer Gemeinschaftsschule und zeigt auf, wie die 5-Schritt-Lesemethode in den differenzierten Lernprozess dieser Schulform integriert werden kann.
- Die 5-Schritt-Lesemethode als Instrument zur Lesekompetenzentwicklung
- Differenzierung im Unterricht: Basis-, Aufbau- und Expertenstandard
- Integration der 5-Schritt-Lesemethode in den Unterricht an Gemeinschaftsschulen
- Anwendung der 5-Schritt-Lesemethode bei der Analyse von Sachtexten
- Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch die 5-Schritt-Lesemethode gefördert werden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zur Ausgangslage des Unterrichts
Dieses Kapitel stellt die institutionellen Bedingungen an der XY-Schule vor. Es beschreibt die Schülerschaft, die Organisationsstruktur der Schule und die Besonderheiten der Gemeinschaftsschule, insbesondere die Differenzierung in verschiedene Lernstandards.
2. Sachanalyse
Dieses Kapitel analysiert die 5-Schritt-Lesemethode. Es beschreibt die Entwicklung der Methode und erläutert ihre fünf Schritte sowie deren Anwendung beim Erschließen von Sachtexten.
3. Didaktische Analyse
Dieses Kapitel befasst sich mit der didaktischen Bedeutung der 5-Schritt-Lesemethode. Es beleuchtet den Bezug zum Bildungsplan, begründet den Einsatz der Methode im Unterricht und zeigt auf, wie die Lehr-Lernsequenz in die gesamte Unterrichtseinheit eingebettet wird.
4. Kompetenzen und Lernziele
Dieses Kapitel definiert die Kompetenzen und Lernziele, die durch den Einsatz der 5-Schritt-Lesemethode im Unterricht erreicht werden sollen. Es erläutert die spezifischen Fähigkeiten, die die Lernenden entwickeln sollen.
5. Methodische Analyse
Dieses Kapitel stellt die methodischen Schritte der Unterrichtseinheit dar. Es beschreibt den Einstieg, die Hinführung zur Arbeitsphase, die Arbeitsphase selbst und den Abschluss des Unterrichts.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter des Textes sind: 5-Schritt-Lesemethode, Sachtextanalyse, Lesekompetenz, Differenzierung, Gemeinschaftsschule, Lernstandards, individuelle Förderung, Unterrichtsgestaltung, methodische Analyse.
- Arbeit zitieren
- Luisa Prawirakoesoemah (Autor:in), 2015, Die "5-Schritt-Lesemethode". Ein Unterrichtsentwurf für das Fach Deutsch an einer Gemeinschaftsschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385926