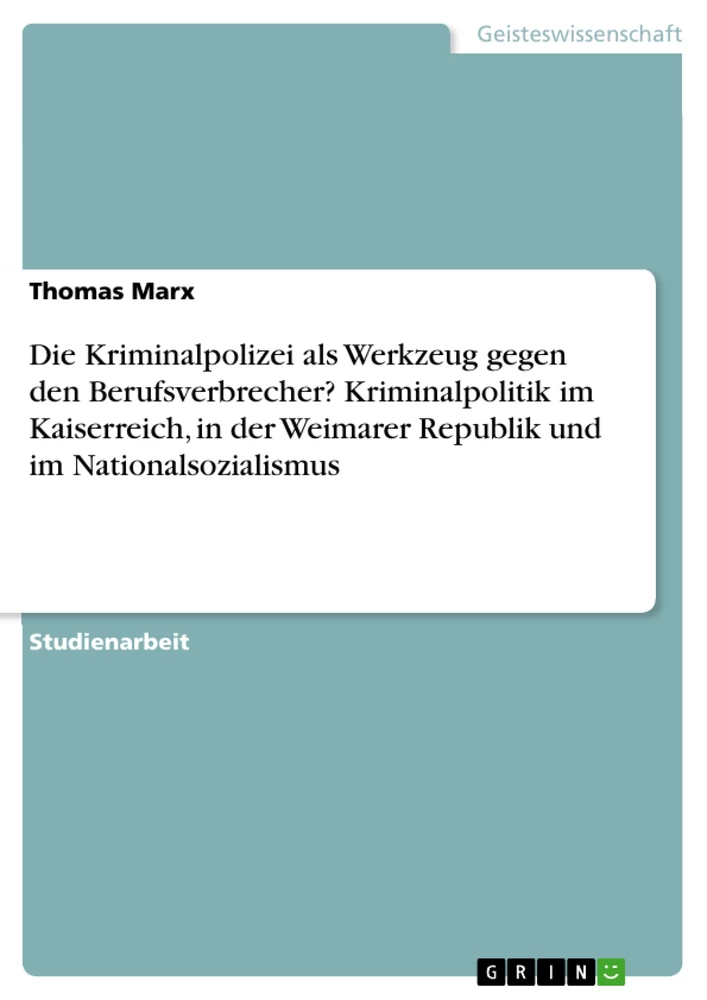In dem Maße wie sich die Gesellschaft verändert, verändern sich auch die kriminogenen Strukturen. Im gleichen Maße verändern sich die Gegenmaßnahmen dazu; nicht immer zeitgleich, scheinbar häufig sogar einen unvermeidlichen Schritt hinterher. Unbezweifelt beeinflussen sich diese zwei Faktoren gegenseitig. Mit der Entwicklung der Großstädte im deutschen Kaiserreich und den zeitgenössisch wahrgenommenen veränderten Kriminalitätsstrukturen bildeten sich auch spezialisierte Gegenparts auf der Seite der Polizei heraus. Das Bild des „Berufsverbrechers“ löste die Debatte aus, wie mit solch unverbesserlichen umzugehen sei. Ein Teil der Ansätze dazu spiegelt sich in der Debatte um eine Strafrechtsreform, die als „Schulenstreit“ bekannt geworden ist.
Das deutsche Kaiserreich, die Weimarer Republik und der Nationalsozialismus bilden dabei ganz eigene gesellschaftliche Rahmen, die den Verlauf dieser dreifaltigen Wechselwirkung individuell beeinflussen. Während man sich im Kaiserreich idealistisch um Reformen bemüht und auf manchen Gebieten völliges Neuland betritt, fallen der jungen deutschen Demokratie zwar viele positive Vermächtnisse kaiserlicher Reformer in den Schoß, aber auch eine schier nicht zu bewältigende Fülle an Konflikten, die der verlorene Krieg zurücklässt. Der Nationalsozialismus indes befeuert die lange gewachsenen Prozesse mit ideologischer Glut und verbrennt dabei viel rechtsstaatliches, dass der neuen Weltordnung der NS-Führung im Weg war.
Diese Arbeit wird die kriminalpolitischen Fragen und Entwicklungen nachverfolgen, die zum einen die Institution „Kriminalpolizei“ betreffen. Zum anderen deren Einfluss auf die Wahrnehmung der Kriminalität als solcher und die Wechselwirkungen zu neuen kriminalpolitischen Konzepten. Diese wiederum sind eng verknüpft mit dem Rahmen des Strafrechts, der den letztlichen juristischen Umgang mit Kriminalität codifiziert. Daher wird das besondere Augenmerk nach der Untersuchung der drei Teilaspekte, auf den Tendenzen liegen, die sich in der Gesamtentwicklung absehen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das deutsche Kaiserreich (1871 - 1918)
- Institutionen
- Berufsverbrecher
- Der Schulenstreit
- Tendenzen
- Die Weimarer Republik (1918 - 1933)
- Institutionen
- Berufsverbrecher
- Der Schulenstreit
- Tendenzen
- Der Nationalsozialismus (1933 - 1945)
- Institutionen
- Berufsverbrecher
- Der Schulenstreit
- Tendenzen
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt die kriminalpolitischen Entwicklungen im deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Der Fokus liegt auf der Institution der Kriminalpolizei, ihrem Einfluss auf die Wahrnehmung von Kriminalität und den Wechselwirkungen mit neuen kriminalpolitischen Konzepten, insbesondere im Kontext des Strafrechts. Die Analyse der drei Zeitperioden dient dazu, Tendenzen in der Gesamtentwicklung aufzuzeigen.
- Entwicklung der Kriminalpolizei als Institution
- Die Wahrnehmung des "Berufsverbrechers" und die Reaktion darauf
- Der "Schulenstreit" und die Debatte um Strafrechtsreformen
- Der Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf Kriminalität und Kriminalpolitik
- Tendenzen in der kriminalpolitischen Entwicklung über die drei Epochen hinweg
Zusammenfassung der Kapitel
Das deutsche Kaiserreich (1871 – 1918): Die Entstehung des deutschen Kaiserreichs führte zur Zentralisierung der Verwaltung, einschließlich der Kriminalpolizei, die sich als eigenständige Behörde herausbildete und begann, sich zu professionalisieren. Die zunehmende Urbanisierung und Industrialisierung brachten neue Kriminalitätsformen hervor, was zur Entwicklung naturwissenschaftlich-technischer Ermittlungsmethoden wie Daktyloskopie und Anthropometrie führte. Die Fokussierung auf "Berufsverbrecher" und die Debatte um den "Schulenstreit" (Strafrechtsreform) spiegeln die Herausforderungen der Zeit wider. Die Kapitel beleuchtet die Anpassung der Kriminalpolizei an die veränderten kriminologischen Anforderungen und die Grenzen der institutionellen Möglichkeiten im Kontext der föderalen Strukturen.
Die Weimarer Republik (1918 - 1933): Dieses Kapitel untersucht die Kriminalpolitik in der Weimarer Republik, die mit den Folgen des Ersten Weltkriegs und gesellschaftlicher Umbrüche konfrontiert war. Die Arbeit analysiert die institutionellen Veränderungen der Kriminalpolizei, die Auseinandersetzung mit dem "Berufsverbrechertum" und die Kontinuitäten und Brüche im "Schulenstreit" im Vergleich zum Kaiserreich. Es wird untersucht, inwieweit die politische Instabilität und die wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Republik die Kriminalität und die kriminalpolitischen Maßnahmen beeinflussten.
Der Nationalsozialismus (1933 - 1945): Dieser Abschnitt analysiert die Instrumentalisierung der Kriminalpolizei im Nationalsozialismus. Es wird untersucht, wie die NS-Ideologie die Kriminalpolitik beeinflusste, welche neuen Formen der Kriminalität auftraten und wie die Bekämpfung von Kriminalität im Kontext der politischen Repression und des Terrors stattfand. Die Arbeit betrachtet die Kontinuitäten und Brüche in Bezug auf die Institutionen, das "Berufsverbrechertum" und den "Schulenstreit" im Vergleich zu den vorherigen Epochen. Der Schwerpunkt liegt hier auf der ideologischen Durchdringung und der instrumentalisierten Nutzung der Kriminalpolizei zur Durchsetzung der NS-Herrschaft.
Schlüsselwörter
Kriminalpolitik, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Kriminalpolizei, Berufsverbrecher, Schulenstreit, Strafrechtsreform, Urbanisierung, Industrialisierung, Kriminalität, Polizeiorganisation, Ermittlungsmethoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema Kriminalpolitik im 20. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die kriminalpolitische Entwicklung im Deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. Der Fokus liegt auf der Institution der Kriminalpolizei, ihrem Einfluss auf die Wahrnehmung von Kriminalität und den Wechselwirkungen mit neuen kriminalpolitischen Konzepten, insbesondere im Kontext des Strafrechts. Die Analyse der drei Zeitperioden dient dazu, Tendenzen in der Gesamtentwicklung aufzuzeigen.
Welche Zeiträume werden untersucht?
Die Arbeit untersucht drei historische Epochen Deutschlands: Das Deutsche Kaiserreich (1871-1918), die Weimarer Republik (1918-1933) und den Nationalsozialismus (1933-1945).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Kriminalpolizei als Institution, der Wahrnehmung des „Berufsverbrechers“, dem „Schulenstreit“ (Debatte um Strafrechtsreformen), dem Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen auf Kriminalität und Kriminalpolitik sowie den Tendenzen in der kriminalpolitischen Entwicklung über die drei Epochen hinweg.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, die sich jeweils mit einer der drei historischen Epochen befassen. Jedes Kapitel untersucht die institutionellen Aspekte der Kriminalpolizei, die Auseinandersetzung mit dem „Berufsverbrechertum“, den „Schulenstreit“ und den Einfluss der jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Umstände auf Kriminalität und Kriminalpolitik. Einleitung und Resümee runden die Arbeit ab.
Was versteht man unter dem „Schulenstreit“?
Der „Schulenstreit“ bezeichnet eine Debatte um Strafrechtsreformen, die in allen drei untersuchten Epochen stattfand und sich mit verschiedenen Konzepten und Ansätzen zur Bekämpfung von Kriminalität auseinandersetzte. Die Arbeit analysiert die Kontinuitäten und Brüche dieser Debatte über die verschiedenen Epochen hinweg.
Welche Rolle spielt der „Berufsverbrecher“ in der Analyse?
Die Wahrnehmung und die Reaktion auf den „Berufsverbrecher“ ist ein zentraler Aspekt der Analyse. Die Arbeit untersucht, wie sich das Verständnis des „Berufsverbrechers“ und die Strategien zu seiner Bekämpfung in den verschiedenen Epochen verändert haben.
Wie wird der Einfluss des Nationalsozialismus auf die Kriminalpolitik dargestellt?
Das Kapitel zum Nationalsozialismus analysiert die Instrumentalisierung der Kriminalpolizei durch das NS-Regime, den Einfluss der NS-Ideologie auf die Kriminalpolitik, neue Formen der Kriminalität im Kontext des Terrors und die Kontinuitäten und Brüche im Vergleich zu den vorherigen Epochen. Der Schwerpunkt liegt auf der ideologischen Durchdringung und der instrumentalisierten Nutzung der Kriminalpolizei zur Durchsetzung der NS-Herrschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Kriminalpolitik, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Kriminalpolizei, Berufsverbrecher, Schulenstreit, Strafrechtsreform, Urbanisierung, Industrialisierung, Kriminalität, Polizeiorganisation, Ermittlungsmethoden.
- Arbeit zitieren
- Thomas Marx (Autor:in), 2017, Die Kriminalpolizei als Werkzeug gegen den Berufsverbrecher? Kriminalpolitik im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386090