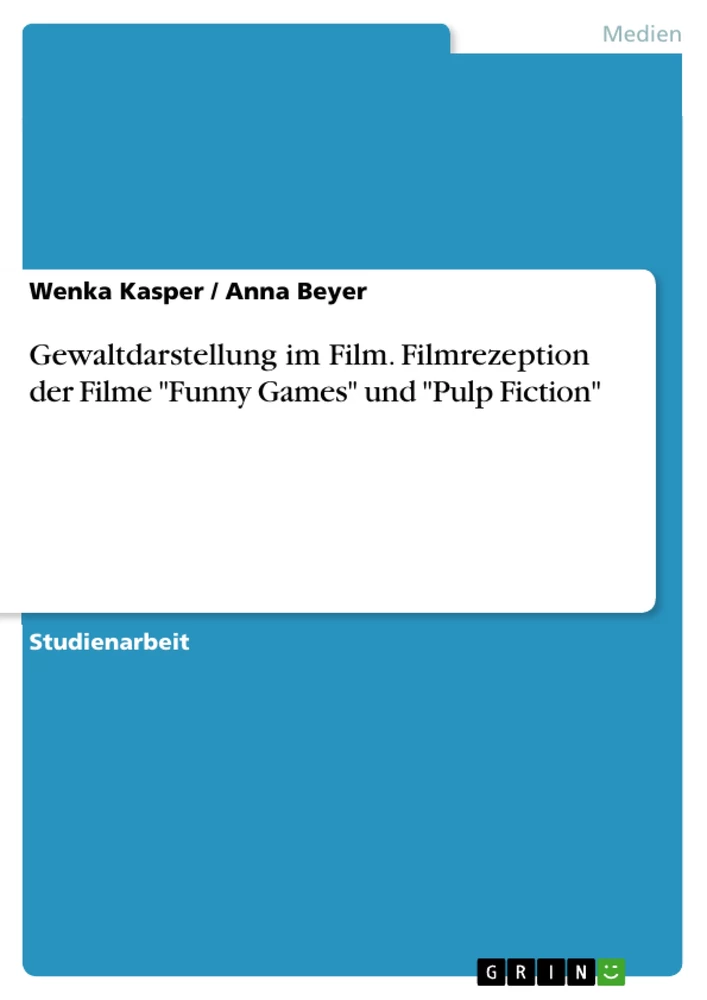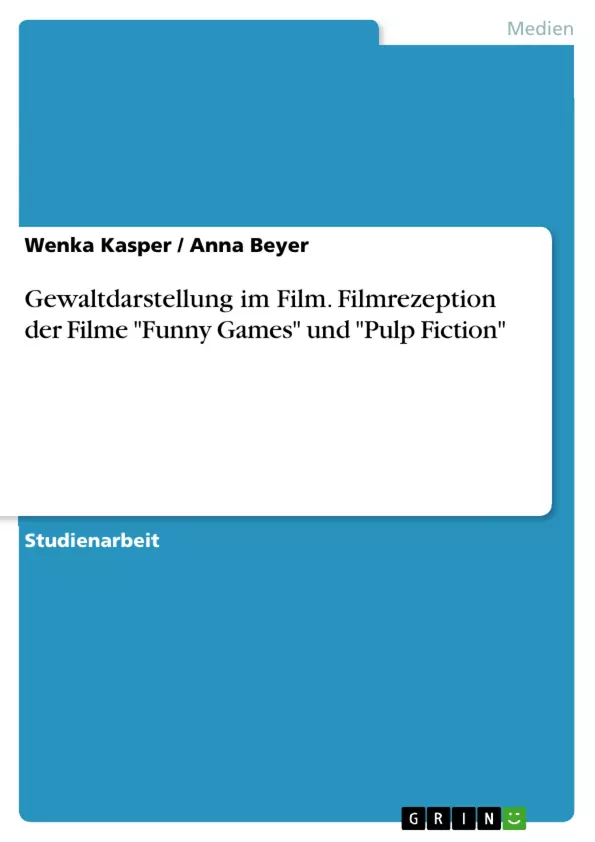Gewalthaltige Medien und ihre Auswirkungen auf den Konsumenten sorgen in der Medienwirkungsforschung und in der Öffentlichkeit stets für Diskussionen. Hierbei werden wiederkehrend Feindrufe laut, die aussagen, dass Gewaltdarstellungen in Medien schädigend auf den Rezipienten wirken. Anhänger dieser These von einem monokausalen Zusammenhang zwischen Gewaltdarstellung und Gewaltanwendung in der Gesellschaft versuchen, diesen immer wieder zu beweisen.
Auf der anderen Seite der Medienwirkungsforschung existieren Standpunkte, die jegliche Wirkung von medialer Gewalt auf den Zuschauer bestreiten. Zwischen diesen beiden Extremen liegen Wissenschaftler, für die eine Beziehung zwischen medialer Gewalt und Zuschauer weder durch einen monokausalen Zusammenhang noch durch Nicht-Wirkung beschrieben werden kann.
Auf diesen Ansatz der Einbeziehung der begleitenden Faktoren des Zuschauers baut auch die folgende Untersuchung auf. Bei Gewaltdarstellungen in Filmen gibt es stets ästhetische Unterschiede in der medialen Bearbeitung und in der Inszenierung von Gewalt. In dieser Arbeit sollen nun im Folgenden die Auswirkungen dieser ästhetischen Unterschiede in fiktiven Filmen auf die Wirkung der Gewalt hin untersucht werden. Hierbei stehen der Rezipient und sein Umgang mit gewalthaltigen Medien im Fokus. Mit Hilfe eines Fragebogens sollen die Erfahrungen der Rezipienten bei dem Betrachten zweier gewalthaltiger Filme, mit verschiedenartiger Gewaltdarstellungen festgestellt und anschließend miteinander verglichen werden. Bei den beiden Filmen handelt es sich zum einen um Michael Hanekes „Funny Games“ aus dem Jahr 1997 und zum anderen um „Pulp Fiction“ von Quentin Tarantino aus dem Jahr 1994, die hochdifferenzierte Gewaltdarstellungen symbolisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Kontext der Untersuchung
- 1.1 Rezeption von gewalthaltigen Filmen
- 1.1.2 Verwendungsweisen von Gewalt in Filmen
- 1.1.3 Wirkung auf den Zuschauer
- 1.2 Forschungsstand
- 1.1 Rezeption von gewalthaltigen Filmen
- 2 Methode
- 2.1 Allgemeines zur Rezeptionsanalyse
- 2.2 Erhebungsmethode: Qualitativer Fragebogen
- 2.3 Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse
- 2.4 Vorgehen
- 2.4.1 Filmauswahl
- 2.4.2 Setting
- 2.4.3 Erhebung der Daten
- 3 Empirische Untersuchung
- 3.1 Beschreibung des Materials
- 3.1.1 Rezipient Tina
- 3.1.2 Rezipient Tim
- 3.1.3 Rezipient Kaya
- 3.1.4 Rezipient Helene
- 3.1.5 Rezipient Hilde
- 3.1.6 Rezipient Lara
- 3.1.7 Rezipient Thomas
- 3.1.8 Rezipient Jan
- 3.1.9 Rezipient Moritz
- 3.1.10 Rezipient Caro
- 3.2 Interpretation des Materials
- 3.2.1 Vergleich der beiden Filme
- 3.2.2 Geschlechtsspezifische Rezeption
- 3.2.3 Auswirkungen des Settings und der Filmroutine
- 3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 3.1 Beschreibung des Materials
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Gewaltdarstellungen in Filmen auf die Rezeption durch den Zuschauer. Im Fokus steht der Vergleich der Rezeptionserfahrungen mit den Filmen „Funny Games“ (Michael Haneke) und „Pulp Fiction“ (Quentin Tarantino) hinsichtlich verschiedener Arten von Gewaltdarstellungen.
- Rezeption von Gewaltdarstellungen im Film
- Vergleich verschiedener Formen von Gewaltdarstellung
- Einfluss von Geschlecht, Alter, Filmroutine und Setting auf die Rezeption
- Die Rolle der Künstlichkeit in der Gewaltdarstellung
- Die Wirkung von Gewaltdarstellung auf den Zuschauer
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Gewaltdarstellung in Filmen und ihre Auswirkungen auf den Konsumenten ein. Es werden unterschiedliche Ansätze zur Wirkung von medialer Gewalt auf den Zuschauer beleuchtet. Die Arbeit fokussiert sich auf die Frage, ob und wie verschiedene Arten der Gewaltdarstellung in Filmen die Rezeption beeinflussen.
Kapitel 1 beschreibt den Kontext der Untersuchung. Es werden grundlegende Erklärungsmuster der Rezeption von gewalthaltigen Filmen und die unterschiedlichen Verwendungsweisen von Gewalt in Filmen diskutiert. Der Forschungsstand zu diesem Thema wird ebenfalls vorgestellt.
Kapitel 2 erläutert die methodische Vorgehensweise der Untersuchung. Hierbei werden die gewählte Erhebungs- und Auswertungsmethode sowie das Vorgehen bei der Datenerhebung erläutert.
Kapitel 3 beschreibt und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die durch Fragebögen erhoben wurden. Es werden die Erfahrungen der Rezipienten mit den beiden ausgewählten Filmen, „Funny Games“ und „Pulp Fiction“, verglichen und die Einflüsse von Geschlecht, Alter, Filmroutine und Setting auf die Rezeption analysiert.
Schlüsselwörter
Gewaltdarstellung, Filmrezeption, Rezeptionsforschung, „Funny Games“, „Pulp Fiction“, Michael Haneke, Quentin Tarantino, Filmroutine, Setting, Geschlecht, Qualitative Inhaltsanalyse, Künstlichkeit, Wirkung, Ästhetik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Filme werden in der Untersuchung zur Gewaltrezeption verglichen?
Die Studie vergleicht Michael Hanekes „Funny Games“ (1997) und Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ (1994), da beide sehr unterschiedliche Formen der Gewaltdarstellung nutzen.
Was ist das Ziel der Arbeit zur Filmrezeption?
Ziel ist es zu untersuchen, wie ästhetische Unterschiede in der Inszenierung von Gewalt die Wirkung auf den Zuschauer beeinflussen.
Welche Faktoren beeinflussen laut der Studie die Wahrnehmung von Gewalt?
Neben der Ästhetik des Films spielen Faktoren wie das Geschlecht, das Alter, die Filmroutine und das Setting des Zuschauers eine entscheidende Rolle.
Welche Forschungsmethode wurde für die Analyse verwendet?
Es wurde eine qualitative Rezeptionsanalyse durchgeführt, bei der Probanden einen Fragebogen ausfüllten, der anschließend mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet wurde.
Was wird unter der „Künstlichkeit“ in der Gewaltdarstellung verstanden?
Die Arbeit untersucht, wie eine stilisierte oder offensichtlich künstliche Darstellung von Gewalt (wie oft bei Tarantino) die emotionale Distanz oder Wirkung beim Rezipienten verändert.
- Citar trabajo
- Wenka Kasper (Autor), Anna Beyer (Autor), 2015, Gewaltdarstellung im Film. Filmrezeption der Filme "Funny Games" und "Pulp Fiction", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386528