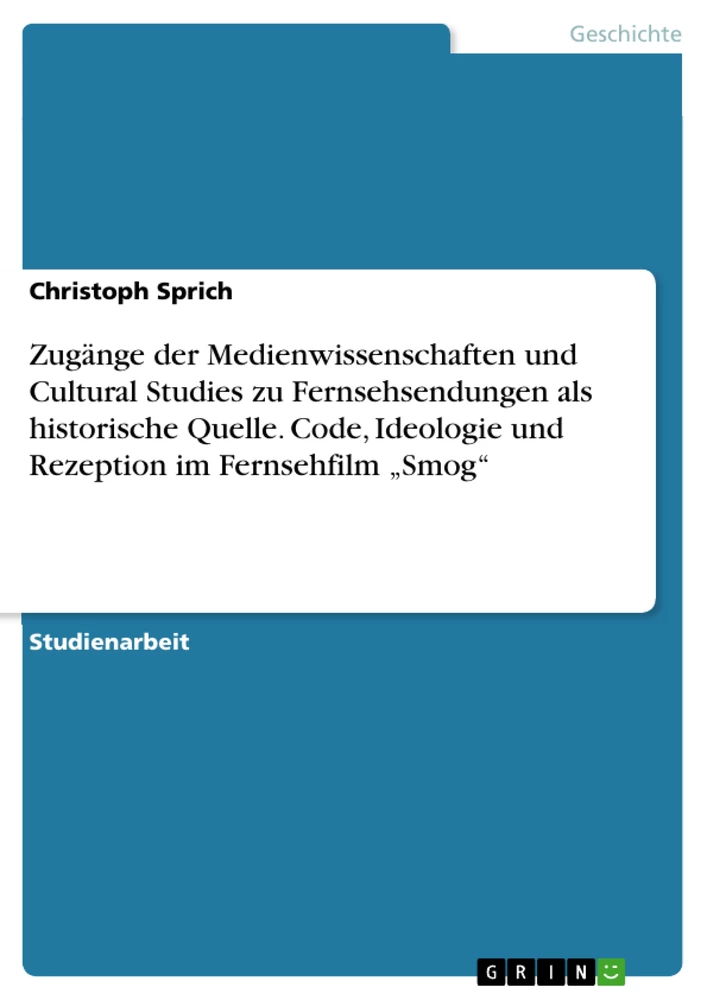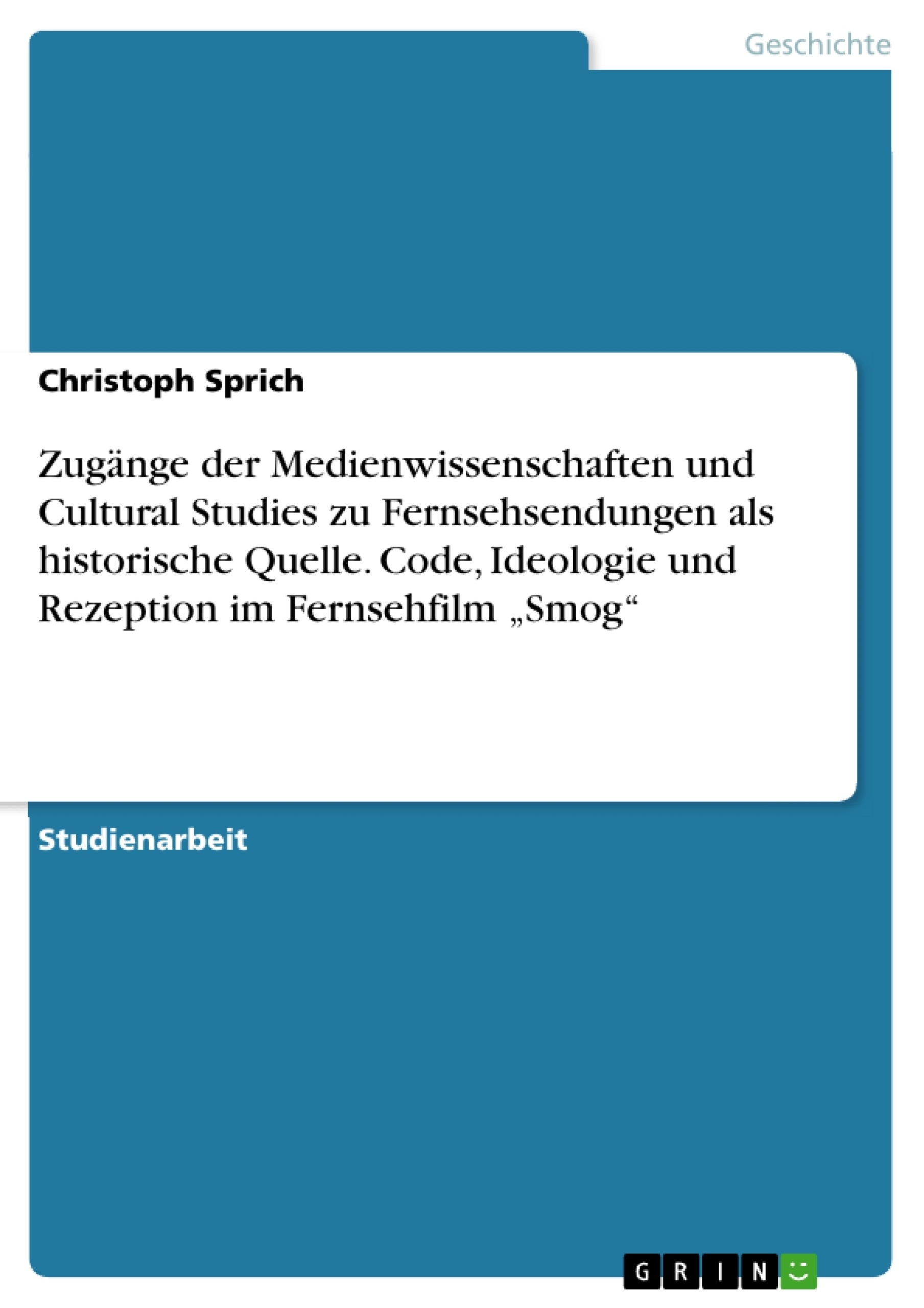Angesichts der zentralen Bedeutung, die audiovisuelle Medien wie der Kinofilm, das Radio und später vor allem das Fernsehen für die Alltagskultur des 20. Jahrhunderts innehaben, wurde in den Kulturwissenschaften ein pictorial turn und später ein iconic turn gefordert: Die in den Geisteswissenschaften vorherrschende Fokussierung auf reine Schriftzeugnisse sollte überwunden werden. Auch in der Geschichtswissenschaft setzt sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass bewegte Bilder einen Quellenwert besitzen.
Die Annahme, dass das Massenmedium Fernsehen (und jedes andere Massenmedium) einem Spiegel der Gesellschaft gleicht, der relevante Themen und zugrunde liegende Einstellungen abbildet, bedarf einer Operationalisierung der medialen Funktion des Mediums. Dasselbe gilt für die Medienwirkungen, also den Wandel von Geisteshaltungen durch Einflussnahme auf die Zuschauer.
Einen Beitrag, um die „Medienblindheit“ der Geschichtswissenschaft zu erhellen, können die Medien- und Kommunikationswissenschaften liefern. Diese Arbeit soll den Film "Smog" unter Zuhilfenahme medienwissenschaftlicher Theorien analysieren. Dabei soll die Quelle umfassend in ihrem zeitgeschichtlichen Hintergrund verortet werden: Als medialer Ausdruck gesellschaftlicher Wahrnehmungsmuster, aber auch als Ergebnis des künstlerischen Schaffens der Beteiligten.
In der Analyse werden u.a. der narrative (Story und Dramaturgie), visuelle (Symbole, Komposition, Schnitt) und sprachliche Code (Dialoge) sowie Rezeption und Ideologischer Code im Film untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medientheorien
- Versuch einer Systematisierung und Vorauswahl, Forschungsüberblick
- Medium und Medialität – Einige Grundannahmen
- (Massen)Medien und Gesellschaft
- Cultural Studies als Medienanalyse
- Stuart Hall: Das „encoding/decoding“-Modell
- John Fiske: Ideologie als Code
- Filme und Fernsehsendungen als Zeichensysteme
- Medientheorien in der geschichtswissenschaftlichen Quellenanalyse: Ein Zwischenfazit
- Medienproduktanalyse: „Smog“
- Der Film: Künstlerische Codes
- Narrativer Code: Story und Dramaturgie
- Visueller Code: Symbole, Komposition, Schnitt
- Auditiver Code: Geräusche und Musik
- Sprachlicher Code: Dialoge
- Rezeptionsmöglichkeiten und Rezeption
- Ideologische Codes und Diskurse im Film
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Fernsehfilm „Smog“ (1972) unter Verwendung medienwissenschaftlicher Theorien, um dessen gesellschaftlichen Kontext und Relevanz zu verstehen. Das primäre Ziel ist eine mentalitätsgeschichtliche Untersuchung, die über die einfache Inhaltsanalyse hinausgeht und die Wechselwirkung zwischen Film, Gesellschaft und Rezeption beleuchtet. Ein weiteres Ziel besteht in der Auswahl und Begründung eines geeigneten medientheoretischen Ansatzes für die historische Analyse von Massenmedieninhalten.
- Analyse des Fernsehfilms „Smog“ als Quelle für die Erforschung gesellschaftlicher Mentalitäten der 1970er Jahre.
- Anwendung und Bewertung verschiedener medientheoretischer Ansätze zur Interpretation audiovisueller Medien.
- Untersuchung der Beziehung zwischen Medienproduktion, gesellschaftlichen Kontextfaktoren und Rezeption.
- Erforschung der Rolle des Fernsehens als Leitmedium und seiner Wirkung auf die Gesellschaft.
- Beurteilung des Quellenwerts von Fernsehproduktionen für die Geschichtswissenschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung legt die Grundlage der Arbeit dar. Sie beschreibt die zunehmende Bedeutung des Fernsehens in den 1970er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland und die wachsende Anerkennung von Film als Quelle in der Geschichtswissenschaft. Es wird das methodologische Problem angesprochen, wie aus filmischen Inhalten Rückschlüsse auf die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Entstehung gezogen werden können. Die Arbeit zielt darauf ab, den Film „Smog“ als Ausdruck gesellschaftlicher Wahrnehmungsmuster und als Medium zu analysieren, das möglicherweise auch auf gesellschaftliche Haltungen einwirkt.
Medientheorien: Dieses Kapitel bietet einen Forschungsüberblick über medientheoretische Ansätze, die für die Analyse von „Smog“ relevant sind. Es systematisiert und wählt geeignete Theorien aus, die das Verhältnis von Medium und gesellschaftlichen Aspekten beleuchten. Das Kapitel diskutiert verschiedene Ansätze aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft, um einen geeigneten Rahmen für die Analyse des Films zu schaffen.
Medienproduktanalyse: „Smog“: Dieses Kapitel analysiert den Film „Smog“ selbst. Es untersucht verschiedene künstlerische Codes des Films, darunter den narrativen, visuellen, auditiven und sprachlichen Code, und analysiert wie diese Codes Rezeptionsmöglichkeiten und ideologische Aspekte vermitteln. Die Analyse integriert die vorangegangenen Kapitel zur Medientheorie, um die gesellschaftliche Relevanz des Films zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Smog, Fernsehfilm, Medienwissenschaft, Cultural Studies, Ideologie, Rezeption, Mentalitätsgeschichte, 1970er Jahre, Bundesrepublik Deutschland, Massenmedien, Quellenanalyse, Wolfgang Petersen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Fernsehfilms "Smog"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Fernsehfilm "Smog" (1972) unter Verwendung medienwissenschaftlicher Theorien, um dessen gesellschaftlichen Kontext und Relevanz zu verstehen. Es geht um eine mentalitätsgeschichtliche Untersuchung, die die Wechselwirkung zwischen Film, Gesellschaft und Rezeption beleuchtet und einen geeigneten medientheoretischen Ansatz für die historische Analyse von Massenmedieninhalten findet.
Welche Ziele werden verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, "Smog" als Quelle für die Erforschung gesellschaftlicher Mentalitäten der 1970er Jahre zu analysieren, verschiedene medientheoretische Ansätze zur Interpretation audiovisueller Medien anzuwenden und zu bewerten, die Beziehung zwischen Medienproduktion, gesellschaftlichen Kontextfaktoren und Rezeption zu untersuchen, die Rolle des Fernsehens als Leitmedium und seine Wirkung auf die Gesellschaft zu erforschen und den Quellenwert von Fernsehproduktionen für die Geschichtswissenschaft zu beurteilen.
Welche Medientheorien werden verwendet?
Die Arbeit bietet einen Forschungsüberblick über relevante medientheoretische Ansätze, systematisiert und wählt geeignete Theorien aus, die das Verhältnis von Medium und gesellschaftlichen Aspekten beleuchten. Es werden verschiedene Ansätze aus der Kommunikations- und Medienwissenschaft diskutiert, inklusive Ansätzen von Stuart Hall ("encoding/decoding"-Modell) und John Fiske (Ideologie als Code).
Wie wird der Film "Smog" analysiert?
Die Analyse des Films "Smog" untersucht verschiedene künstlerische Codes: den narrativen Code (Story und Dramaturgie), den visuellen Code (Symbole, Komposition, Schnitt), den auditiven Code (Geräusche und Musik) und den sprachlichen Code (Dialoge). Es wird analysiert, wie diese Codes Rezeptionsmöglichkeiten und ideologische Aspekte vermitteln und die gesellschaftliche Relevanz des Films beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Smog, Fernsehfilm, Medienwissenschaft, Cultural Studies, Ideologie, Rezeption, Mentalitätsgeschichte, 1970er Jahre, Bundesrepublik Deutschland, Massenmedien, Quellenanalyse, Wolfgang Petersen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Medientheorien (mit Unterkapiteln zu verschiedenen Ansätzen und dem Film als Zeichensystem), ein Kapitel zur Medienproduktanalyse von "Smog" (mit detaillierter Analyse der künstlerischen Codes und der Rezeption), und ein Fazit.
Welche methodologische Herausforderung wird angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die methodologische Herausforderung, aus filmischen Inhalten Rückschlüsse auf die gesellschaftlichen Bedingungen ihrer Entstehung zu ziehen und den Film "Smog" sowohl als Ausdruck gesellschaftlicher Wahrnehmungsmuster als auch als Medium zu analysieren, das möglicherweise auf gesellschaftliche Haltungen einwirkt.
- Quote paper
- M.A. Christoph Sprich (Author), 2011, Zugänge der Medienwissenschaften und Cultural Studies zu Fernsehsendungen als historische Quelle. Code, Ideologie und Rezeption im Fernsehfilm „Smog“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386538