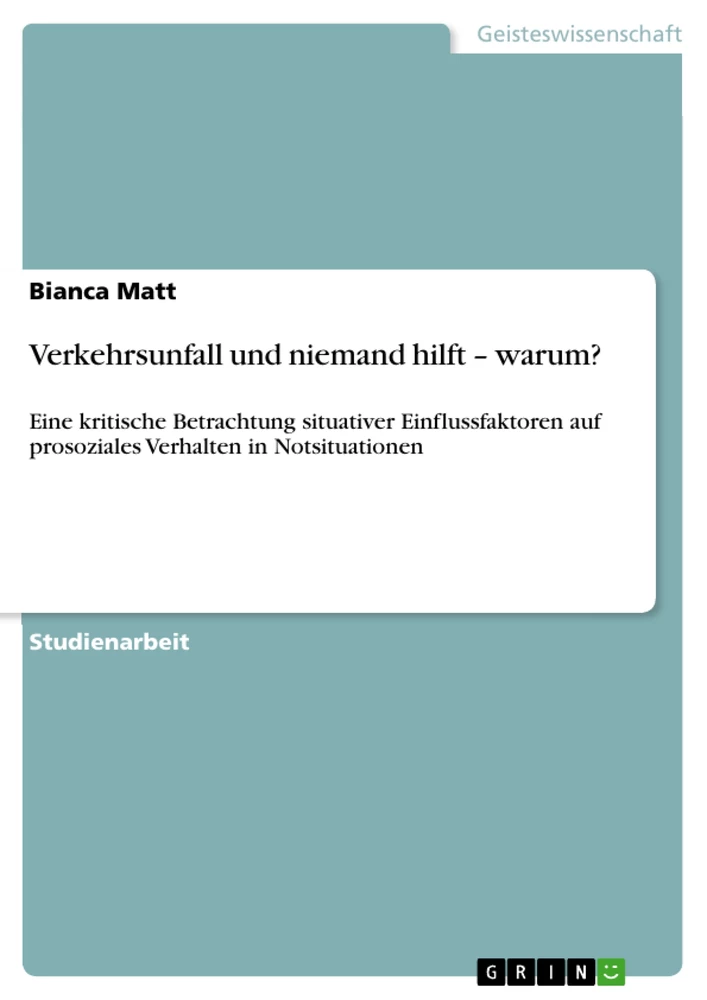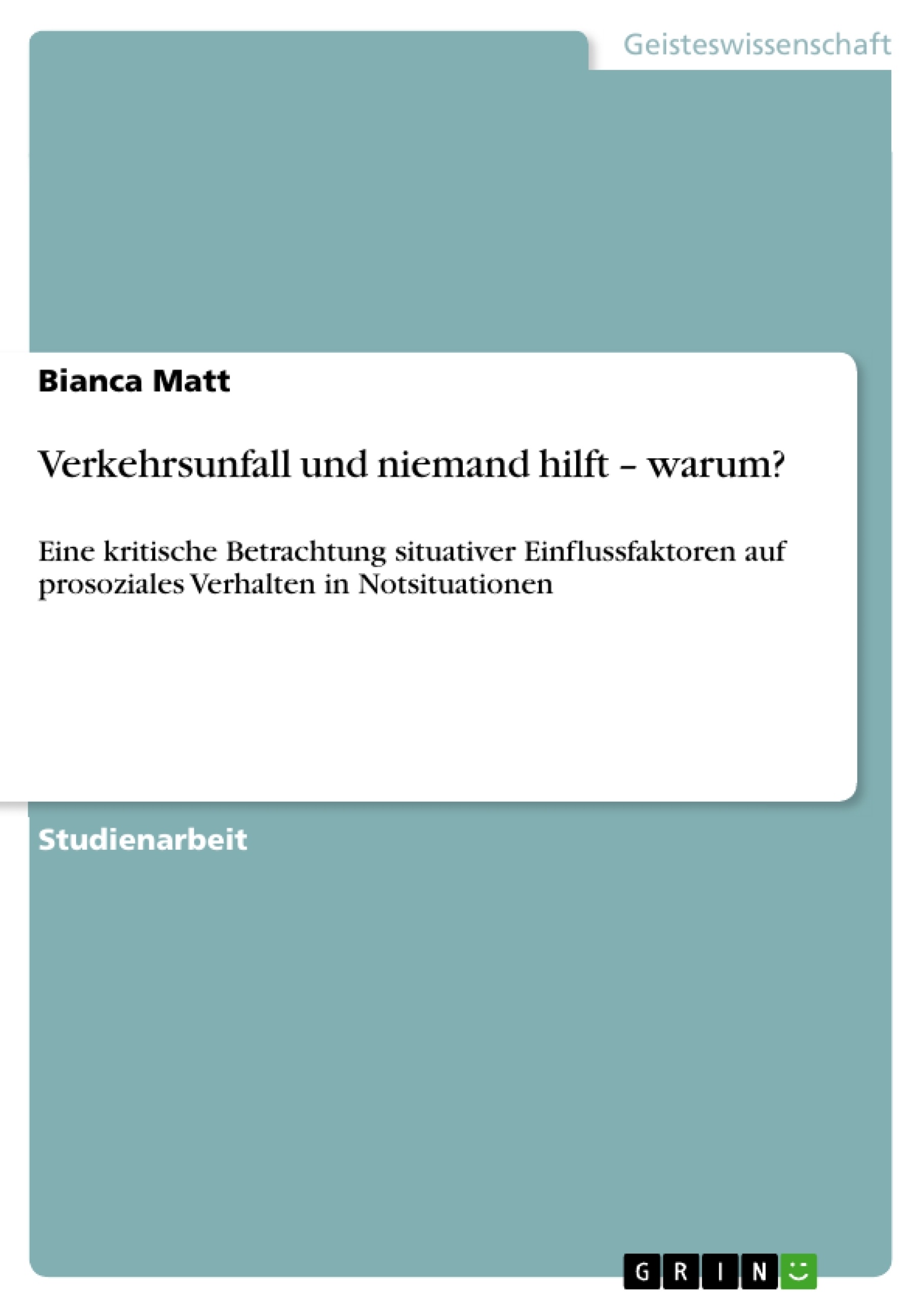Immer wieder passieren zahlreiche Verkehrsunfälle auf stark befahrenen Straßen, gewaltgeladene Auseinandersetzungen werden inmitten großer Menschenmengen ausgefochten oder man beobachtet einen älteren Mann im Supermarkt, der sich schmerzerfüllt an die Brust greift – auf den ersten Blick scheinen all diese Notsituationen willkürlich gewählt und ganz unterschiedlich zu sein. Doch was sie alle miteinander verbindet ist die Reaktion der Zeuginnen und Zeugen, die erschreckenderweise in vielen Fällen sehr passiv ausfällt. Die Medien berichten regelmäßig von derartigen Vorfällen, in denen eine notwendige Hilfeleistung nicht erfolgt ist und damit zu einer wesentlichen Verschlimmerung der Situation der oder des Hilfebedürftigen geführt hat. Dabei schüttelt man als Rezipientin oder Rezipient zumeist nur unverständnisvoll den Kopf und fragt sich, was für ein kaltherziger Mensch dies doch gewesen sein muss, der nicht geholfen hat. Reflektiert man hingegen das eigene Verhalten in bereits erlebten Notsituationen, so hat man nach kurzer Bedenkzeit vielleicht einen persönlichen Vorfall vor Augen, bei dem man im Nachhinein lieber anders gehandelt und zumindest Hilfe angeboten hätte. Als kaltherzig und egoistisch würde sich deshalb jedoch noch niemand bezeichnen.
Doch was ist es dann, was uns Menschen in Notsituationen manchmal dazu treibt, nicht zu helfen? Neben einer Reihe von entwicklungspsychologischen und persönlichen Gründen, auf die ich im Rahmen dieser Seminararbeit nicht genauer eingehen werde, gibt es entscheidende situative Einflussfaktoren. Im Folgenden werde ich diese sowie die Motive des Helfens umfassend anhand eigener Praxisbeispiele und Experimente erläutern sowie einige der dargestellten Theorien aus meiner eigenen Sicht kritisch hinterfragen. Ergänzt wird die theoretisch-praktische Betrachtung durch eine eigens durchgeführte empirische Untersuchung in Form eines anonymen Online-Fragebogens, den 422 Personen ausgefüllt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wodurch kennzeichnet sich eine akute Notsituation?
- Hilfreiches Verhalten, prosoziales Verhalten, Altruismus - wo liegen die Grenzen?
- Wie kommt es zu einer Hilfeleistung und wie kann sie gehemmt werden?
- Bemerken des Notfalls
- Reizüberflutung
- Kognitive Eingeschränktheit und „Tunnelblick“
- Die Situation als Notfall interpretieren
- Uneindeutigkeit einer Situation
- Bystander-Effekt I: Pluralistische Ignoranz
- Verantwortung übernehmen
- Bystander-Effekt II: Verantwortungsdiffusion
- Bystander-Effekt III: Bewertungsangst
- Möglichkeiten der Hilfe
- Spezifische Kenntnisse in Notsituationen
- Subjektives Kompetenzgefühl
- Hilfeleistung
- Arousal/Cost-Reward-Modell nach Piliavin et al. (1981)
- Einfluss von Stimmungen und Gefühlen
- Affekt-Priming-Modell
- Affekt-als-Information-Modell
- Schuldgefühle
- Inneres Stimmungsmanagement
- Wer trägt die Schuld an der Not?
- Motive des Helfens – gibt es wahren Altruismus?
- Empathie-Altruismus-Hypothese
- Reziprozität von prosozialem Verhalten und menschlichem Wohlbefinden
- Empirische Untersuchung zu prosozialem Verhalten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert situative Einflussfaktoren auf prosoziales Verhalten in Notsituationen, mit dem Ziel, die Gründe für unterlassene Hilfeleistung zu verstehen.
- Die Bedeutung von situationalen Einflüssen auf prosoziales Verhalten
- Die Hemmnisse und förderlichen Faktoren für Hilfeleistung in Notsituationen
- Die Relevanz von Wahrnehmung, Interpretation und Verantwortung in Notsituationen
- Die Rolle von Empathie und Altruismus im Kontext von Hilfeleistung
- Die Untersuchung der Auswirkungen von Stimmung und Emotionen auf prosoziales Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt das Thema der unterlassenen Hilfeleistung in Notsituationen vor und skizziert die Relevanz des Themas. Sie führt auch die eigene empirische Untersuchung ein, die in dieser Arbeit vorgestellt wird.
- Kapitel 2 definiert den Begriff der „akuten Notsituation“ und benennt Merkmale, die diese Situation charakterisieren.
- Kapitel 3 differenziert zwischen verschiedenen Formen von Hilfeverhalten, darunter hilfreiches Verhalten, prosoziales Verhalten und Altruismus, und beleuchtet die Grenzen dieser Konzepte.
- Kapitel 4 erörtert die verschiedenen Stufen, die zu einer Hilfeleistung führen können. Dabei werden die Stadien des Bemerkens des Notfalls, die Interpretation der Situation als Notfall, die Übernahme von Verantwortung und die Möglichkeiten der Hilfeleistung detailliert beleuchtet. Der Bystander-Effekt und seine verschiedenen Aspekte werden ebenfalls erörtert.
- Kapitel 5 untersucht den Einfluss von Stimmungen und Gefühlen auf prosoziales Verhalten. Es werden verschiedene Modelle wie das Affekt-Priming-Modell, das Affekt-als-Information-Modell und die Rolle von Schuldgefühlen vorgestellt.
- Kapitel 6 analysiert die Frage der Schuldzuweisung in Notsituationen und hinterfragt, wer für die Notlage verantwortlich gemacht werden kann.
- Kapitel 7 befasst sich mit den Motiven des Helfens und der Frage, ob es tatsächlich „wahren Altruismus“ gibt. Die Empathie-Altruismus-Hypothese und der Zusammenhang zwischen prosozialem Verhalten und menschlichem Wohlbefinden werden diskutiert.
- Kapitel 8 präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten empirischen Untersuchung zu prosozialem Verhalten. Diese Untersuchung befasst sich mit den Ursachen für unterlassene Hilfeleistung bei potenziellen Helferinnen und Helfern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen prosoziales Verhalten, Hilfeleistung, Notsituationen, Bystander-Effekt, Empathie, Altruismus, Schuldgefühle, Stimmungsmanagement, empirische Untersuchung, Online-Fragebogen und Unterlassene Hilfeleistung.
Häufig gestellte Fragen
Warum helfen Menschen in Notsituationen oft nicht?
Situative Faktoren wie Reizüberflutung, Verantwortungsdiffusion und der Bystander-Effekt können die Hilfeleistung hemmen.
Was ist der Bystander-Effekt?
Es ist das Phänomen, dass die Wahrscheinlichkeit für Hilfe sinkt, je mehr Zeugen anwesend sind, da jeder die Verantwortung auf die anderen schiebt (Verantwortungsdiffusion).
Was bedeutet "Pluralistische Ignoranz"?
Zeugen orientieren sich am Verhalten anderer. Wenn niemand eingreift, interpretieren alle die Situation fälschlicherweise als harmlos.
Gibt es "wahren Altruismus"?
Die Arbeit diskutiert die Empathie-Altruismus-Hypothese und fragt, ob Hilfe immer auch dem eigenen Wohlbefinden oder dem Abbau von Schuldgefühlen dient.
Welchen Einfluss hat die eigene Stimmung auf das Helfen?
Positive Stimmung kann die Hilfsbereitschaft erhöhen, aber auch Schuldgefühle oder das Bedürfnis nach innerem Stimmungsmanagement motivieren prosoziales Verhalten.
- Quote paper
- Bianca Matt (Author), 2017, Verkehrsunfall und niemand hilft – warum?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386618