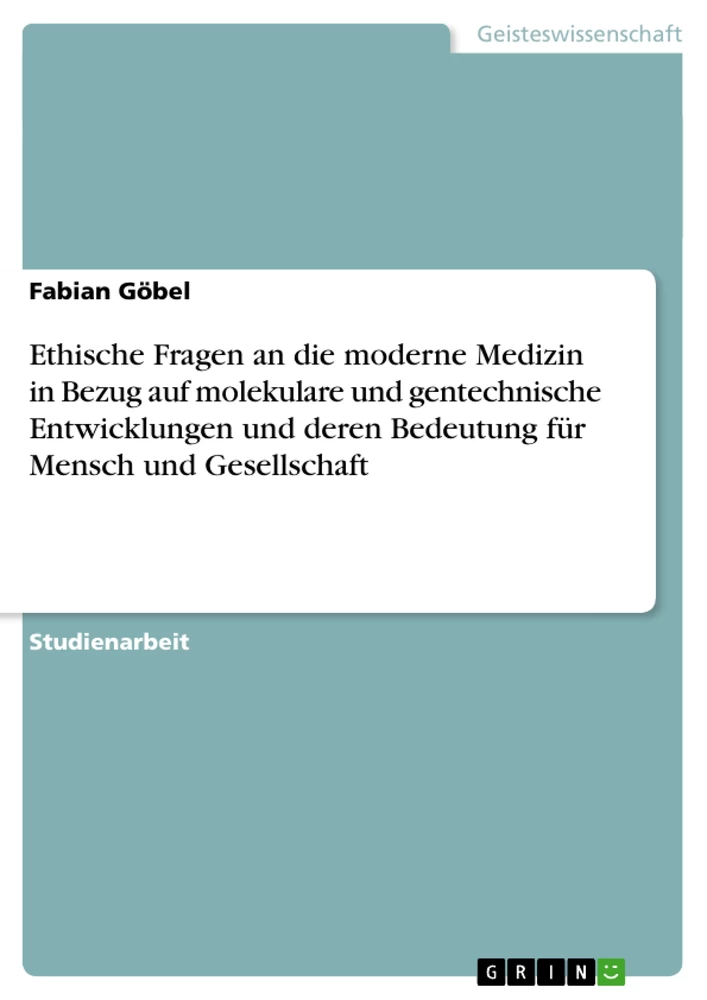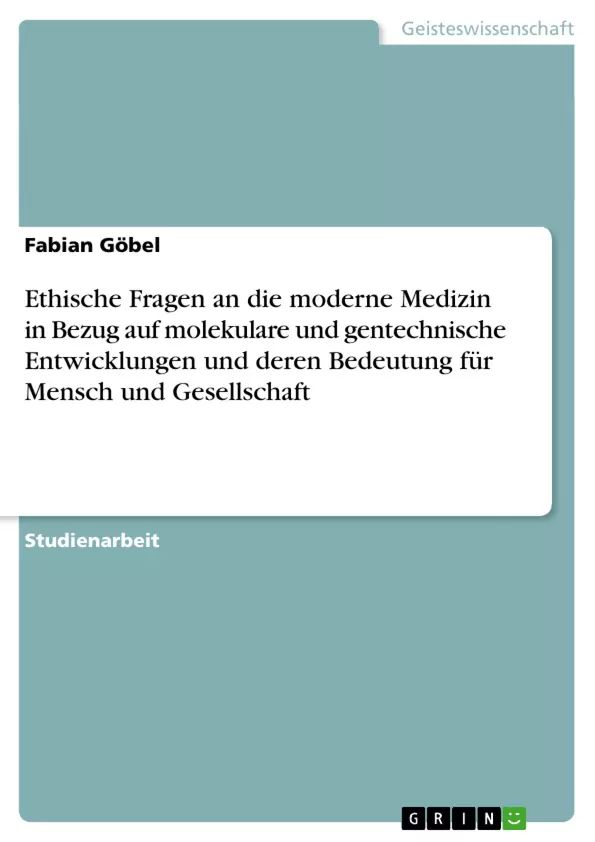[...] Gibt es ein Lebensrecht für alle Menschen und muss dieses begründbar sein? Gibt es ein „lebenswertes“ und ein „lebensunwertes“ Leben? Worüber definiert sich der Wert eines Menschen? Diese Fragen, auf die die Antworten unserem allgemeinen Menschenbild und dem in Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland statuierten Grundsatz folgend keiner langen Diskussion bedürften, sind durch verschiedene Entwicklungen in jüngster Vergangenheit in den Fokus des allgemeinen Interesses geraten und sind so selbstverständlich wie angenommen nicht mehr zu beantworten. Zu diesen Entwicklungen gehört unter anderem der Fortschritt im Bereich der molekularen Medizin und der Gentechnologie, durch den die wesentlichen Kernaussagen und ethischen und moralischen Vorstellungen von Menschenwürde und Menschsein in Frage gestellt werden. Die Hoffnungen, die durch die neuen medizinischen Möglichkeiten entstanden, nämlich das Heilen von bisher unheilbaren Krankheiten oder die gezielte Prävention von Gebrechen durch genetische Eingriffe, stehen in einem krassen Gegensatz zu den potentiellen Gefahren dieser Technik. Dies sind die durch die Optimierung möglich werdenden Einstellungen der Gesellschaft zu den mit Mängeln Behafteten, die durch den neuen Anspruch der Gefahr der Selektion unterliegen. Anders ausgedrückt: Der „perfektionierte“ Mensch kann als Maßstab die Existenz des „fehlerhaften“ Menschen bedrohen, dessen Sein als „vermeidbarer Schaden“ bewertet wird. Es geht hierbei also nicht um eine bloße Vor- oder Nachteilsdiskussion für bestimmte Personen, sondern tatsächlich um Leben- oder Sterbenlassen. Im folgenden werde ich versuchen, die Prozesse, die diese Entwicklung bedingen, herauszuarbeiten und ihre Ursachen anhand der Problematik der Eugenik, also der „(...) praktische(n) Anwendung der Erkenntnisse der Humangenetik,(...)“2 in Bezug auf Menschen mit Behinderung zu untersuchen, da gerade diese Menschen von den Folgen der fortschreitenden Biomedizin betroffen sind. Der Fokus wird dabei auch auf dem eigentlichen Zweck der Technik liegen, da diese nie wertfrei sein kann und eine von Menschen entwickelte Technik immer - egal, ob es sich dabei um die Erfindung des Rades oder der Atombombe handelt - ein mit einem bestimmten Wert verbundenes Phänomen ist. Im Bereich des medizinischen Fortschritts heißt die Frage also: Handelt es sich bei technischen Möglichkeiten um eine Art der pränatalen Selektion oder eine Prävention von Behinderung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das „gute Leben“?
- Der Begriff der „Würde des Menschen“
- Die Problematik des moralischen Dilemmas
- Selbstbild und Anspruch der Medizin
- Die „Einbecker Empfehlungen“
- Möglichkeiten der pränatale Diagnostiken
- Ultraschalluntersuchung
- Fruchtwasseruntersuchung
- Präimplantationsdiagnostik
- Abtreibung als Folge
- „Neugeboreneneuthanasie“
- Die,,Praktische Ethik“ Peter Singers
- Negative Eugenik - Positive Eugenik - „Liberale Eugenik“?
- Schlussgedanken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die ethischen Fragen, die sich aus dem Fortschritt der molekularen Medizin und Gentechnologie im Zusammenhang mit der Prävention von Behinderung stellen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Optimierung des Menschen durch genetische Eingriffe ergeben, und stellt diese dem traditionellen Verständnis von Menschenwürde und Menschsein gegenüber.
- Der Begriff der Menschenwürde und seine Bedeutung für die Frage nach dem Lebensrecht
- Die ethischen Dilemmata, die mit pränatalen Diagnostiken und Abtreibungen verbunden sind
- Die Rolle der Eugenik in der Debatte um die Prävention von Behinderung
- Die Möglichkeiten und Gefahren der genetischen Prävention
- Die Frage nach dem „guten Leben“ und die Bedeutung der Ethik in der Medizin
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit dar, welche sich mit den ethischen Implikationen des medizinischen Fortschritts im Bereich der Pränataldiagnostik und Gentechnik befasst.
- Kapitel 2 diskutiert den Begriff des „guten Lebens“ und die Bedeutung ethischer Überlegungen im Kontext der westlichen Zivilisation. Es werden die Grundbedingungen für ein „gutes Leben“ erläutert und die Rolle der Ethik in der Frage nach dem richtigen Handeln herausgestellt.
- Kapitel 3 beleuchtet den Begriff der „Würde des Menschen“ und seine Bedeutung für den Schutz des menschlichen Lebens. Es wird die Frage nach dem Beginn der Menschenwürde und dem Schutz des ungeborenen Lebens erörtert.
- Kapitel 4 untersucht die Problematik des moralischen Dilemmas, das in der Debatte um Pränataldiagnostik und Abtreibung auftritt. Es werden die ethischen Konflikte und die Schwierigkeit der Entscheidungsfindung in solchen Situationen dargestellt.
- Kapitel 5 befasst sich mit dem Selbstbild und Anspruch der Medizin im Kontext der pränatalen Diagnostik und den ethischen Leitlinien, die in diesem Bereich gelten.
- Kapitel 6 beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten der pränatalen Diagnostik, wie Ultraschalluntersuchung, Fruchtwasseruntersuchung und Präimplantationsdiagnostik. Es wird auch die Problematik der Abtreibung als Folge dieser Diagnostik sowie das Konzept der „Neugeboreneneuthanasie“ behandelt.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit befasst sich mit den Themen Prävention von Behinderung, Menschenwürde, pränatale Diagnostik, Abtreibung, Eugenik, Gentechnologie, Biomedizin, ethische Fragen, moralisches Dilemma, „gutes Leben“ und Selbstbild der Medizin.
Häufig gestellte Fragen
Welche ethischen Fragen wirft die moderne Gentechnik auf?
Zentrale Fragen betreffen das Lebensrecht behinderter Menschen, die Definition von Menschenwürde und die Gefahr einer gesellschaftlichen Selektion durch pränatale Optimierung.
Was versteht man unter „liberaler Eugenik“?
Im Gegensatz zur staatlich verordneten Eugenik bezeichnet dies die individuelle Entscheidung der Eltern, genetische Techniken zur Auswahl oder „Verbesserung“ ihres Nachwuchses zu nutzen.
Was ist die Problematik der Präimplantationsdiagnostik (PID)?
Die PID ermöglicht die Untersuchung von Embryonen vor dem Einsetzen in die Gebärmutter, was die ethische Frage aufwirft, ob Leben nach Qualitätskriterien aussortiert werden darf.
Welche Position vertritt Peter Singer in der Debatte?
Singer vertritt eine utilitaristische „Praktische Ethik“, die den Personenstatus und das Lebensrecht kritisch hinterfragt, was in Deutschland sehr kontrovers diskutiert wird.
Ist die Prävention von Behinderung eine Form der Selektion?
Die Arbeit untersucht genau dieses Dilemma: Ob medizinische Technik das Ziel hat, Leiden zu verhindern oder ob sie ungewollt zur Diskriminierung und Ausgrenzung „fehlerhaften“ Lebens führt.
- Quote paper
- Fabian Göbel (Author), 2004, Ethische Fragen an die moderne Medizin in Bezug auf molekulare und gentechnische Entwicklungen und deren Bedeutung für Mensch und Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38665