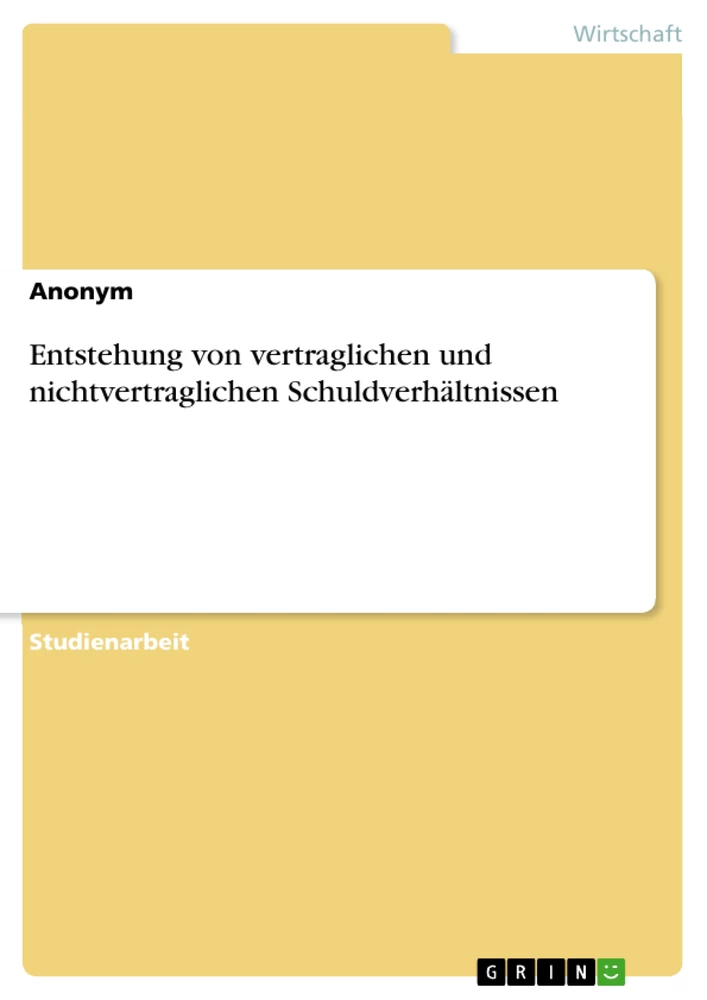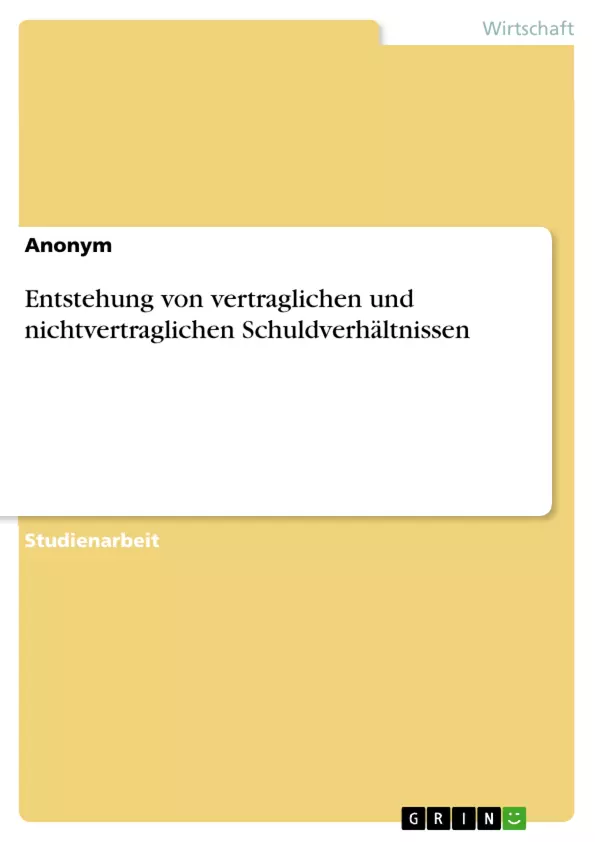Die Ausarbeitung untersucht, aus welchen Gründen Schuldverhältnisse entstehen und wie diese sich im Einzelnen unterscheiden lassen. Außerdem werden die Voraussetzungen der Tatbestandsmerkmale der jeweiligen Normen bis zum Entstehen der Schuldverhältnisse geprüft.
Täglich geraten Menschen in Situationen, in denen sie Gerechtigkeit erwarten. Das Zusammenleben in einer Gesellschaft erfordert die Festlegung bestimmter Regeln, die ein faires Handeln für alle ermöglichen und schützen. Das besondere Strafrecht beinhaltet einen großen Teil dieser Regeln.
Das tägliche Wirtschafts- und Geschäftsleben ist kaum vorstellbar ohne Regelungen des Schuldrechts. In vielen Fällen stellt sich die Frage nach Ansprüchen und deren Begründung. Die meisten zivilrechtlichen Ansprüche entstehen aufgrund von Schuldverhältnissen. Durch ein Schuldverhältnis entstehen Leistungspflichten für den Schuldner und Forderungsrechte für den Gläubiger.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Entstehung und Einteilung der Schuldverhältnisse
- I. Entstehung durch Rechtsgeschäft
- 1. Entstehung durch Vertrag
- a) Gegenseitige Verträge
- b) Einseitig verpflichtende Verträge
- 2. Einseitiges Rechtsgeschäft
- II. Entstehung durch Gesetz
- 1. Allgemeines
- 2. Unerlaubte Handlung nach §§ 823 ff. BGB
- 3. Ungerechtfertigte Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB
- a) Leistungskondiktionen
- b) Nichtleistungskondiktionen
- 4. Geschäftsführung ohne Auftrag nach §§ 677-687 BGB
- 5. Culpa in contrahendo nach § 311 Abs. 2 BGB
- a) Aufnahme von Vertragsverhandlungen gem. § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB
- b) Anbahnung eines Vertrages gem. § 311 Abs. 2 Nr. 2 BGB
- c) Ähnliche geschäftliche Kontakte gem. § 311 Abs. 2 Nr. 3 BGB
- C. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Entstehung von vertraglichen und nichtvertraglichen Schuldverhältnissen im deutschen Recht. Es werden die verschiedenen Entstehungsgründe analysiert und die jeweiligen Voraussetzungen für das Zustandekommen solcher Schuldverhältnisse dargelegt. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede zwischen den verschiedenen Kategorien und prüft die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale der relevanten Normen.
- Entstehung von Schuldverhältnissen durch Rechtsgeschäft (Vertrag und einseitiges Rechtsgeschäft)
- Entstehung von Schuldverhältnissen durch Gesetz (unerlaubte Handlung, ungerechtfertigte Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag, culpa in contrahendo)
- Unterscheidung zwischen vertraglichen und nichtvertraglichen Schuldverhältnissen
- Analyse der Voraussetzungen und Tatbestandsmerkmale der jeweiligen Rechtsnormen
- Die Rolle des Willens bei der Entstehung von Schuldverhältnissen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Schuldverhältnisse ein und betont deren Relevanz im täglichen Wirtschafts- und Geschäftsleben. Sie beschreibt Schuldverhältnisse als rechtliche Beziehungen zwischen Personen, in denen Leistungspflichten und Forderungsrechte entstehen, und weist auf die zentrale Rolle des Willens hin, der die Entstehung in Rechtsgeschäft und Gesetz unterteilt. Die Arbeit skizziert ihre Zielsetzung: die Untersuchung der Entstehungsgründe von Schuldverhältnissen und deren Unterschiede.
B. Entstehung und Einteilung der Schuldverhältnisse: Dieses Kapitel befasst sich mit den Hauptentstehungsgründen von Schuldverhältnissen: Rechtsgeschäfte (einteilbar in einseitige und mehrseitige, wobei der Vertrag das übliche mehrseitige Rechtsgeschäft darstellt) und gesetzliche Grundlagen. Es wird die Unterscheidung zwischen gegenseitigen und einseitig verpflichtenden Verträgen erläutert und die Möglichkeit der Begründung eines Schuldverhältnisses durch eine einseitige Willenserklärung angesprochen. Das Kapitel betont, dass Schuldverhältnisse nicht nur vertraglich, sondern auch kraft Gesetzes entstehen können.
I. Entstehung durch Rechtsgeschäft: Dieser Abschnitt detailliert die Entstehung von Schuldverhältnissen durch Rechtsgeschäfte, insbesondere durch Verträge gemäß § 311 Abs. 1 BGB. Er erläutert die Notwendigkeit übereinstimmender Willenserklärungen und das Prinzip der Vertragsfreiheit mit seinen Grenzen. Der Abschnitt unterscheidet zwischen verschiedenen Arten von Verträgen und behandelt auch die Möglichkeit der Begründung durch einseitige Rechtsgeschäfte.
II. Entstehung durch Gesetz: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten, wie Schuldverhältnisse kraft Gesetzes entstehen können. Es umfasst die unerlaubte Handlung (§§ 823 ff. BGB), die ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB), die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677-687 BGB) und die culpa in contrahendo (§ 311 Abs. 2 BGB). Für jeden dieser Punkte werden die jeweiligen Voraussetzungen und Tatbestandsmerkmale erläutert, um das Entstehen eines Schuldverhältnisses zu verdeutlichen. Die Unterscheidung zwischen Leistungskondiktionen und Nichtleistungskondiktionen im Kontext der ungerechtfertigten Bereicherung wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Schuldverhältnis, Vertrag, Rechtsgeschäft, Gesetz, unerlaubte Handlung, ungerechtfertigte Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag, culpa in contrahendo, Willenserklärung, Leistungspflicht, Forderungsrecht, BGB, Vertragsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehung von Schuldverhältnissen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung von vertraglichen und nichtvertraglichen Schuldverhältnissen im deutschen Recht. Sie analysiert die verschiedenen Entstehungsgründe und die Voraussetzungen für das Zustandekommen solcher Schuldverhältnisse, beleuchtet die Unterschiede zwischen den Kategorien und prüft die Erfüllung der Tatbestandsmerkmale relevanter Normen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Willens bei der Entstehung von Schuldverhältnissen.
Welche Arten der Entstehung von Schuldverhältnissen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung von Schuldverhältnissen durch Rechtsgeschäfte (Verträge und einseitige Rechtsgeschäfte) und durch Gesetz (unerlaubte Handlung, ungerechtfertigte Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag, culpa in contrahendo). Im Detail werden gegenseitige und einseitig verpflichtende Verträge, sowie die verschiedenen Arten von Kondiktionen (Leistungskondiktionen und Nichtleistungskondiktionen) im Kontext der ungerechtfertigten Bereicherung erläutert.
Wie werden Verträge im Kontext der Schuldverhältnisse behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung von Schuldverhältnissen durch Verträge gemäß § 311 Abs. 1 BGB. Sie erläutert die Notwendigkeit übereinstimmender Willenserklärungen und das Prinzip der Vertragsfreiheit mit seinen Grenzen. Es wird zwischen verschiedenen Arten von Verträgen unterschieden (z.B. gegenseitige und einseitig verpflichtende Verträge).
Welche gesetzlichen Grundlagen der Entstehung von Schuldverhältnissen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entstehung von Schuldverhältnissen kraft Gesetzes anhand folgender Rechtsinstitute: unerlaubte Handlung (§§ 823 ff. BGB), ungerechtfertigte Bereicherung (§§ 812 ff. BGB), Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677-687 BGB) und culpa in contrahendo (§ 311 Abs. 2 BGB). Für jedes dieser Institute werden die Voraussetzungen und Tatbestandsmerkmale erläutert.
Welche Rolle spielt der Wille bei der Entstehung von Schuldverhältnissen?
Die Arbeit betont die zentrale Rolle des Willens bei der Entstehung von Schuldverhältnissen. Sie unterteilt die Entstehung in Rechtsgeschäfte (wo der Wille explizit zum Ausdruck kommt) und gesetzliche Grundlagen (wo der Wille nicht immer im Vordergrund steht, sondern das Gesetz ein Schuldverhältnis begründet).
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselbegriffe sind: Schuldverhältnis, Vertrag, Rechtsgeschäft, Gesetz, unerlaubte Handlung, ungerechtfertigte Bereicherung, Geschäftsführung ohne Auftrag, culpa in contrahendo, Willenserklärung, Leistungspflicht, Forderungsrecht, BGB, Vertragsfreiheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in eine Einleitung, einen Hauptteil mit der detaillierten Untersuchung der Entstehungsgründe von Schuldverhältnissen und einem Fazit gegliedert. Der Hauptteil unterteilt sich in die Entstehung von Schuldverhältnissen durch Rechtsgeschäfte und durch Gesetz, wobei letzteres verschiedene Rechtsinstitute umfasst.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Bereich des Schuldrechts. Sie ist insbesondere für Studierende des Rechts und alle, die sich mit dem deutschen Schuldrecht auseinandersetzen, relevant.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Entstehung von vertraglichen und nichtvertraglichen Schuldverhältnissen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386878