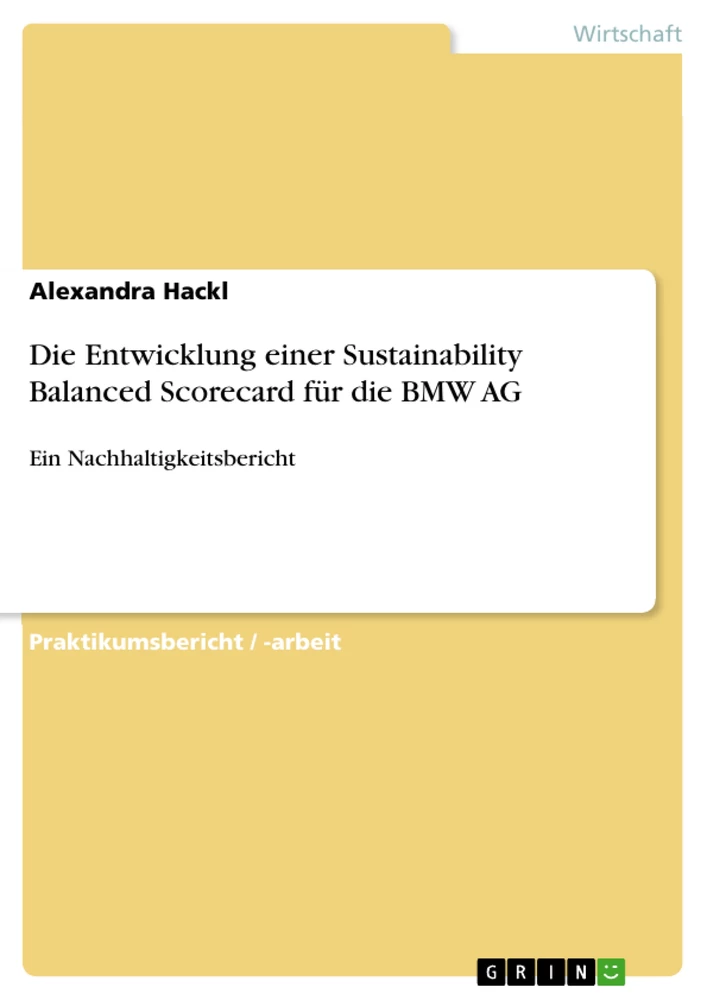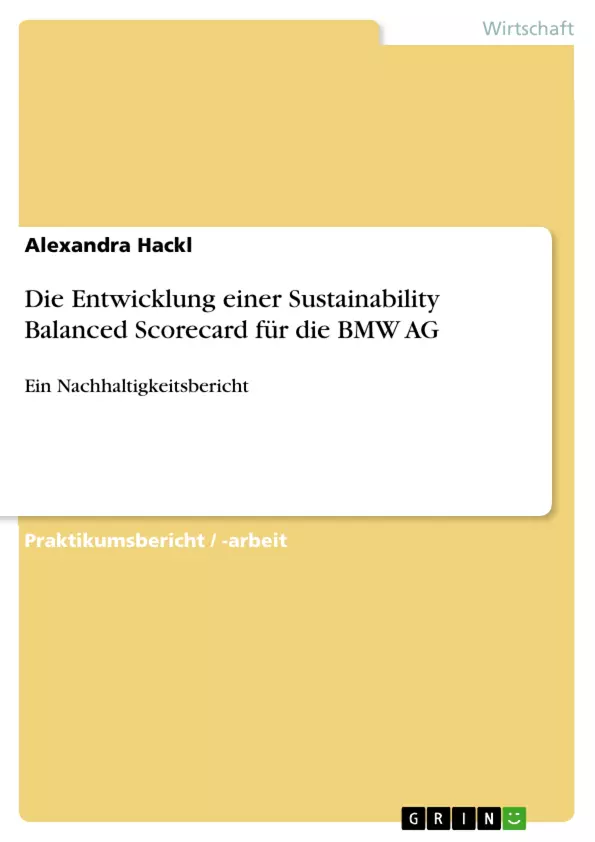In unserer Gesellschaft wird Nachhaltigkeit immer präsenter. In Zeiten des Klimawandels ist es fast schon alltäglich, dass in den Medien oder in den sozialen Netzwerken die Wichtigkeit von nachhaltigem Handeln kommuniziert wird. Aber nicht nur bei den Verbrauchern spielt Nachhaltigkeit eine immer wichtiger werdende Rolle, sondern auch auf Seiten der Unternehmen wird das Thema Nachhaltigkeit immer bedeutungsvoller.
Aufgrund dessen, dass Unternehmen jene Güter produzieren, welche die Menschen konsumieren und dass durch ihr wirtschaftliches Handeln die soziale und ökologische Umwelt beeinflusst wird, kommt diesen Wirtschaftssubjekten eine besonders hohe Bedeutung und Verantwortung zu. Im Zuge der ab 2017 eingeführten Berichterstattungspflicht, auf welche im Kapitel 2.1.3 näher eingegangen wird, stellen sich für die Unternehmen große Herausforderungen hinsichtlich der Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen.
Ein besonderes Problem dabei stellt die Integration von Nachhaltigkeit in die Gesamtstrategie des Unternehmens dar. Oft werden soziale und ökologische Belange losgelöst von der Unternehmensstrategie betrachtet und dadurch oft vernachlässigt. Durch die fehlende Implementierung in die Strategie des Unternehmens, werden Manager und auch die Mitarbeiter nicht in die Prozesse eingebunden, somit fehlt das nötige Commitment, welches bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen besonders wichtig ist. Auch wird das Thema Nachhaltigkeit und die nötige Informationsbeschaffung, oft als eher zeit- und kostenintensiv betrachtet und daher des Öfteren vom Management bewusst außer Acht gelassen.
Ziel dieser Arbeit ist es nun, die wichtigsten Handlungsfelder der BMW AG im Bereich Nachhaltigkeit herauszufiltern und diese mit Hilfe der Balanced Scorecard, in die vier Perspektiven zu integrieren. Die daraus entstehende Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), soll helfen, die Umwelt- und Sozialaspekte in die Strategie der BMW AG zu integrieren und dadurch ein Beispiel dafür geben, wie die langfristige Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele sichergestellt werden kann. Zur Veranschaulichung der kausalen Wirkungszusammenhänge, wird die SBSC im Anschluss als Strategie Map dargestellt.
Die Entwicklung der SBSC soll zeigen, wie Umwelt- und Sozialaspekte, erfolgreich in eine bestehende Unternehmensstrategie eingebunden werden können und soll veranschaulichen, wie Unternehmen, den Herausforderungen der Berichterstattungspflicht erfolgreich begegnen können.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themas und Problemstellung
- Methodischer Rahmen
- Aufbau und Gliederung der Arbeit
- Informationen zur BMW AG
- Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht
- Nachhaltigkeitsbericht der BMW AG
- Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens
- Produkte und Dienstleistungen
- Produktion und Wertschöpfung
- Mitarbeiter und Gesellschaft
- Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung
- Definition und Begriff der Nachhaltigkeit
- Die drei Säulen unternehmerischer Nachhaltigkeit
- Entwicklung einer Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)
- Konzept der traditionellen Balanced Scorecard (BSC)
- Eignung der BSC für das Nachhaltigkeitsmanagement
- Integration von Nachhaltigkeit in die BSC
- Ergebnisse
- Entwicklung einer SBSC für die BMW AG
- Formulierungsprozess einer Sustainability Balanced Scorecard
- Auswahl der strategischen Geschäftseinheit (SGE)
- Ermittlung der Umwelt- und Sozialexponiertheit
- Beurteilung der strategischen Relevanz der Nachhaltigkeitsaspekte
- Darstellung der SBSC als Strategie Map
- Diskussion und Handlungsempfehlung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Projektarbeit widmet sich der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts für die BMW AG und der Entwicklung einer Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) als Instrument zur Steuerung und Messung von Nachhaltigkeit. Die Arbeit untersucht die Relevanz von Nachhaltigkeitsberichterstattung, analysiert die Nachhaltigkeitsstrategie der BMW AG, und beleuchtet die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in das Management des Unternehmens.
- Relevanz von Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Nachhaltigkeitsstrategie der BMW AG
- Entwicklung einer Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)
- Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in das Management
- Steuerung und Messung von Nachhaltigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Nachhaltigkeit und der Nachhaltigkeitsberichterstattung ein und erläutert die Relevanz des Themas für die BMW AG. Das Kapitel „Methodischer Rahmen" beleuchtet die Methodik der Arbeit, die verwendeten Quellen und die Struktur der Arbeit. Das Kapitel „Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht" befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der folgende Abschnitt „Nachhaltigkeitsbericht der BMW AG" analysiert die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens, die Produkte und Dienstleistungen, die Produktion und Wertschöpfung sowie die Aspekte der Mitarbeiter und Gesellschaft. In „Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung" wird die Definition und das Konzept der Nachhaltigkeit erläutert sowie die drei Säulen der unternehmerischen Nachhaltigkeit vorgestellt. Das Kapitel „Entwicklung einer Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)" widmet sich der Erläuterung der traditionellen Balanced Scorecard (BSC), der Eignung der BSC für das Nachhaltigkeitsmanagement und der Integration von Nachhaltigkeit in die BSC. Das Kapitel „Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der Arbeit, insbesondere die Entwicklung einer SBSC für die BMW AG. Die Diskussion und Handlungsempfehlung bietet einen kritischen Ausblick auf die Ergebnisse und formuliert Empfehlungen für die Weiterentwicklung der SBSC und des Nachhaltigkeitsmanagements bei BMW. Die Zusammenfassung fasst die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), Balanced Scorecard (BSC), BMW AG, Nachhaltigkeitsstrategie, Nachhaltigkeitsmanagement, Umwelt- und Sozialexponiertheit, strategische Relevanz, Strategie Map, Mitarbeiter und Gesellschaft, Produktion und Wertschöpfung, Produkte und Dienstleistungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Sustainability Balanced Scorecard (SBSC)?
Eine SBSC ist eine Erweiterung der klassischen Balanced Scorecard, die ökologische und soziale Aspekte direkt in die strategische Steuerung eines Unternehmens integriert.
Warum benötigt die BMW AG eine SBSC?
Um Nachhaltigkeitsziele effektiv in die Gesamtstrategie einzubinden, das Commitment der Mitarbeiter zu stärken und gesetzlichen Berichtspflichten besser nachzukommen.
Was sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeit basiert auf dem Gleichgewicht zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen.
Was ist eine Strategie Map?
Eine Strategie Map visualisiert die kausalen Wirkungszusammenhänge zwischen den verschiedenen Zielen und Perspektiven der Balanced Scorecard.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung?
Die Beschaffung valider Daten sowie die Integration dieser Informationen in die operativen Managementprozesse gelten oft als zeit- und kostenintensiv.
- Citation du texte
- Alexandra Hackl (Auteur), 2016, Die Entwicklung einer Sustainability Balanced Scorecard für die BMW AG, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386886