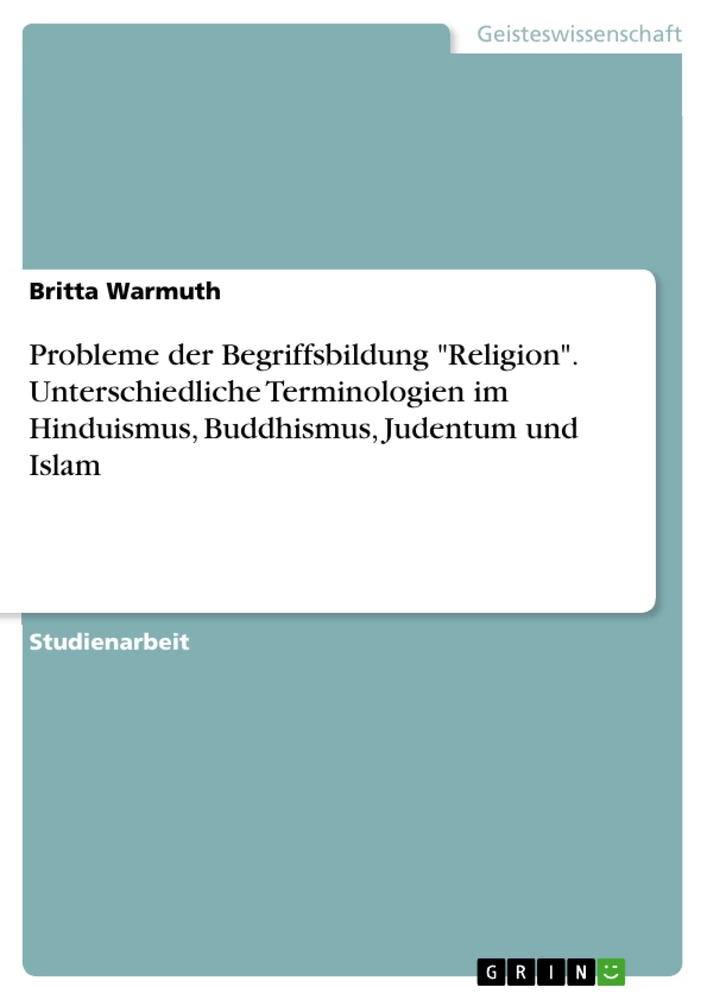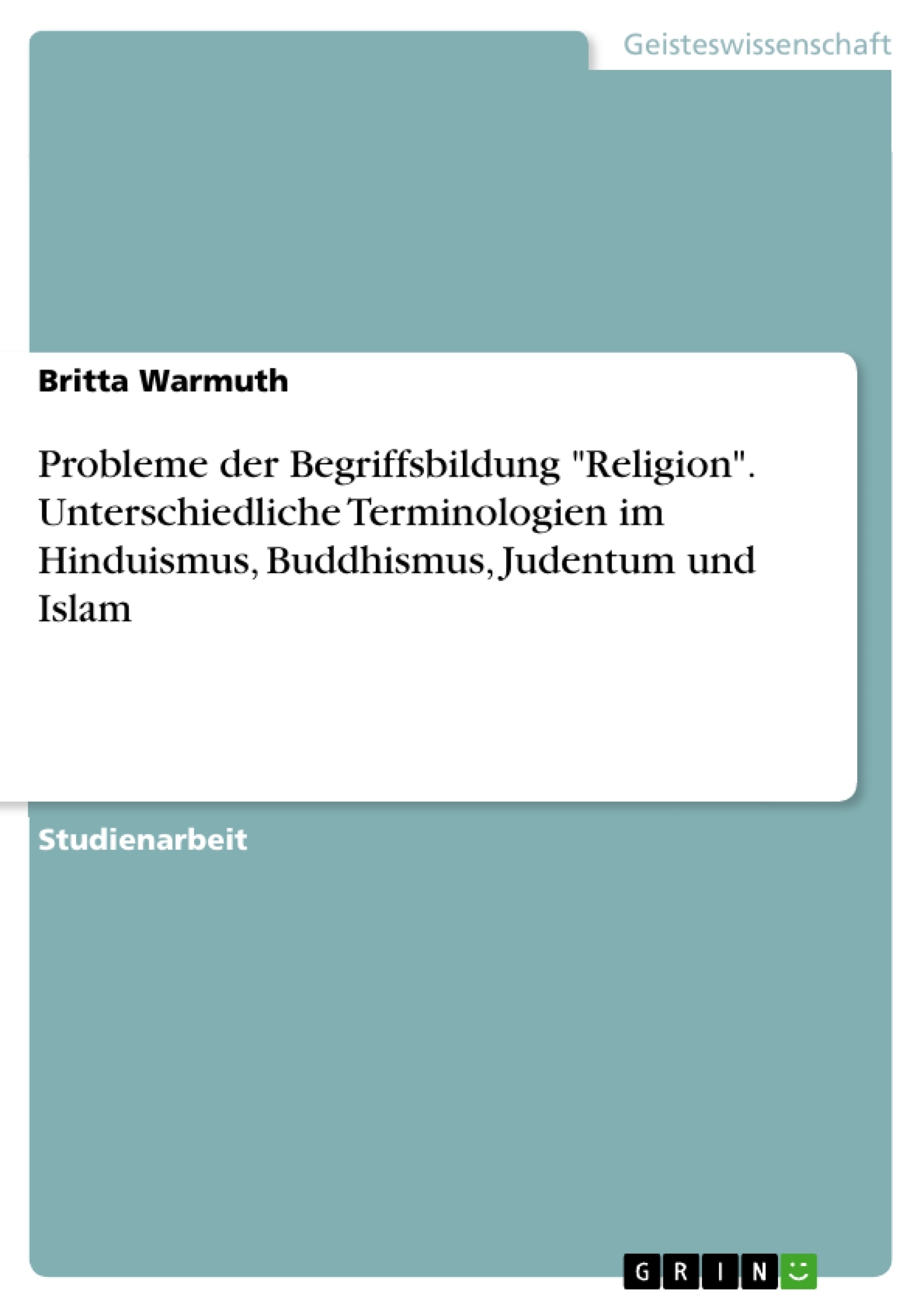Der Religionsbegriff ist für die Religionswissenschaft von grundlegender Bedeutung, immerhin definiert er den Gegenstandbereich dieser Wissenschaft. Problematisch ist jedoch, dass in vielen Kulturen häufig ein entsprechender Begriff fehlt. Dadurch erweist sich eine genauere Bestimmung als schwierig. Über 100 Religionsdefinitionen gibt es inzwischen, aber keine konnte sich als allgemein anerkannt durchsetzen. Alle vorgeschlagenen Definitionen erscheinen lückenhaft, da sie Aspekte bestimmter Religionen vernachlässigen und ihre Eignung sich letztlich darauf reduziert, vorhandene religiöse Phänomene zu beschreiben.
Die vorliegende Protokollausarbeitung versucht zu thematisieren, worin die Probleme einer Begriffsbildung Religion liegen. Nach einem Überblick über die „historische“ Entwicklung des Religionsbegriffes wird auf die unterschiedlichen Terminologien in den einzelnen Religionen Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Islam eingegangen, die verbunden sind mit einem Religionsverständnis, dass nicht ohne weiteres mit dem westlich-europäischen kompatibel ist. Die Arbeit schließt mit einem Resümee, in dem diskutiert wird, was diese Problematik für Konsequenzen für den LER-Unterricht haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Blick in die Geschichte
- Der Religionsbegriff:
- Der Hinduismus
- Der Buddhismus:
- Das Judentum:
- Der Islam:
- Fazit:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Problematik der Begriffsbildung "Religion" und analysiert die Schwierigkeiten, die mit einer allgemeingültigen Definition dieses Begriffs verbunden sind. Der Text untersucht die historische Entwicklung des Religionsbegriffs und beleuchtet die unterschiedlichen Terminologien und Religionsverständnisse in verschiedenen Religionen, insbesondere im Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Islam. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die westlich-europäische Denkweise von Religion auf andere Kulturen übertragbar ist.
- Die historische Entwicklung des Religionsbegriffs
- Die Schwierigkeiten einer allgemeingültigen Definition des Begriffs "Religion"
- Die unterschiedlichen Religionsverständnisse in verschiedenen Kulturen
- Die Problematik des westlich-europäischen Religionsverständnisses im interreligiösen Kontext
- Die Konsequenzen für den LER-Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die grundlegende Problematik des Religionsbegriffs dar und betont, dass es trotz zahlreicher Definitionen keinen allgemein akzeptierten Begriff gibt. Die Komplexität und Unterschiedlichkeit der Religionen erschwert eine einheitliche Definition.Ein Blick in die Geschichte
Dieser Abschnitt beleuchtet die Entstehung und Entwicklung des Religionsbegriffs im Kontext der Religionswissenschaft und zeigt die Prägung durch den christlich-europäischen Kontext auf. Es wird deutlich, dass der Religionsbegriff nicht in allen Kulturen gleichermaßen existiert und dass die westliche Sichtweise nicht auf andere Kulturen übertragen werden kann.Der Religionsbegriff:
Das Kapitel analysiert den Unterschied zwischen exklusivem und komparativem Religionsbegriff. Es werden auch die fünf Aspekte des Religionsbegriffs im Sinne von C.Y. Glock besprochen: der theologisch-glaubensmäßige, der emotionale, der kultisch-rituelle, der ethisch-moralische und der soziologisch-organisatorische Aspekt.Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind der Religionsbegriff, Religionsverständnis, interreligiöser Vergleich, historische Entwicklung, Religionsgeschichte, westlich-europäische Denkweise, christlicher Kontext, Exklusivität, Komparativität, Glaubensaspekt, kultisch-rituelle Aspekte, ethisch-moralische Aspekte, soziologisch-organisatorische Aspekte, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Islam.- Arbeit zitieren
- Britta Warmuth (Autor:in), 2007, Probleme der Begriffsbildung "Religion". Unterschiedliche Terminologien im Hinduismus, Buddhismus, Judentum und Islam, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386908