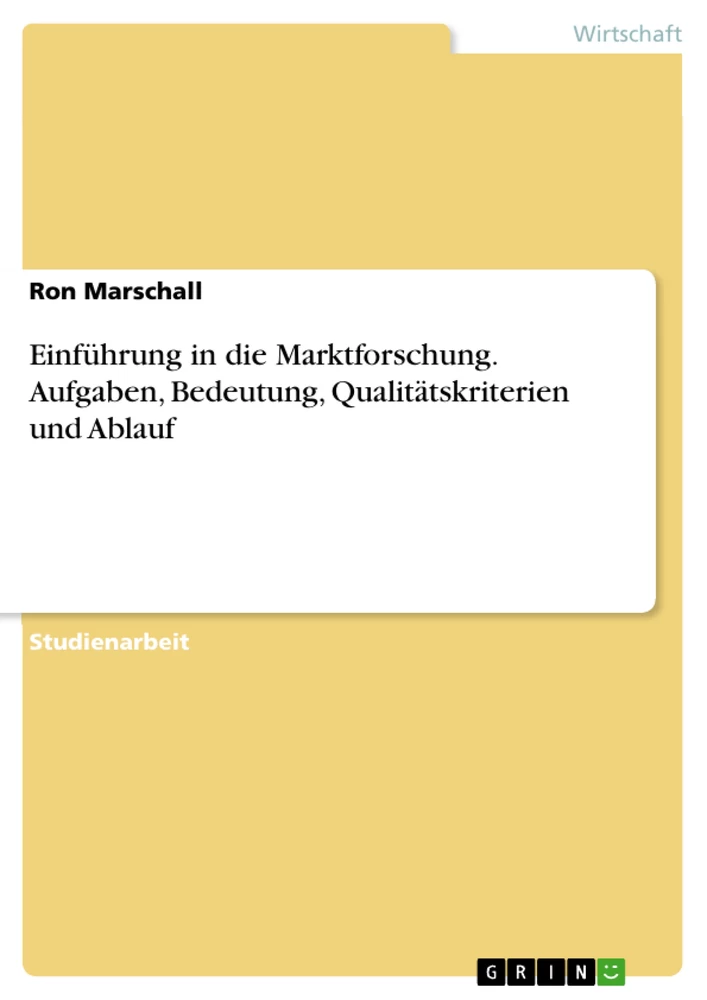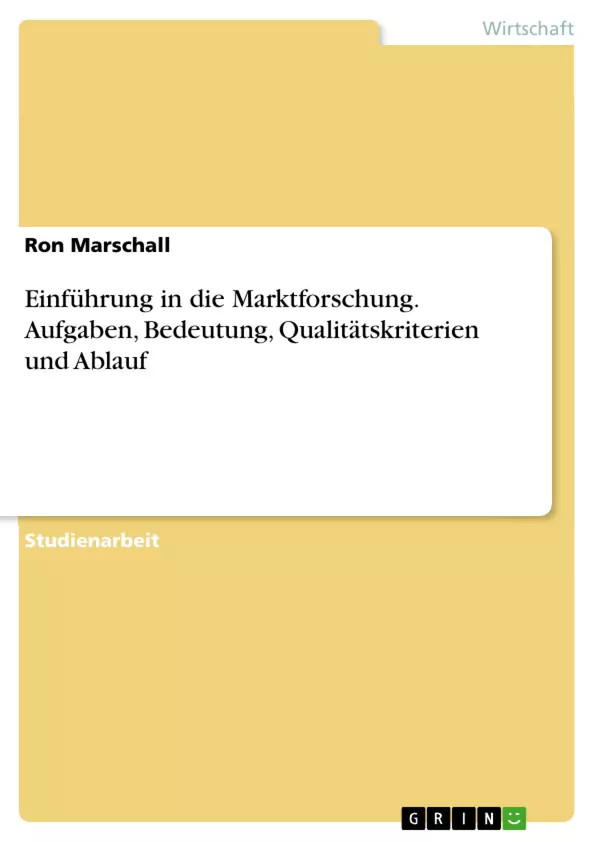Der Autor dieser Seminararbeit fragt sich, was eine gute Marktforschung ausmacht und ob es die eine richtig Marktforschung gibt. Neben diesen Fragen werden weitere Punkte aufgegriffen, zum Beispiel ob kompliziertere Methoden zu besseren Resultaten als einfache Methoden führen. Nichtsdestotrotz liegt das Hauptaugenmerk dieser Seminararbeit auf den Qualitätskriterien einer Marktforschung.
Die Hausarbeit ist in fünf Kapitel gegliedert. Nach der Einführung ins Thema beginnt in Kapitel zwei der theoretische Teil der Seminararbeit. Dort wird darüber geschrieben, wie man als Unternehmen durch Marktforschung sein Erlös maximieren kann und was Qualitätskriterien einer solchen Marktforschung sind. Des Weiteren ist die Wichtigkeit der Marktforschung in einem Unternehmen erwähnenswert. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Durchlauf einer Marktforschung. Der Autor möchte anhand dieses Kapitels aufzeigen, wie der Prozess der Marktforschung von Besprechung der Methode über die Datenquellen bis hin zur Datenanalyse und Interpretation erfolgen.
Das vorletzte Kapitel befasst sich mit einem Praxisbeispiel. Anhand des Beispiels, welches analysiert wird, soll gezeigt werden, wie man Qualitätskriterien in einer Studie erkennt. In dem letzten Kapitel ordnet der Autor dieses Schreibens noch einmal alle Erkenntnisse logisch in den aktuellen Kontext mit ein und leitet ab welche Implikationen diese für die zukünftige Marktforschung haben könnte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Aufgaben und Bedeutung der Marktforschung
- 2.1 Strategisches Vorgehen (Erlösmaximierung) und Wichtigkeit der Marktforschung im Unternehmen
- 2.2 Qualitätskriterien einer Marktforschung
- 3 Ablauf eines Marktforschungsprozesses
- 3.1 Konzipierung des Forschungsplans
- 3.2 Datenerhebung und Datenanalyse
- 3.3 Ergebnisinterpretation und Ergebnispräsentation
- 4 Studie analysieren und Qualitätskriterien aufweisen
- 5 Fazit und Ausblick der Marktforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung und die Qualitätskriterien von Marktforschung im Kontext des modernen, wettbewerbsintensiven Marktes. Sie beleuchtet den Ablauf eines Marktforschungsprozesses und analysiert ein Praxisbeispiel, um die Anwendung der Qualitätskriterien zu veranschaulichen. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Durchführung und Bewertung von Marktforschungsstudien zu vermitteln.
- Bedeutung der Marktforschung für die Erlösmaximierung von Unternehmen
- Qualitätskriterien effektiver Marktforschung
- Ablauf eines systematischen Marktforschungsprozesses
- Analyse eines Praxisbeispiels zur Identifizierung von Qualitätskriterien
- Ausblick auf zukünftige Implikationen für die Marktforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Marktforschung ein und betont deren wachsende Bedeutung in einem globalisierten und technologiegetriebenen Umfeld. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, die Qualität von Marktforschungsstudien zu gewährleisten und stellt zentrale Fragestellungen der Arbeit vor, wie z.B. die Definition einer "guten" Marktforschung und den Einfluss der Methodenkomplexität auf die Ergebnisse. Die Arbeit wird in fünf Kapitel gegliedert und deren Inhalt kurz umrissen.
2 Aufgaben und Bedeutung der Marktforschung: Dieses Kapitel befasst sich mit der strategischen Bedeutung der Marktforschung für die Erlösmaximierung. Es analysiert, wie Unternehmen durch gezielte Informationsbeschaffung und -verarbeitung ihre Marktposition stärken und profitable Entscheidungen treffen können. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Definition und Erläuterung wichtiger Qualitätskriterien einer erfolgreichen Marktforschung, die den späteren Kapiteln als Bewertungsgrundlage dienen.
3 Ablauf eines Marktforschungsprozesses: Das Kapitel beschreibt den Ablauf einer systematischen Marktforschung, von der Konzeption des Forschungsplans über die Datenerhebung und -analyse bis hin zur Interpretation und Präsentation der Ergebnisse. Es beleuchtet die einzelnen Phasen detailliert und verdeutlicht die Bedeutung eines strukturierten Vorgehens für die Qualität und Aussagekraft der Ergebnisse. Es werden verschiedene Methoden der Datengewinnung und -auswertung kurz erwähnt, ohne jedoch tief in die Details einzelner Verfahren einzutauchen.
4 Studie analysieren und Qualitätskriterien aufweisen: Anhand einer konkreten Fallstudie werden die im zweiten Kapitel erläuterten Qualitätskriterien angewendet und analysiert. Das Kapitel demonstriert, wie die Kriterien in der Praxis zur Bewertung der Qualität und Aussagekraft einer Marktforschungsstudie verwendet werden können. Es wird ein Beispiel für eine Studie präsentiert, deren Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Qualitätskriterien diskutiert werden.
Schlüsselwörter
Marktforschung, Qualitätskriterien, Erlösmaximierung, strategisches Vorgehen, Marktforschungsprozess, Datenanalyse, Ergebnisinterpretation, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Marktforschung
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Marktforschung. Sie behandelt die Bedeutung der Marktforschung für die Erlösmaximierung von Unternehmen, die Qualitätskriterien effektiver Marktforschung, den Ablauf eines systematischen Marktforschungsprozesses und analysiert ein Praxisbeispiel, um die Anwendung der Qualitätskriterien zu veranschaulichen. Zusätzlich bietet sie einen Ausblick auf zukünftige Implikationen für die Marktforschung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Strategisches Vorgehen und die Wichtigkeit der Marktforschung im Unternehmen (Erlösmaximierung), Qualitätskriterien einer Marktforschung, Ablauf eines Marktforschungsprozesses (Konzipierung, Datenerhebung, Datenanalyse, Ergebnisinterpretation und -präsentation), Analyse einer Studie und Anwendung der Qualitätskriterien sowie ein Fazit und Ausblick auf die Marktforschung.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Seminararbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Aufgaben und Bedeutung der Marktforschung, Ablauf eines Marktforschungsprozesses, Analyse einer Studie und Anwendung der Qualitätskriterien, sowie Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Seminararbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Marktforschung, Qualitätskriterien, Erlösmaximierung, strategisches Vorgehen, Marktforschungsprozess, Datenanalyse, Ergebnisinterpretation, Fallstudie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Durchführung und Bewertung von Marktforschungsstudien zu vermitteln. Sie untersucht die Bedeutung und die Qualitätskriterien von Marktforschung im Kontext des modernen, wettbewerbsintensiven Marktes.
Wie wird der Ablauf eines Marktforschungsprozesses beschrieben?
Der Ablauf wird in drei Hauptphasen unterteilt: Konzipierung des Forschungsplans, Datenerhebung und Datenanalyse sowie Ergebnisinterpretation und Ergebnispräsentation. Die Arbeit beleuchtet die einzelnen Phasen detailliert und betont die Bedeutung eines strukturierten Vorgehens.
Wie werden die Qualitätskriterien der Marktforschung behandelt?
Die Qualitätskriterien werden definiert und erläutert. Sie dienen als Bewertungsgrundlage und werden anhand einer konkreten Fallstudie angewendet und analysiert, um die Stärken und Schwächen einer Studie aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt die Erlösmaximierung in der Seminararbeit?
Die Erlösmaximierung wird als zentraler strategischer Aspekt der Marktforschung betrachtet. Die Arbeit analysiert, wie Unternehmen durch gezielte Marktforschung ihre Marktposition stärken und profitable Entscheidungen treffen können.
- Quote paper
- Ron Marschall (Author), 2017, Einführung in die Marktforschung. Aufgaben, Bedeutung, Qualitätskriterien und Ablauf, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387004