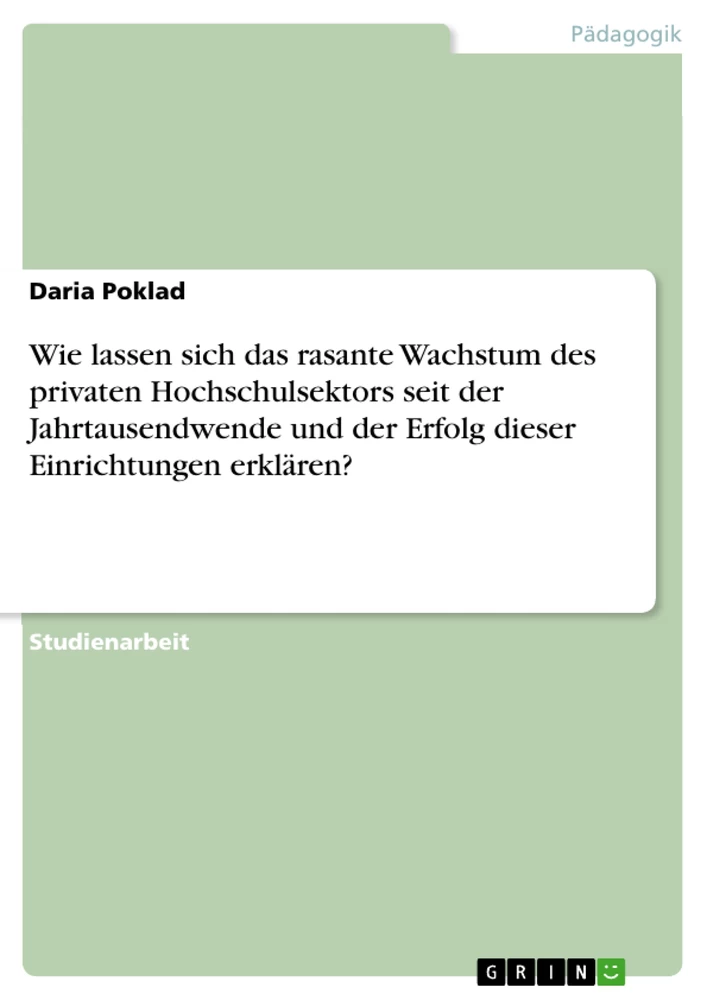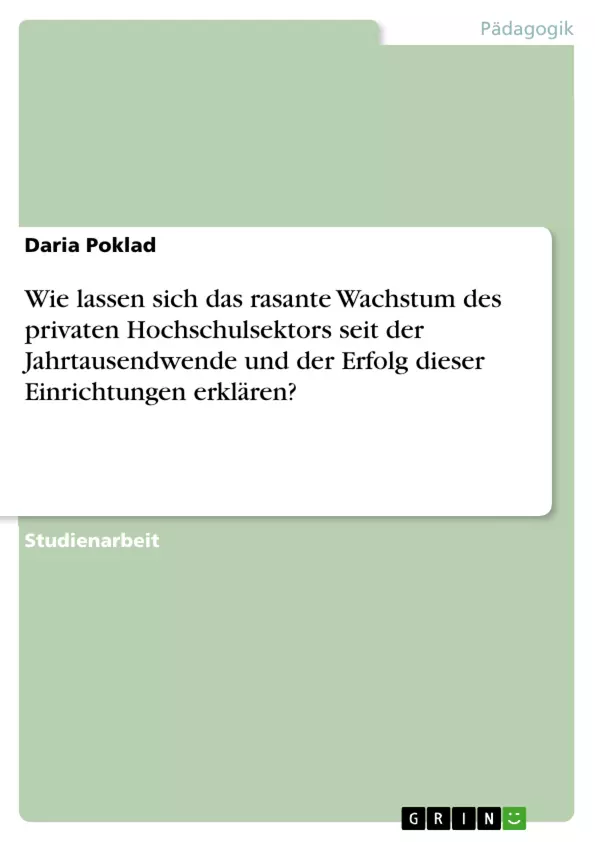Das Ziel dieser Hausarbeit ist es, aufzuzeigen, welche Faktoren zu dem rasanten Wachstum der privaten Hochschulen beigetragen haben und welche Vorteile diese Einrichtungen Studierenden zu bieten scheinen, so dass sich immer mehr von ihnen für ein Studium an einer privaten Hochschule entscheiden. Dafür wird zunächst eine Definition des Begriffs ‚private Hochschule‘ unter Berücksichtigung der vorrangigen Aufgaben und des grundsätzlichen Ziels von Hochschulen vorgenommen und daraufhin die Organisationsstrukturen der privaten Hochschulen skizziert. Anschließend wird die geschichtliche Entwicklung des privaten Hochschulsektors in Deutschland dargestellt. Diese wird der Übersichtlichkeit halber in die Entwicklung vor dem Jahr 2000 und nach der Jahrtausendwende gegliedert. Daraufhin wird die gegenwärtige Situation des privaten Hochschulsektors präsentiert. Besondere Berücksichtigung finden dabei die Vielfalt privater Hochschulen anhand von Typologien, die bundesweite Situation und die regionale Verteilung mit einem besonderen Fokus auf Nordrhein-Westfalen. Außerdem werden die Zusammensetzung der Studierendenschaft nach Alter, Geschlecht und Herkunft sowie das Fächer- und Studienangebot an privaten Hochschulen betrachtet und den staatlichen gegenübergestellt. Diese Ausführungen stützen sich auf die aktuellsten vorliegenden statistischen Daten und werden anhand von Beispielen aus der Hochschullandschaft in den Fußnoten konkretisiert. Abschließend werden Erklärungsansätze für den Erfolg der privaten Hochschulen aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Organisationsstrukturen
- Definition
- Organisationsstrukturen
- Historische Entwicklung des privaten Hochschulsektors in Deutschland
- Private Hochschulen vor dem Jahr 2000
- Private Hochschulen nach 2000
- Typologien privater Hochschulen
- Bundesweiter Überblick
- Regionale Verteilung
- Zusammensetzung der Studierendenschaft
- Fächer- und Studienangebote
- Zwischenfazit
- Erklärungsansätze für den Erfolg privater Hochschulen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der rasanten Entwicklung privater Hochschulen in Deutschland. Sie analysiert die Faktoren, die zu diesem Wachstum geführt haben und beleuchtet die Vorteile, die diese Einrichtungen Studierenden zu bieten scheinen. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die Gründe für die steigende Attraktivität von privaten Hochschulen für Studierende zu verstehen und zu erklären.
- Definition des Begriffs "private Hochschule" im Kontext der deutschen Hochschullandschaft
- Historische Entwicklung und gegenwärtige Situation des privaten Hochschulsektors in Deutschland
- Typologien und regionale Verteilung privater Hochschulen
- Zusammensetzung der Studierendenschaft an privaten Hochschulen
- Erklärungsansätze für den Erfolg von privaten Hochschulen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und beleuchtet die aktuelle Situation des privaten Hochschulsektors in Deutschland. Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Definition des Begriffs "private Hochschule" sowie der Organisationsstrukturen dieser Einrichtungen. Kapitel drei betrachtet die historische Entwicklung des privaten Hochschulsektors in Deutschland, gegliedert in die Entwicklung vor und nach dem Jahr 2000. In Kapitel vier wird die gegenwärtige Situation des privaten Hochschulsektors anhand verschiedener Faktoren wie Typologien, bundesweitem Überblick, regionaler Verteilung, Zusammensetzung der Studierendenschaft, Fächer- und Studienangeboten und einem Zwischenfazit analysiert. Das fünfte Kapitel behandelt Erklärungsansätze für den Erfolg privater Hochschulen.
Schlüsselwörter
Private Hochschule, Hochschulsektor, Deutschland, Entwicklung, Typologien, Studierendenschaft, Fächerangebot, Erklärungsansätze, Finanzierung, Organisation, Geschichte, Wachstum, Attraktivität, Studienangebote.
Häufig gestellte Fragen
Warum wächst der Sektor privater Hochschulen in Deutschland so stark?
Das rasanten Wachstum seit der Jahrtausendwende erklärt sich durch eine höhere Spezialisierung, kleinere Lerngruppen und eine starke Praxisorientierung, die viele Studierende anspricht.
Was sind die Vorteile eines Studiums an einer privaten Hochschule?
Studierende profitieren oft von einer besseren Betreuungsquote, moderner Ausstattung und flexibleren Studienmodellen im Vergleich zu staatlichen Massenuniversitäten.
Wie unterscheiden sich die Studierenden an privaten und staatlichen Hochschulen?
Die Arbeit analysiert die Zusammensetzung nach Alter, Geschlecht und Herkunft und zeigt Unterschiede in der sozialen Struktur und den gewählten Fachbereichen auf.
Gibt es regionale Schwerpunkte bei privaten Hochschulen?
Ja, die Arbeit zeigt eine ungleiche Verteilung auf, wobei ein besonderer Fokus auf der Hochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen liegt.
Welche Fächer werden an privaten Hochschulen besonders häufig angeboten?
Besonders stark vertreten sind Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Management, Medien und Gesundheit, die oft direkt auf den Arbeitsmarkt zugeschnitten sind.
- Quote paper
- Daria Poklad (Author), 2017, Wie lassen sich das rasante Wachstum des privaten Hochschulsektors seit der Jahrtausendwende und der Erfolg dieser Einrichtungen erklären?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387026