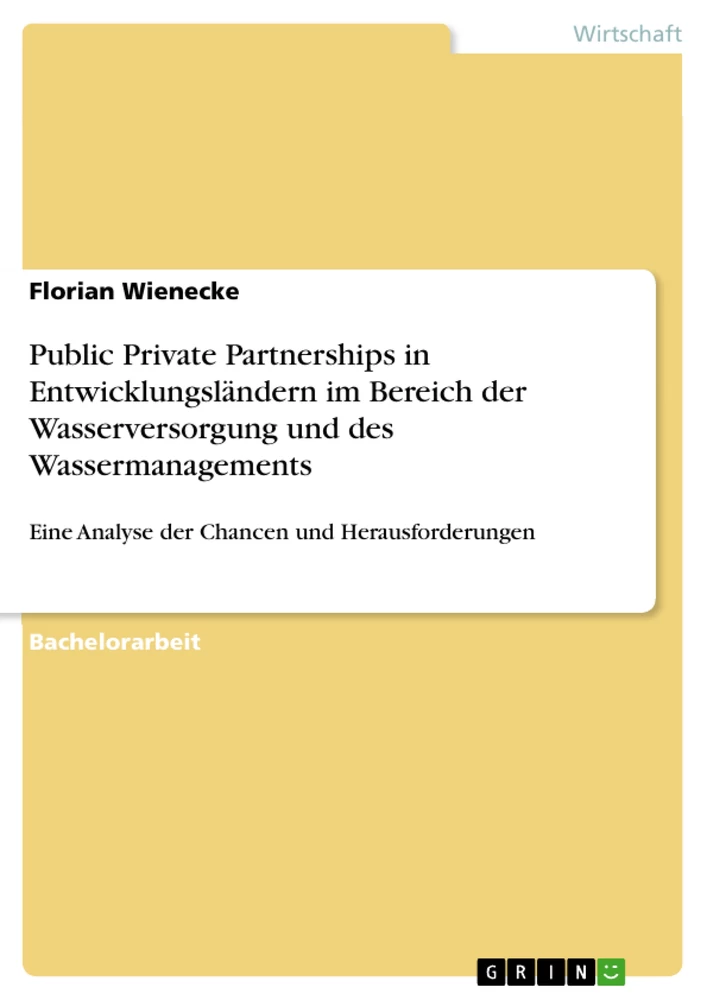Armut kann nur reduziert werden, wenn die „absoluten Grundbedürfnisse“ der Menschen erfüllt sind, dazu gehört neben Essen und einer minimaler Gesundheitsversorgung auch Wasser.
In den Millennium Developement Goals (MDG), welche im September 2000 in New York von den Vereinten Nationen zur Bekämpfung der größten globalen Probleme formuliert wurden, wird folglich auch die globale Wasserproblematik aufgegriffen. Diese fand im siebten MDG zur nachhaltigen Umwelt als ein Unterziel Beachtung: Die Halbierung der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bis 2015. Tatsächlich wurde oben genanntes MDG erreicht, aber trotzdem haben weltweit schätzungsweise 748 Millionen Menschen noch immer keinen Zugang zu guter Wasserversorgung.
Bereits 1999 forderte der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi A. Annan, den stärkeren Einbezug des privaten Sektors, um den entwicklungspolitischen Zielen besser gerecht werden zu können. In diesem Zusammenhang stellt das Modell der Public Private Partnerships eine Möglichkeit dar, entwicklungspolitische Verantwortung auf den Privatsektor zu übertragen. Diese werden z.B. von Entwicklungsorganisationen als öffentlicher Partner in Entwicklungsländern arrangiert. Dabei sollen Synergien durch die Zusammenarbeit öffentlicher und privater Partner generiert werden, welche entwicklungspolitische Ziele, wie die schlechte Wasserversorgung, lösen.
Wie geeignet sind diese PPP, unter Berücksichtigung der spezifischen Erfolgs- und Risikofaktoren, um Effizienzgewinne und Nachhaltigkeit im Wassermanagement und letztendlich eine effektive Verbesserung der Wasserversorgung in Entwicklungsländern zu realisieren? Mittels einer Partner-Fit Analyse soll überprüft werden, ob PPP als Modellrahmen geeignet sind zwischen öffentlichem und privatem Partner eine so stabile Partnerschaft zu ermöglichen, welche die angestrebten Ziele erreichen kann. Dabei soll auch heraus gearbeitet werden, welche Regelungsfelder eventuell eine besondere Gefährdung für die Stabilität der Beziehung darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlage
- 2.1 Essentielle Ziele im Wassermanagement zur Verbesserung der Wasserversorgung in Entwicklungsländern
- 2.2 Partner-Fit Analyse
- 2.3 Das Konzept von Public Private Partnerships - Definition und Abgrenzung
- 3 PPP-Modelle in Entwicklungsländern in der Praxis
- 4 Partner-Fit Analyse des PPP-Modells
- 4.1 Kultureller Fit
- 4.2 Strategischer Fit
- 4.3 Fundamentaler Fit
- 4.3.1 Das PPP-Modell und die Erfolgs- und Risikofaktoren des Wassermanagement in Entwicklungsländern
- 4.3.2 Die Kooperationsrente und dessen Verteilung in Wasser-PPP in Entwicklungsländern
- 5 Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Chancen und Herausforderungen von Public Private Partnerships (PPP) in Entwicklungsländern im Bereich der Wasserversorgung und des Wassermanagements. Sie untersucht, ob PPP als Modellrahmen geeignet sind, um Effizienzgewinne und Nachhaltigkeit im Wassermanagement und letztendlich eine effektive Verbesserung der Wasserversorgung in Entwicklungsländern zu realisieren.
- Essentielle Ziele im Wassermanagement und der Wasserversorgung in Entwicklungsländern
- Partner-Fit Analyse als Werkzeug zur Bewertung der Eignung von PPP-Modellen
- Anforderungen an eine stabile Partnerschaft zwischen öffentlichen und privaten Akteuren
- Analyse des PPP-Modells im Kontext von Entwicklungsländern
- Bewertung der Erfolgs- und Risikofaktoren von PPP-Modellen im Wassermanagement
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problematik der Wasserversorgung in Entwicklungsländern dar und erläutert die Bedeutung von Public Private Partnerships (PPP) in diesem Zusammenhang.
- Kapitel 2: Theoretische Grundlage: Dieses Kapitel behandelt die essentiellen Ziele im Wassermanagement und die Anforderungen an die Wasserversorgung in Entwicklungsländern. Außerdem wird das Konzept von PPP definiert und die Partner-Fit Analyse vorgestellt.
- Kapitel 3: PPP-Modelle in Entwicklungsländern in der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert das develoPPP.de-Programm als Beispiel für die praktische Anwendung von PPP-Modellen in Entwicklungsländern im Bereich der Wasserversorgung.
- Kapitel 4: Partner-Fit Analyse des PPP-Modells: Dieses Kapitel führt eine Partner-Fit Analyse des PPP-Modells durch, wobei die verschiedenen Dimensionen (kultureller Fit, strategischer Fit, fundamentaler Fit) anhand von konkreten Beispielen aus dem develoPPP.de-Programm und anderen Wasser-PPP in Entwicklungsländern untersucht werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Public Private Partnerships (PPP), Wasserversorgung, Wassermanagement, Entwicklungsländer, Partner-Fit Analyse, Erfolgs- und Risikofaktoren, Kooperationsrente, develoPPP.de-Programm. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Eignung von PPP-Modellen zur Verbesserung der Wasserversorgung und des Wassermanagements in Entwicklungsländern.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Public Private Partnership (PPP) im Wassersektor?
PPP bezeichnet die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Stellen und privaten Unternehmen, um die Wasserversorgung und das Wassermanagement effizienter zu gestalten.
Warum sind PPPs in Entwicklungsländern wichtig?
Sie helfen dabei, die Millenniumsentwicklungsziele (MDGs) zu erreichen, indem sie privates Kapital und technisches Know-how für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung mobilisieren.
Was ist eine Partner-Fit Analyse?
Dies ist ein Werkzeug zur Bewertung, ob öffentlicher und privater Partner kulturell, strategisch und fundamental zusammenpassen, um eine stabile Partnerschaft zu gewährleisten.
Was sind die Risiken von Wasser-PPPs?
Zu den Risiken gehören kulturelle Differenzen, die ungleiche Verteilung der Kooperationsrente und eine mögliche Vernachlässigung sozialer Ziele zugunsten der Profitabilität.
Was ist das develoPPP.de-Programm?
Ein Förderprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das privates Engagement in Entwicklungsländern unterstützt.
- Quote paper
- Florian Wienecke (Author), 2016, Public Private Partnerships in Entwicklungsländern im Bereich der Wasserversorgung und des Wassermanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387250