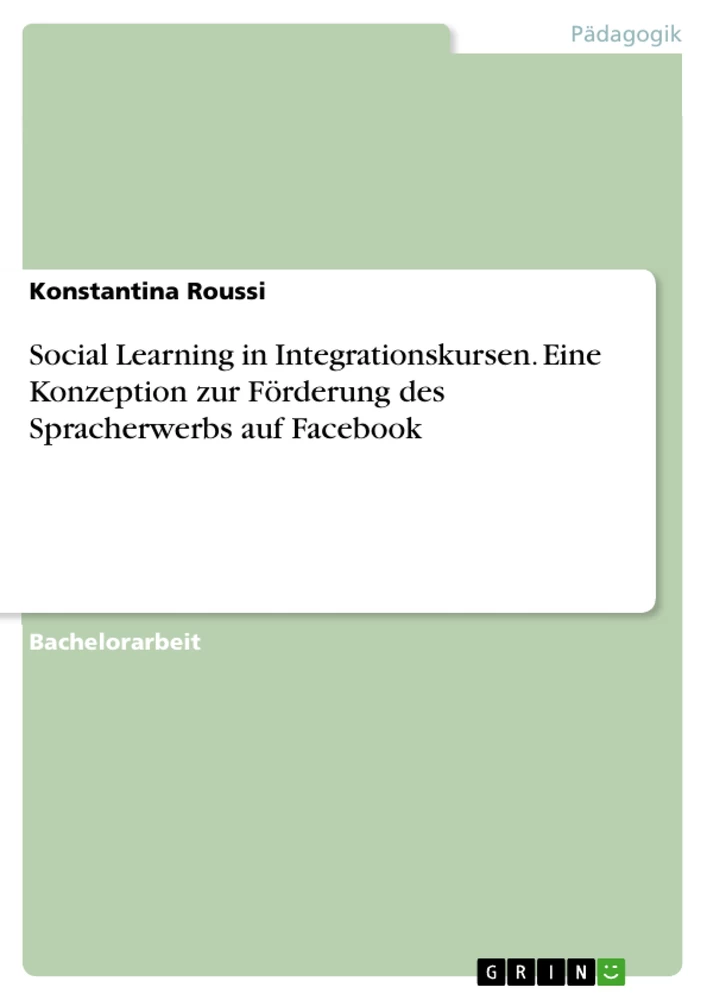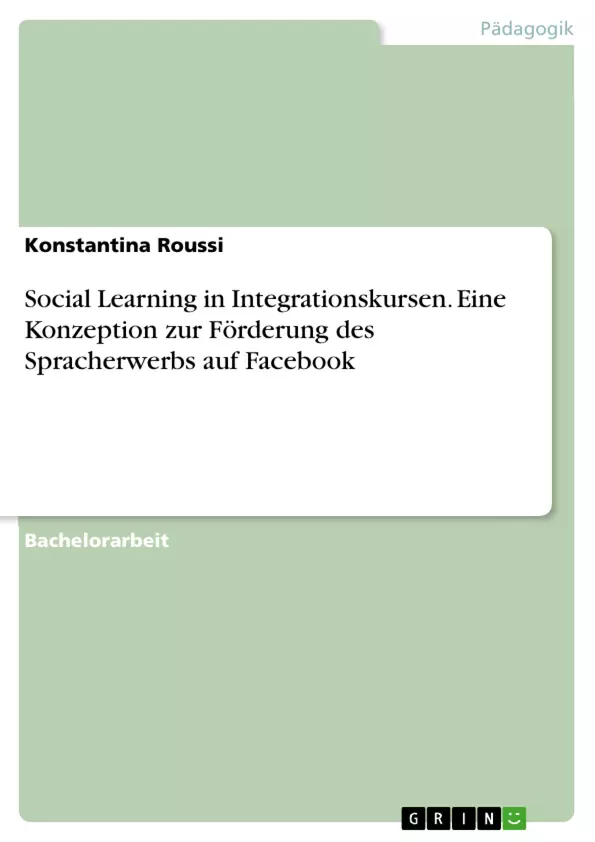In dieser Arbeit soll herausgefunden werden, ob und wie durch Web 2.0 Anwendungen und Social Learning der Spracherwerb von Migranten, die an einem Integrationskurs in Plettenberg teilnehmen, gefördert werden kann. Es ergeben sich weitere Fragen, wie Facebook als sinnvolles Zusatzangebot in einen Integrationskurs eingebunden und gestaltet werden kann, so dass ein Mehrwert dabei entsteht. Durch den Einsatz von Facebook soll die Medienkompetenz der Teilnehmenden, die soziale Interaktion und dadurch der Spracherwerb verbessert werden.
Um diese Fragen zu beantworten und die genannten Ziele zu erreichen, bedarf es einer tiefgehenden Auseinandersetzung mit der entsprechenden Theorie zu Web 2.0, Social Software und der Berücksichtigung der Ziele und der Zielgruppe um eine geeignete mediendidaktische Konzeption zu erstellen. Dazu werden zunächst in Kapitel 2 die Begriffe Web 2.0 und Social Learning bzw. soziales Lernen erklärt und theoretisch eingeordnet. In Kapitel 2.1 werden die Begriffe Soziale Netzwerke und Online Social Networks beschrieben sowie einige Online Social Networks aufgezählt und in ihrer Anwendung beschrieben. In Kapitel 2.3 wird anschließend Facebook näher erläutert und einige Möglichkeiten für den Unterricht aufgezeigt.
Kapitel 3 beschreibt die Integrationskurse, die Rahmenbedingungen und den Spracherwerb von Migranten. In Kapitel 4, "Einsatz von neuen Medien in Integrationskursen", wird erläutert, warum es sinnvoll ist, in Integrationskursen neue Medien einzubinden. Desweiteren wird Blended Learning als eine mögliche Form aufgezeigt. In Kapitel 5 wird die für diese Arbeit relevante gestaltungsorientierte Mediendidaktik von Kerres vorgestellt. Gemäß der gestaltungsorientierten Mediendidaktik von Kerres wird in Kapitel 6 eine Konzeption erstellt, die als zusätzliches Angebot zum Integrationskurs, den Spracherwerb fördern soll. Am Ende soll eingeschätzt werden, ob durch das Social Learning Angebot auf Facebook, der Spracherwerb gefördert werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Web 2.0 und Social Learning
- 2.1 Soziale Netzwerke und Online Social Networks
- 2.2 Facebook
- 3. Integrationskurse
- 3.1 Rahmenbedingungen
- 3.2 Spracherwerb
- 4. Einsatz von neuen Medien in Integrationskursen
- 5. Gestaltungsorientierte Mediendidaktik
- 5.1 Analyse der Zielgruppe
- 5.2 Lehrinhalte und Ziele
- 5.3 Didaktische Methoden
- 5.4 Lernorganisation
- 5.5 Aufbau des Lernangebotes
- 5.6 Medienwahl und technische Implementation
- 6. Social Learning-Konzeption auf Facebook
- 6.1 Analyse der Zielgruppe
- 6.2 Ziele und Lehrinhalte
- 6.3 Didaktische Methoden
- 6.4 Lernorganisation und Aufbau des Blended-Learning-Angebotes
- 6.5 Medienwahl und technische Implementation
- 6.6 Reflexion
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht, ob und wie der Einsatz von Web 2.0-Anwendungen und Social Learning den Spracherwerb von Migranten in Integrationskursen fördern kann. Im Fokus steht dabei die Nutzung von Facebook als zusätzliches Lernangebot. Die Arbeit zielt darauf ab, die Medienkompetenz der Teilnehmenden, die soziale Interaktion und den Spracherwerb durch den Einsatz von Facebook zu verbessern.
- Web 2.0 und Social Learning als pädagogische Werkzeuge
- Einsatz von Facebook in Integrationskursen
- Förderung des Spracherwerbs durch soziale Interaktion
- Medienkompetenz und Integration
- Gestaltungsorientierte Mediendidaktik und Blended Learning
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein, indem sie die Bedeutung von Online-Lernen und den Bedarf an neuen Lernwegen im Spracherwerb von Migranten hervorhebt. Sie stellt die Forschungsfrage, ob und wie Facebook als Lernplattform den Spracherwerb fördern kann.
- Kapitel 2: Web 2.0 und Social Learning: Dieses Kapitel liefert eine theoretische Einordnung der Begriffe Web 2.0 und Social Learning und beschreibt die Funktionen und Anwendungen von sozialen Netzwerken, insbesondere von Facebook.
- Kapitel 3: Integrationskurse: Hier werden die Rahmenbedingungen und der Spracherwerb in Integrationskursen beleuchtet.
- Kapitel 4: Einsatz von neuen Medien in Integrationskursen: Dieses Kapitel argumentiert für die Einbindung neuer Medien in Integrationskurse und stellt Blended Learning als ein mögliches Modell vor.
- Kapitel 5: Gestaltungsorientierte Mediendidaktik: Dieses Kapitel stellt die gestaltungsorientierte Mediendidaktik von Kerres vor, die als Grundlage für die Konzeption in Kapitel 6 dient.
- Kapitel 6: Social Learning-Konzeption auf Facebook: Dieses Kapitel stellt eine Konzeption für ein Social Learning-Angebot auf Facebook vor, das den Spracherwerb von Migranten in Integrationskursen fördern soll. Die Konzeption berücksichtigt die Analyse der Zielgruppe, Lernziele, didaktische Methoden, die Lernorganisation und die technische Implementation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Web 2.0, Social Learning, Integrationskurse, Spracherwerb, Facebook, Blended Learning, Medienkompetenz, soziale Interaktion, gestaltungsorientierte Mediendidaktik und Konzeption.
Häufig gestellte Fragen
Kann Facebook den Spracherwerb in Integrationskursen tatsächlich fördern?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Facebook als zusätzliches Angebot die soziale Interaktion und die Medienkompetenz stärkt, was wiederum positive Auswirkungen auf den Spracherwerb von Migranten hat.
Was ist unter "Social Learning" im Web 2.0 zu verstehen?
Social Learning bezeichnet das gemeinsame Lernen in sozialen Netzwerken durch Austausch, Interaktion und Zusammenarbeit. Es nutzt die Funktionen des Web 2.0, um Lernprozesse dynamischer und partizipativer zu gestalten.
Was ist das Konzept des Blended Learning in diesem Zusammenhang?
Blended Learning ist eine Kombination aus klassischen Präsenzstunden im Integrationskurs und Online-Lernphasen (hier über Facebook). Dies ermöglicht flexibles Lernen und vertieft die im Unterricht behandelten Inhalte.
Welche Rolle spielt die gestaltungsorientierte Mediendidaktik nach Kerres?
Dieses didaktische Modell dient als theoretische Grundlage für die Erstellung des Lernangebots. Es umfasst die Analyse der Zielgruppe, die Definition von Lehrinhalten und die Wahl der technischen Umsetzung.
Wie wird die Zielgruppe der Migranten bei der Facebook-Konzeption berücksichtigt?
Die Konzeption führt eine detaillierte Zielgruppenanalyse durch, um sicherzustellen, dass die Inhalte und Methoden den sprachlichen Voraussetzungen und den Lebenswelten der Teilnehmenden entsprechen.
- Citar trabajo
- Konstantina Roussi (Autor), 2013, Social Learning in Integrationskursen. Eine Konzeption zur Förderung des Spracherwerbs auf Facebook, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387366