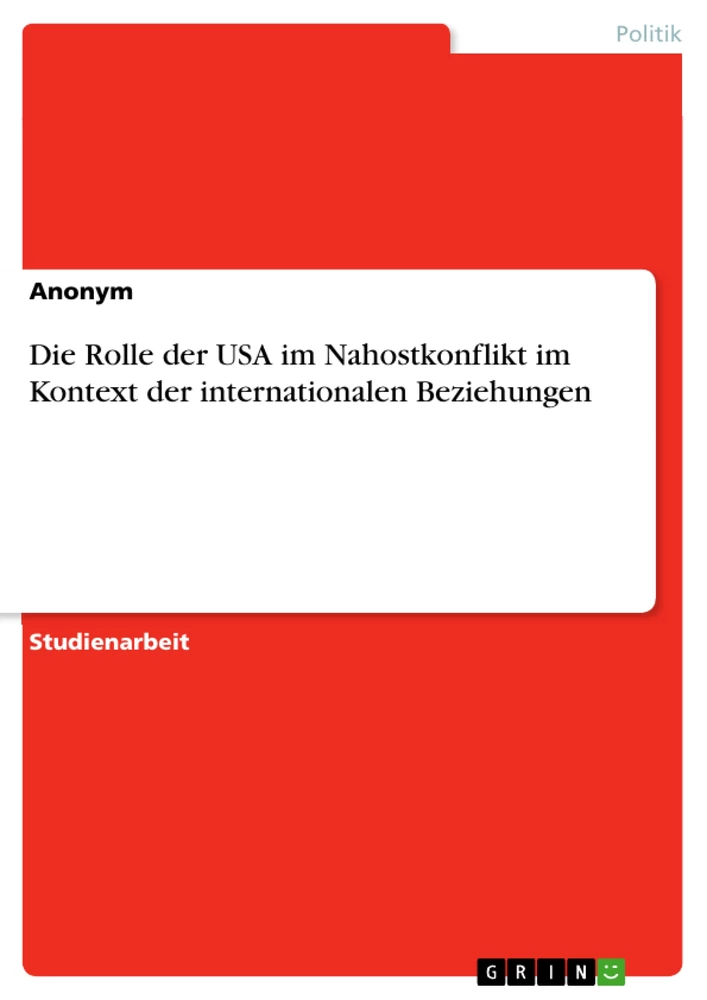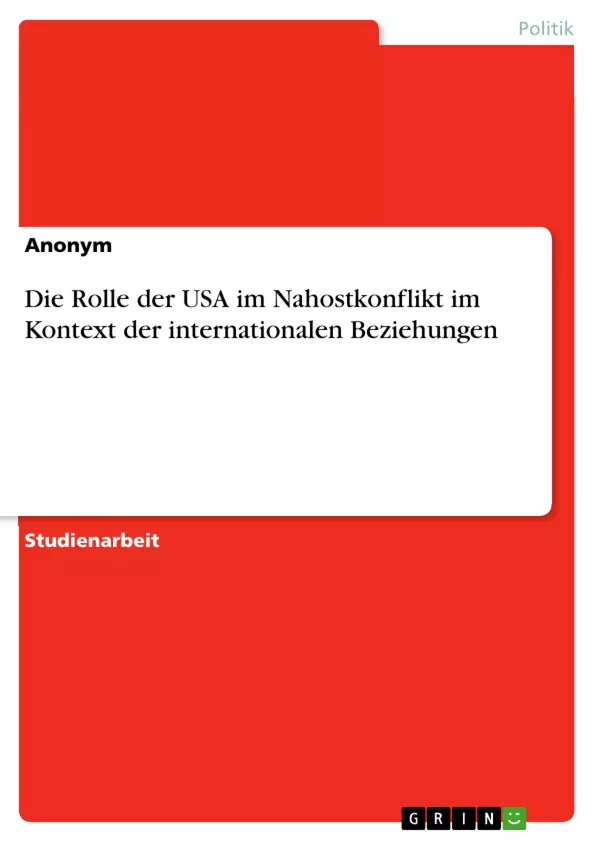Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit richtet sich überwiegend auf die Rolle der USA im Nahostkonflikt, wobei im Rahmen der politikwissenschaftlichen Teildisziplin der Internationalen Beziehungen besonders die Interdependenzen zwischen den Vereinigten Staaten und den beiden Konfliktparteien untersucht werden. Im Mittelpunkt dieser wissenschaftlichen Analyse steht die Frage, warum die USA seit beinahe einem halben Jahrhundert am Konflikt partizipieren und trotz seltener Fortschritte zur Beilegung der Auseinandersetzungen und einem hohen politischen Aufwand, kontinuierlich die Rolle des Vermittlers übernehmen.
Der Beantwortung dieser Frage sollen zwei der wichtigsten Theorien der Internationalen Beziehungen dienlich sein. So erfolgt einerseits eine stetige Bezugnahme aus neorealistischer, andererseits aus liberalistischer Perspektive, was dem Untersuchungsgegenstand den unverzichtbaren theoretischen Bezugsrahmen liefert. Das dritte Kapitel wird sich mit den historischen Entwicklungen des Nahostkonfliktes beschäftigen. Neben den Hauptkonfliktpunkten zwischen Israelis und Palästinensern befinden sich hier die besonderen politischen Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Staaten von Amerika im Fokus, um zu verstehen, inwieweit diese das Geschehen im Palästinakonflikt beeinflussen.
Anschließend steht die US-amerikanische Wirkungsweise in der Region auf dem Prüfstand. Um nämlich die Frage nach dem "Warum?" zu beantworten, bedürfen das "Wie?" und das "Was?" vorerst einer eingehenderen Betrachtung. Der fünfte Abschnitt dieser Arbeit wird sich einer Auswahl von bedeutenden Faktoren widmen, welche sich auf das Denken und Handeln der US-Politik im Nahostkonflikt auswirken. Speziell auf die Wechselwirkungen zwischen Exekutive und Legislative sowie auf die Rolle der öffentlichen Meinung soll hier verstärkt Bezug genommen werden.
Im sechsten Punkt stehen die Interessen der USA bezüglich ihres Auftretens im Nahen Osten im Mittelpunkt der Analyse. Die Untersuchungen wirtschaftlicher Ziele sowie sicherheits- und machtpolitischer Aspekte, sollen letztlich jene Ergebnisse liefern, welche zur Lösung der eingangs aufgeworfenen Problemstellung noch fehlen. Außerdem wird hier ein Ausblick auf mögliche künftige Entwicklungen erfolgen, um das Fazit der Forschungsarbeit in eine angemessene Relation zu den bisherigen Ereignissen zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neorealistische und liberalistische Denkmuster
- Historischer Abriss des Nahostkonfliktes
- Hauptkonfliktpunkte
- Entwicklung der amerikanisch-israelischen Beziehungen
- Wirkungsweise der USA
- US-interne Einflussfaktoren
- Interdependenz zwischen Exekutive und Legislative
- Öffentliche Meinung und Identität
- Die Israel-Lobby
- Interessenssphäre der USA
- Wirtschaftliche Interessen
- Frieden, Sicherheit und Macht
- Kein Ende in Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Rolle der USA im Nahostkonflikt im Kontext der Internationalen Beziehungen. Im Fokus stehen die Interdependenzen zwischen den USA und den Konfliktparteien, insbesondere die Frage, warum sich die USA seit Jahrzehnten als Vermittler engagieren, obwohl nur wenige Fortschritte erzielt wurden.
- Die Rolle der USA im Nahostkonflikt als Vermittler und Einflussfaktor
- Die Interdependenzen zwischen den USA und den Konfliktparteien
- Der Einfluss neorealistischer und liberalistischer Denkmuster auf das US-Engagement im Nahostkonflikt
- Die historischen Entwicklungen des Nahostkonfliktes
- US-interne Einflussfaktoren auf die US-Politik im Nahostkonflikt
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den Nahostkonflikt als einen der bedeutendsten internationalen Konflikte vor und führt die komplexe Situation und die vielfältigen Akteure auf.
- Kapitel 2 widmet sich der Analyse neorealistischer und liberalistischer Denkmuster in der Internationalen Beziehungen, um die beiden zentralen Perspektiven für die Analyse des US-Engagements im Nahostkonflikt aufzuzeigen.
- Kapitel 3 behandelt die historischen Entwicklungen des Nahostkonfliktes, beleuchtet die Hauptkonfliktpunkte und die besonderen Beziehungen zwischen Israel und den USA.
- Kapitel 4 untersucht die US-amerikanische Wirkungsweise im Nahen Osten, um die Frage nach dem „Warum?“ durch eine detaillierte Betrachtung des „Wie?“ und „Was?“ zu beantworten.
- Kapitel 5 stellt die US-internen Einflussfaktoren auf die US-Politik im Nahostkonflikt vor, insbesondere die Wechselwirkungen zwischen Exekutive und Legislative, die öffentliche Meinung und den Einfluss der pro-israelischen Lobby.
- Kapitel 6 konzentriert sich auf die Interessen der USA im Nahen Osten, sowohl wirtschaftliche als auch sicherheits- und machtpolitische Aspekte, und bietet einen Ausblick auf mögliche zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Nahostkonflikt, Internationale Beziehungen, USA, Israel, Palästina, Neorealismus, Liberalismus, Vermittlerrolle, Einflussfaktoren, Interessenssphäre, öffentliche Meinung, Israel-Lobby.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle nehmen die USA im Nahostkonflikt ein?
Die USA agieren seit Jahrzehnten als zentraler Vermittler zwischen Israel und den Palästinensern, wobei sie gleichzeitig enge politische und militärische Beziehungen zu Israel pflegen.
Welche Theorien erklären das US-Engagement?
Die Arbeit nutzt den Neorealismus (Fokus auf Macht und Sicherheit) und den Liberalismus (Fokus auf Kooperation und Institutionen), um die US-Politik zu analysieren.
Was sind die wirtschaftlichen Interessen der USA im Nahen Osten?
Wesentliche Interessen liegen in der Sicherung der Energieversorgung (Öl) und der Stabilität der Handelswege in der Region.
Welchen Einfluss hat die „Israel-Lobby“ in den USA?
Die pro-israelische Lobby gilt als bedeutender US-interner Einflussfaktor, der die Entscheidungsfindung in der Legislative und Exekutive maßgeblich mitgestaltet.
Warum gibt es trotz US-Vermittlung kaum Fortschritte?
Die Arbeit untersucht komplexe Interdependenzen, historische Belastungen und widersprüchliche Interessenlagen, die eine dauerhafte Lösung des Konflikts erschweren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Die Rolle der USA im Nahostkonflikt im Kontext der internationalen Beziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387406