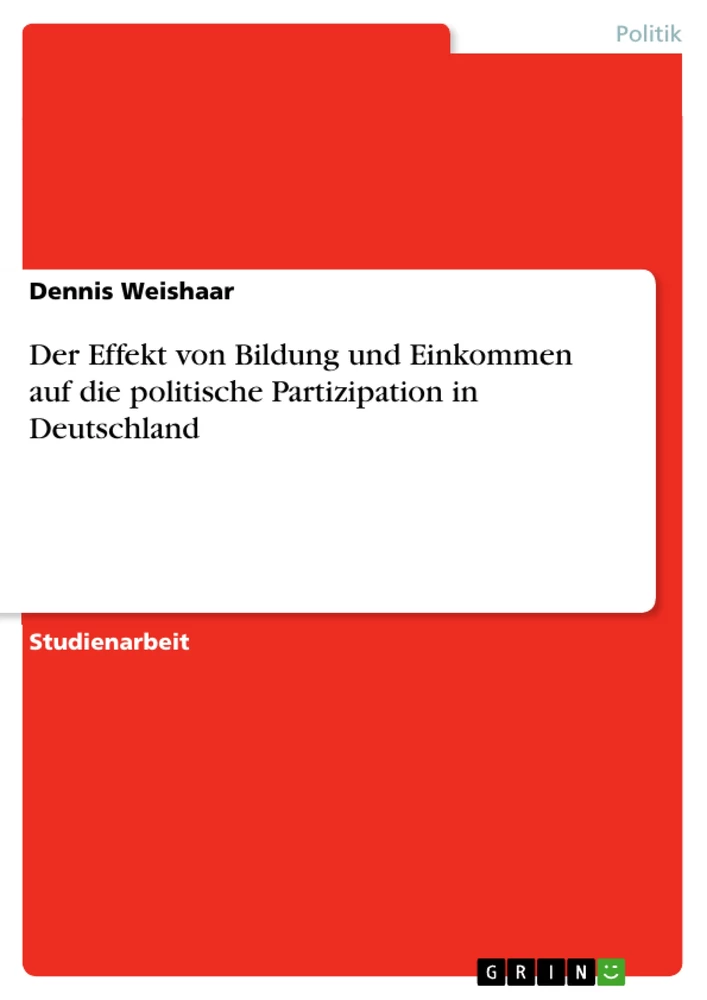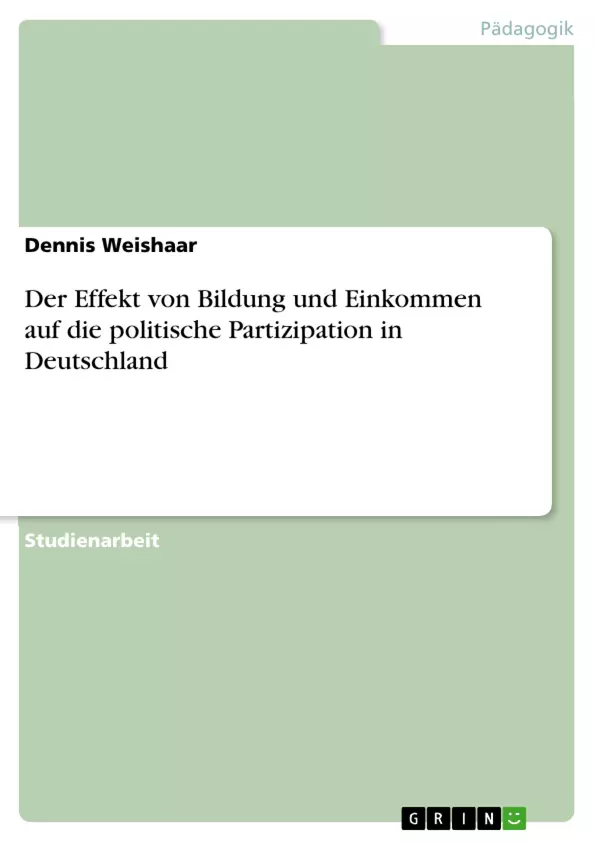Diese Arbeit setzt sich mit den Fragen auseinander, ob Bildungs- und Einkommensunterschiede einen Effekt auf verschiedene Formen politischer Partizipation haben und ob das damit einhergehende demokratische Versprechen von politischer Gleichheit gewährleistet wird.
Kann man in Deutschland so etwas wie soziale Ungleichheit feststellen? Wenn ja, wirkt sich diese auch auf die politischen Partizipationsformen aus? Diese Fragen stellen sich unweigerlich, wenn nach einem Grund für den seit den 1970er Jahren zwar diskontinuierlichen, aber, verglichen mit heutigen Quoten, starken Gesamtrückgang der Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen gesucht wird. Dass in Deutschland zumindest divergierende Einkommensverhältnisse schon seit längerer Zeit vorliegen, zeigen OECD-Berichte. Diesen zufolge verdienten Mitte der 1980er Jahre die reichsten zehn Prozent der Bundesbürger noch fünf Mal so viel wie die ärmsten zehn Prozent, wobei sich das Verhältnis bis zum Jahr 2014 auf 7 : 1 erhöht hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Demokratie und Gleichheit
- Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus in der BRD
- Ein Blick in die Geschichte
- Wahlen zum Bundestag
- Weitere Formen politischer Partizipation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern soziale Ungleichheit in Deutschland die politische Partizipation beeinflusst. Insbesondere wird analysiert, wie sich unterschiedliche Grade bezüglich des Einkommens- und Bildungsstandes der Bundesbürger auf die soziale Selektivität bei verschiedenen Formen politischer Partizipation auswirken.
- Das Versprechen der Demokratie auf politische Gleichheit
- Soziale Ungleichheit als Einflussfaktor auf politische Partizipation
- Der Einfluss von Einkommen und Bildung auf die Wahlbeteiligung
- Die Bedeutung von Partizipation für die Legitimität der Demokratie
- Die Analyse verschiedener Formen politischer Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 definiert das Versprechen der Demokratie auf politische Gleichheit und erläutert den Begriff der sozialen Ungleichheit, der sich explizit auf politische Partizipationsmöglichkeiten anwenden lässt.
Kapitel 3.1 beleuchtet die Entwicklung der politischen Partizipation in Deutschland seit den 1970er Jahren und geht dabei auf den Rückgang der Wahlbeteiligung sowie die Veränderung von Einkommens- und Bildungsunterschieden ein.
Kapitel 3.2 analysiert den Einfluss der Untersuchungsvariablen Bildung und Einkommen auf die Beteiligung bei Wahlen zum Bundestag und diskutiert die Problematik sozialer Selektivität für die Legitimation der Demokratie.
Kapitel 3.3 setzt sich mit dem Einfluss von Bildung und Einkommen auf weitere Formen politischer Partizipation auseinander und untersucht, ob diese einen geringeren Grad sozialer Selektivität aufweisen als Bundestagswahlen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen soziale Ungleichheit, politische Partizipation, Demokratie, Kapitalismus, Bildung, Einkommen, Wahlbeteiligung, Legitimität und soziale Selektivität. Weitere wichtige Begriffe sind „One man, one vote“-Prinzip, politische Gleichheit, und die verschiedenen Formen politischer Partizipation.
- Quote paper
- B.A. Dennis Weishaar (Author), 2015, Der Effekt von Bildung und Einkommen auf die politische Partizipation in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387449