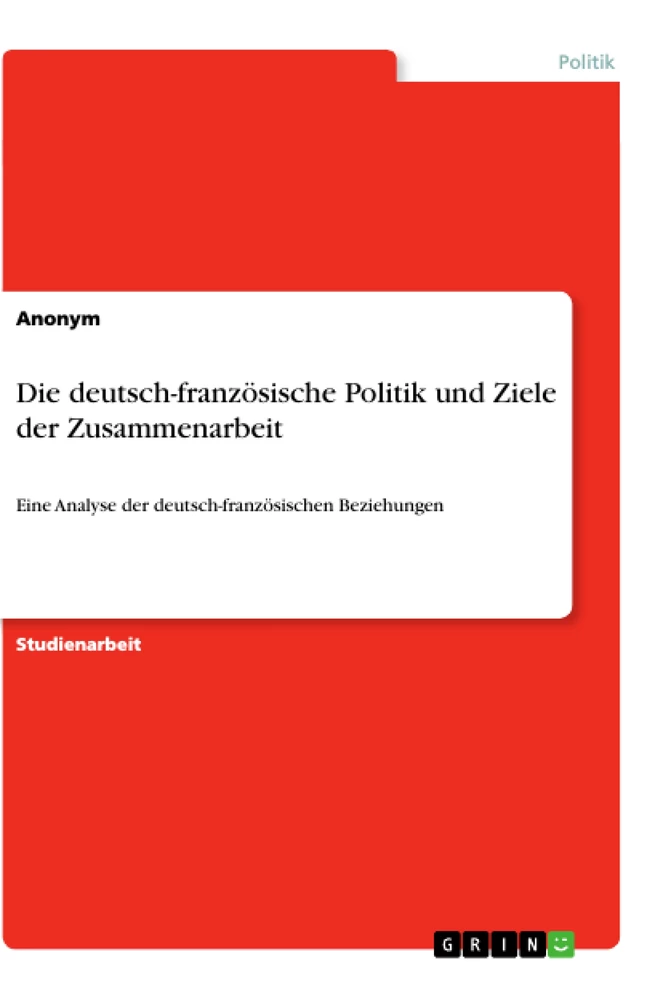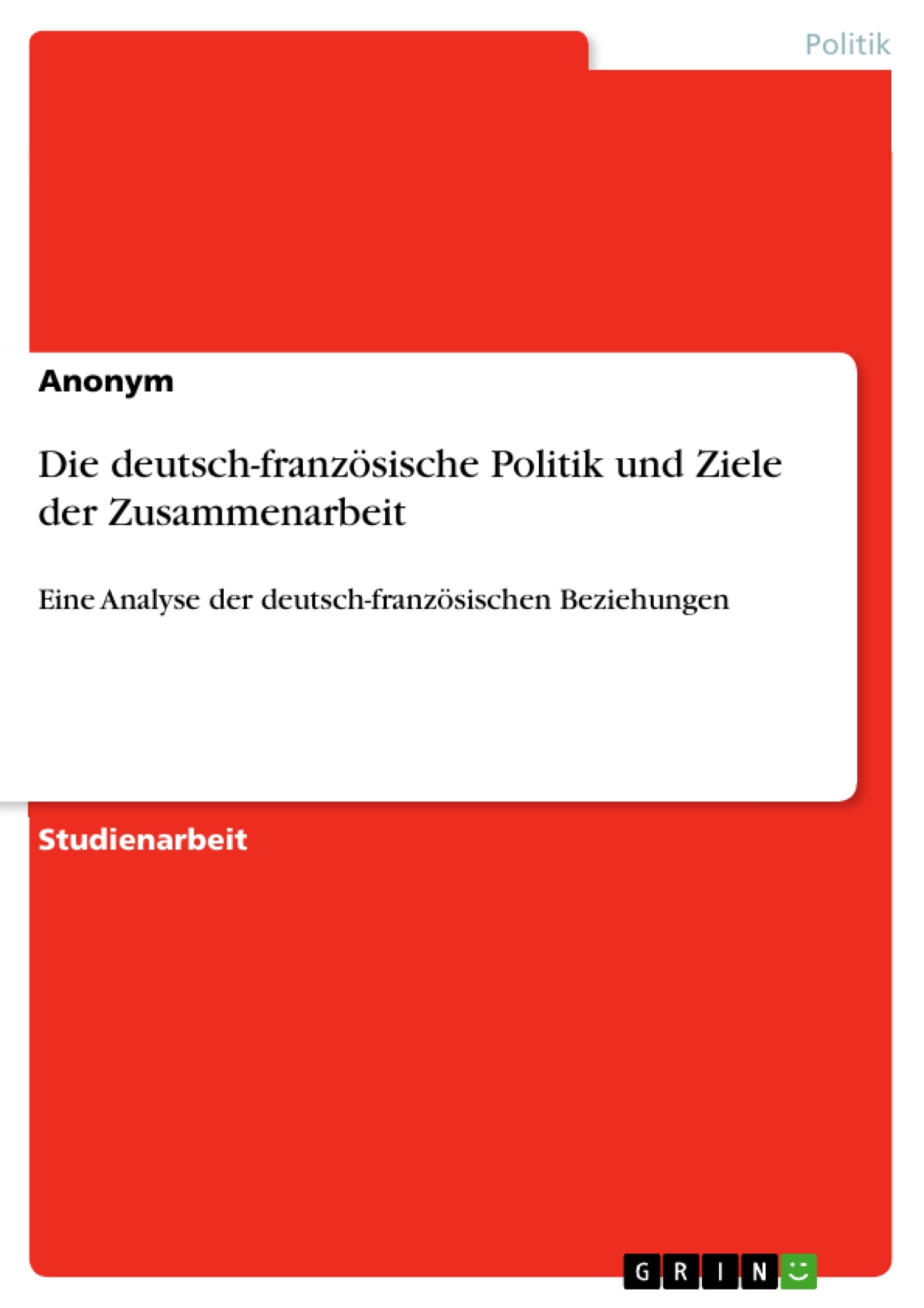Die Bundesrepublik Deutschland und die Französische Republik bilden gemeinsam mit England das ökonomische, politische und bevölkerungstechnische Rückgrat der Europäischen Union und Europas im Ganzen. Nach jahrhundertelanger, oft als Erbfeindschaft bezeichneter Feindseligkeit, arbeiten Deutschland und Frankreich auf unterschiedlichsten Ebenen intensiv zusammen.
Doch aus welchen Gründen kooperiert Deutschland nun seit geraumer Zeit mit dem ehemaligen Feind? Dieser Frage widmet sich diese wissenschaftliche Arbeit. Um diese Frage beantworten zu können, wird in dieser Arbeit die Beziehung in drei Themenbereiche geteilt und diese behandelt. Zu Beginn werden die politischen und militärischen Beziehungen behandelt, daraufhin die sozio-kulturellen und am Ende die ökonomischen. Dies soll einen umfangreichen Überblick über jede wichtige Form der Beziehung ermöglichen.
Auf Grundlage des Realismus wird versucht, die Frage nach den Gründen für die Zusammenarbeit zu beantworten. Da die drei Themenbereiche sich deutlich unterscheiden, erschließt sich jedes auf eine etwas andere Art und Weise; so wird die politische und militärische Kooperation anhand eines Beispiels erläutert werden, die sozio-kulturellen Beziehungen nehmen eher Bezug auf die Geschichte und die Unterschiede der beiden Kulturen und die ökonomische Zusammenarbeit wird vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Wirtschaftssysteme betrachtet. Am Ende jedes Abschnittes wird ein kurzes Fazit gezogen, welches speziell für diesen Teil die Gründe für eine Kooperation aufzeigt. Denn aus Sicht des Realismus ist eine Kooperation eher selten und bedarf guter Gründe für den Akteur, diese einzugehen. Am Ende wird in einem zusammenfassenden Fazit die Kausalkette erläutert, die zu diesen deutsch-französischen Beziehungen führt.
Inhaltsverzeichnis
- MILITÄRISCHE UND AUßENPOLITISCHE BEZIEHUNGEN
- Herausforderungen und die Deutsch-Französische Brigade
- Ende des Realismus in der Sicherheitspolitik
- DIE SOZIO-KULTURELLEN BEZIEHUNGEN
- Ein kulturhistorischer Abriss
- Der Schutz der eigenen Kultur
- Unterschiede und Zusammenarbeit
- Der Realismus in den sozial-kulturellen Beziehungen
- DIE ÖKONOMISCHEN BEZIEHUNGEN
- Unterschiedliche Wirtschaftssysteme
- Wirtschaftliche Vorteile Deutschlands
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die deutsch-französischen Beziehungen und beleuchtet die Gründe für die Zusammenarbeit nach jahrhundertelanger Feindschaft. Die Arbeit analysiert die Beziehung aus drei Perspektiven: politische und militärische Beziehungen, sozio-kulturelle Beziehungen und ökonomische Beziehungen. Dabei wird der Realismus als theoretischer Rahmen verwendet, um die Gründe für die Kooperation zu erklären.
- Die Entwicklung der deutsch-französischen Beziehungen im Kontext des Realismus
- Analyse der militärischen und außenpolitischen Zusammenarbeit
- Untersuchung der sozio-kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Bewertung der wirtschaftlichen Beziehungen vor dem Hintergrund unterschiedlicher Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Zielen Deutschlands in der militärischen und außenpolitischen Kooperation mit Frankreich. Er analysiert die Entwicklung der Beziehungen vor dem Hintergrund des Realismus und untersucht die Rolle der Deutsch-Französischen Brigade als Beispiel für die Zusammenarbeit. Der zweite Teil befasst sich mit den sozio-kulturellen Beziehungen und beleuchtet den historischen Hintergrund, kulturelle Unterschiede und die Bedeutung des Realismus in diesem Kontext. Der dritte Teil der Arbeit analysiert die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, wobei die Unterschiede in den Wirtschaftssystemen und die ökonomischen Vorteile Deutschlands im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Deutsch-Französische Beziehungen, Realismus, Sicherheitspolitik, Sozio-kulturelle Beziehungen, Ökonomische Beziehungen, Deutsch-Französische Brigade, Europäische Integration, Nationale Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Warum arbeiten Deutschland und Frankreich trotz früherer Feindschaft zusammen?
Die Zusammenarbeit basiert auf ökonomischen Vorteilen, sicherheitspolitischen Notwendigkeiten und dem gemeinsamen Ziel, das politische Rückgrat der Europäischen Union zu bilden.
Was ist die "Deutsch-Französische Brigade"?
Sie ist ein konkretes Beispiel für die militärische Kooperation beider Länder und symbolisiert die Überwindung des Realismus in der Sicherheitspolitik zugunsten gemeinsamer Verteidigungsstrukturen.
Wie unterscheiden sich die Wirtschaftssysteme beider Länder?
Die Arbeit analysiert die ökonomische Zusammenarbeit vor dem Hintergrund unterschiedlicher Traditionen (z.B. soziale Marktwirtschaft vs. stärker staatsorientierte Ansätze in Frankreich).
Welche Rolle spielt der "Realismus" in dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Der Realismus dient als theoretischer Rahmen, um zu erklären, warum Staaten Kooperationen eingehen, wenn diese ihren nationalen Interessen und ihrer Sicherheit dienen.
Was sind die sozio-kulturellen Grundlagen der Beziehung?
Die Beziehung ist durch einen intensiven kulturellen Austausch geprägt, der darauf abzielt, historische Vorurteile abzubauen und die europäische Integration auf gesellschaftlicher Ebene zu festigen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Die deutsch-französische Politik und Ziele der Zusammenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387477