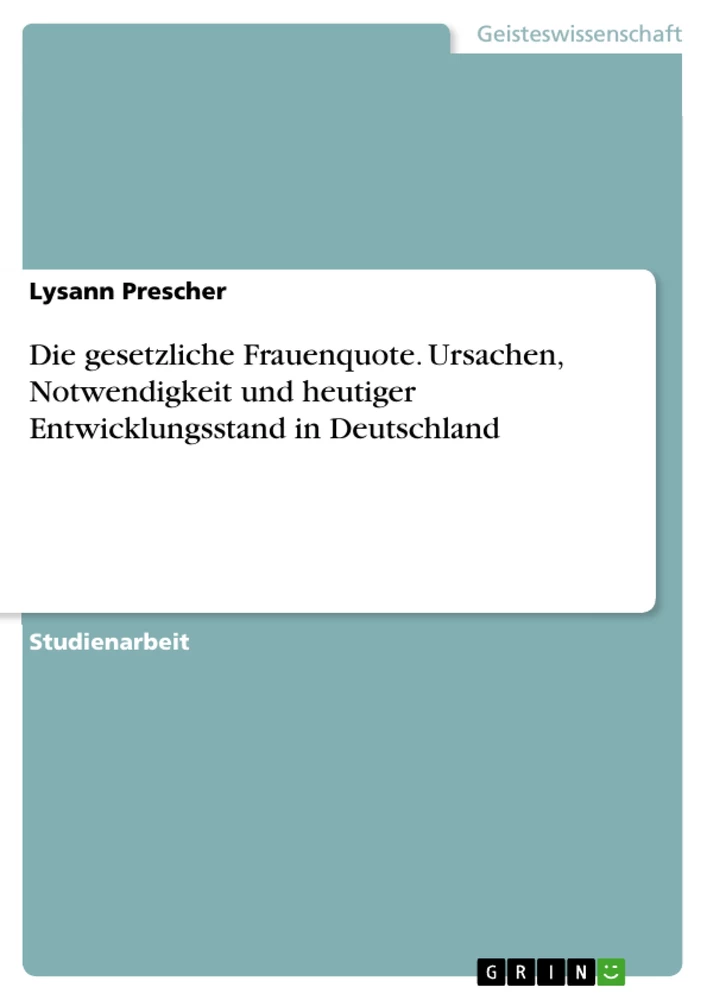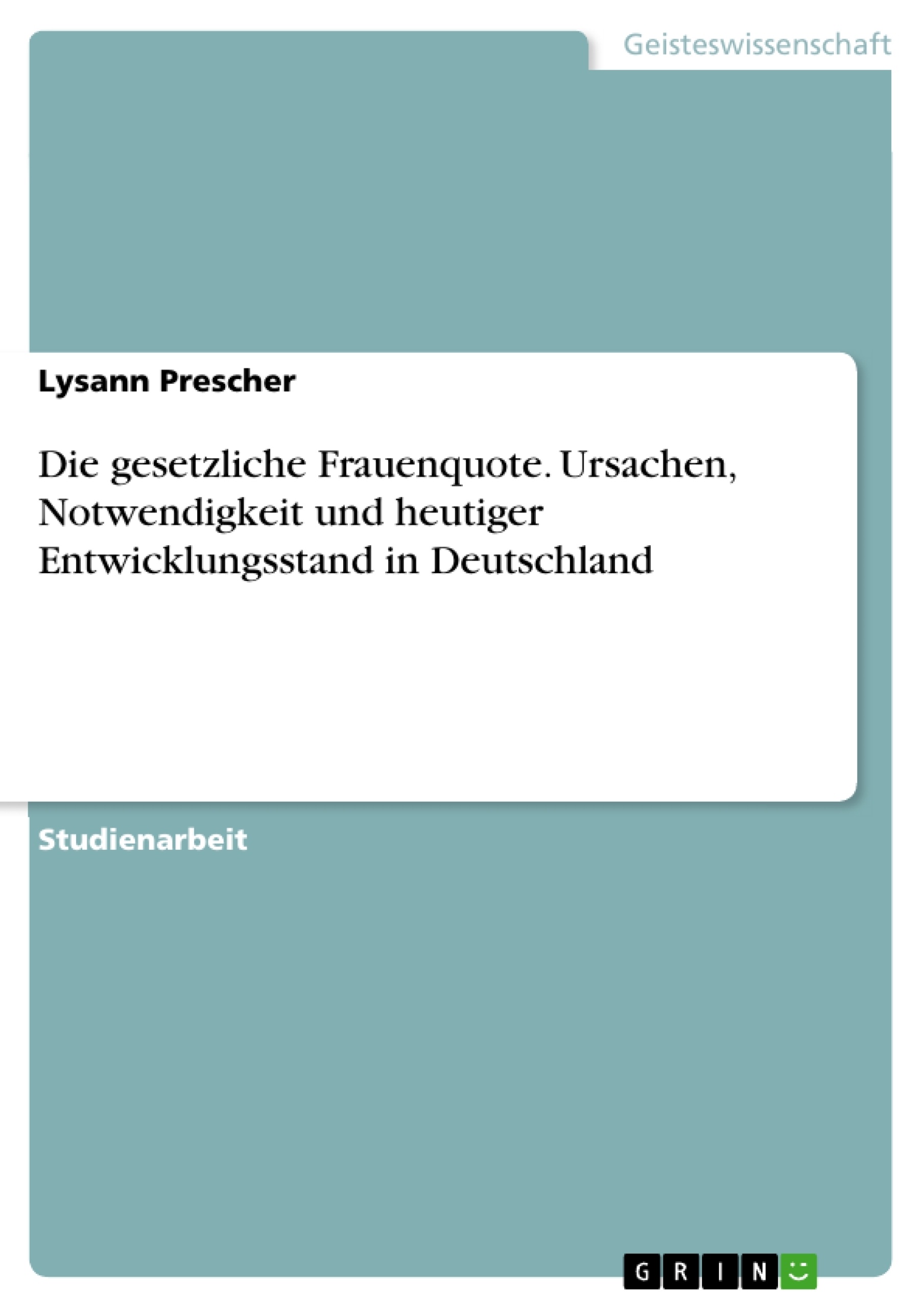Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach den Ursachen und der Notwendigkeit der Frauenquote. Zudem wird versucht darzustellen, ob die 2015 eingeführte Quotenregelung erfolgreich greift. Dazu werden zunächst die verwendeten Begrifflichkeiten näher definiert. Anschließend werden verschiedene Ansätze erläutert, die die Unterrepräsentation von Frauen in großen Unternehmen in ihren Ursachen untersuchen. Seit Jahren wird über die Einführung einer solchen Quote diskutiert, dabei kristallisieren sich Vor- und Nachteile heraus, die Aufschluss über die verschiedenen Lager rund um die gesetzliche Frauenquote geben werden. In dieser Betrachtung wird zudem ein spezieller Bezug auf die Privatwirtschaft in Deutschland genommen, auf die sich die gesetzliche Frauenquote vorerst ausrichtet. Abschließend folgt eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und ein Ausblick auf die weitere Entwicklung der Frauenanteile in Führungspositionen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Führungsposition
- Chancengleichheit
- Frauenquote
- Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen
- Differenztheoretische Ansätze
- Strukturell ideologische Ansätze
- Diskussion um die Frauenquote
- Situation nach Einführung der Frauenquote in Deutschland
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und die Notwendigkeit der Frauenquote in Deutschland und analysiert, ob die 2015 eingeführte Quotenregelung erfolgreich greift. Sie beschäftigt sich mit der Definition von Führungspositionen, Chancengleichheit und den Inhalten des Gesetzes der Frauenquote und beleuchtet verschiedene Ansätze, die die Unterrepräsentation von Frauen in Unternehmen erklären. Zudem wird die Debatte um die Frauenquote und ihre Auswirkungen auf die deutsche Privatwirtschaft beleuchtet.
- Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen
- Definition und Bedeutung von Chancengleichheit
- Rechtliche Grundlage und Umsetzung der Frauenquote
- Diskussion um die Vor- und Nachteile der Frauenquote
- Bewertung der Effektivität der Frauenquote in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen dar und verdeutlicht die Notwendigkeit der Frauenquote. Sie beleuchtet die aktuelle Situation in Deutschland und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe der Arbeit, insbesondere Führungsposition, Chancengleichheit und Frauenquote. Es erläutert die verschiedenen Facetten dieser Konzepte und ihre Relevanz im Kontext der Frauenquote.
- Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen für die geringe Anzahl von Frauen in Führungspositionen. Es beleuchtet unterschiedliche Ansätze, die die Unterrepräsentation von Frauen erklären, darunter Differenztheoretische Ansätze und Strukturell ideologische Ansätze.
- Diskussion um die Frauenquote: Dieses Kapitel widmet sich der kontroversen Debatte um die Frauenquote. Es beleuchtet Argumente für und gegen die Einführung der Quote und zeigt die verschiedenen Positionen in dieser Diskussion auf.
- Situation nach Einführung der Frauenquote in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Situation in Deutschland nach der Einführung der Frauenquote im Jahr 2015. Es analysiert die Auswirkungen der Quote auf die Zusammensetzung von Aufsichtsräten und Vorständen in Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Genderforschung und der Arbeitswelt. Schlüsselwörter sind: Frauenquote, Chancengleichheit, Führungsposition, Unterrepräsentation von Frauen, Geschlechterstereotype, Differenztheorie, Strukturtheoretische Ansätze, Diskriminierung, Diversität, Inklusion, deutsche Privatwirtschaft, gesetzliche Regelungen, gesellschaftliche Veränderungen.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die gesetzliche Frauenquote in Deutschland eingeführt?
Die Quotenregelung für Führungspositionen in großen Unternehmen wurde im Jahr 2015 eingeführt.
Was sind die Ursachen für die Unterrepräsentation von Frauen?
Wissenschaftliche Ansätze unterscheiden zwischen differenztheoretischen (individuelle Unterschiede) und strukturell-ideologischen Faktoren (gesellschaftliche Barrieren).
Welche Unternehmen sind von der Frauenquote betroffen?
Die Regelung richtet sich vorerst primär an börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen in der deutschen Privatwirtschaft.
Was sind die Hauptargumente in der Diskussion um die Quote?
Befürworter sehen sie als notwendiges Mittel für echte Chancengleichheit, Kritiker bemängeln den Eingriff in die unternehmerische Freiheit.
Wie wird der Erfolg der Frauenquote bisher bewertet?
Die Arbeit analysiert, ob die Quote tatsächlich zu einer nachhaltigen Veränderung in Aufsichtsräten und Vorständen geführt hat.
- Quote paper
- Lysann Prescher (Author), 2017, Die gesetzliche Frauenquote. Ursachen, Notwendigkeit und heutiger Entwicklungsstand in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387508