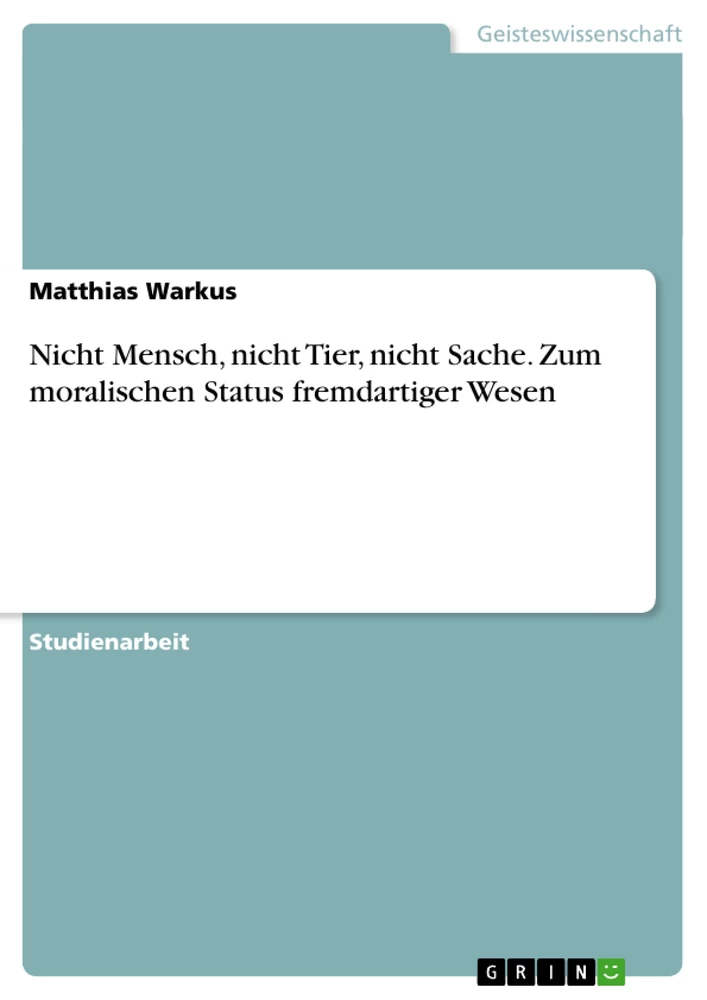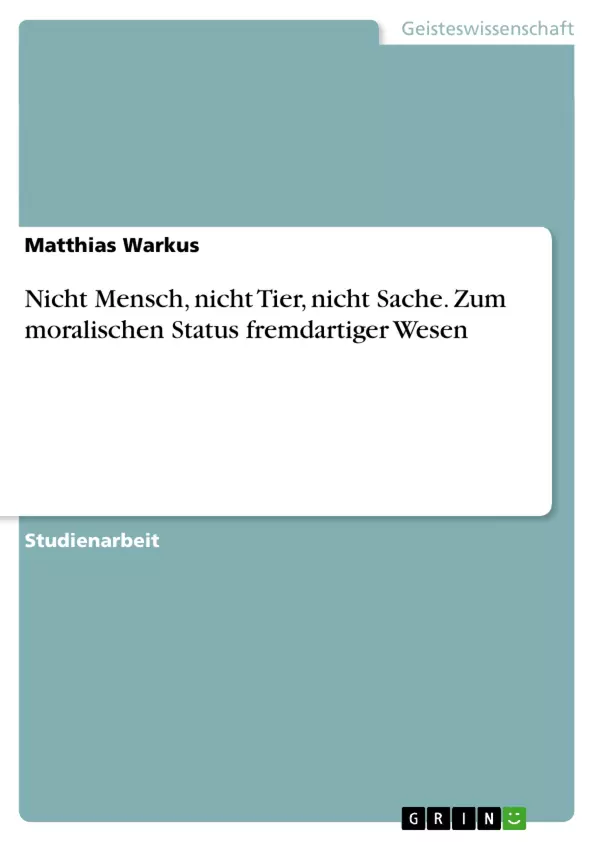In der embryonalethischen Diskussion ist die ständige Herausforderung die Frage nach dem moralischen Status des Embryos.
Es sei dahingestellt, ob Embryonen Menschen sind oder nicht. Dass der Embryo uns lebensweltlich nicht so begegnet wie geborene Menschen, ist jedoch weithin unwidersprochen, genauso auch, dass wir traditionell einen anderen Umgang mit Embryonen als mit geborenen Menschen pflegen. Dazu gehört, dass wir die Beendigung des Lebens eines Embryos rechtlich grundsätzlich minder schwer bewerten als die dessen eines geborenen Menschen, aber auch -um ein weniger extremes Beispiel zu geben-, dass es als deutlich ungehöriger gilt, einen Embryo im Mutterleib durch Rauchen zu schädigen als sich selbst oder andere bereits geborene passive Mitraucher.
Wegen dieser anerkannten Andersartigkeit sind zahlreiche Argumente entwickelt worden, um den Status des Embryos zu klären. Der Nutzwert dieser Überlegungen ist einsichtig: Die theoretisch mehr oder weniger unreflektierten Rechtssätze, die das Verhalten unserer Gesellschaft zur Erzeugung, zur Zerstörung und zur Manipulation von Embryonen innerhalb und außerhalb des Mutterleibes regeln, sollen auf eine saubere Basis gestellt werden.
Wenn das Nachdenken über andere Arten von Wesen als die Menschen, die uns lebensweltlich begegnen, in der allgemeinen Moralphilosophie sinnvoll sein kann, dann beim Nachdenken über Embryonen, die selbst schon "etwas anders" sind, der Bezug zu "ganz anderen" Wesen erst recht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Motivation
- 1.1 Ansatz
- 1.2 Sprachregelungen
- 2 Konzepte von Fremdartigkeit
- 2.1 Klassische Konzepte immaterieller Wesen
- 2.1.1 Götter
- 2.1.2 Engel und Dämonen
- 2.2 Konzepte materieller Wesen außerhalb der irdischen Evolution
- 2.2.1 Außerirdisches Leben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den moralischen Status fremdartiger Wesen, die weder Mensch, Tier noch Sache sind. Ziel ist es, verschiedene Konzepte von Fremdartigkeit zu beleuchten und deren Auswirkungen auf die Zuerkennung moralischer Statusprädikate zu diskutieren. Die Arbeit bezieht sowohl philosophische Primärquellen als auch spekulativen Fiktion ein.
- Der moralische Status von Embryonen
- Konzepte immaterieller Wesen (Götter, Engel, Dämonen)
- Konzepte materieller Wesen außerhalb der irdischen Evolution (außerirdisches Leben)
- Kriterien zur Bestimmung des moralischen Status
- Die Bedeutung von Sprachregelungen in der ethischen Diskussion
Zusammenfassung der Kapitel
1 Motivation: Die Arbeit untersucht den moralischen Status fremdartiger Wesen, ausgehend von der Debatte um den moralischen Status von Embryonen. Die Autorin argumentiert, dass Überlegungen zum moralischen Status von Embryonen Anknüpfungspunkte zu Überlegungen über "ganz andere" Wesen bieten. Die Arbeit verwendet philosophische Quellen und spekulativen Fiktion als methodische Grundlage. Das Ziel ist eine saubere Basis für Rechtssätze zu schaffen, die den Umgang mit Embryonen regeln.
1.1 Ansatz: Dieser Abschnitt skizziert den Ansatz der Arbeit. Er konzentriert sich auf den moralischen Status von Wesen, die weder Mensch, Tier noch Sache sind, möglicherweise aber aus solchen hervorgegangen sind. Es wird ein Überblick über verschiedene Konzepte von Fremdartigkeit gegeben, beginnend mit klassischen Konzepten immaterieller Wesen (Götter, Engel, Dämonen) über nicht aus dem irdischen Evolutionsprozess hervorgegangene Wesen (außerirdisches Leben, künstliches Leben, maschinelle Intelligenz) bis hin zu Wesen aus dem irdischen Evolutionsprozess (modifizierte Tiere und Menschen). Die Autorin beabsichtigt, anhand verschiedener Kriterien die Auswirkungen des Einbezugs solcher Wesen auf die Zuerkennung moralischer Statusprädikate zu untersuchen.
1.2 Sprachregelungen: Dieser Abschnitt diskutiert die Wahl des Begriffs "fremdartige Wesen" als neutralen Oberbegriff für die vielfältigen Konzepte. Die Autorin erklärt die Notwendigkeit, begriffliche Fußangeln zu vermeiden, die durch Begriffe wie "nichtmenschliche Intelligenz" entstehen könnten. Der Begriff "Person" wird als neutrale Alternative zu "Menschenwürde" verwendet, um den besonderen Status von Menschen in unserer Lebenswelt zu bezeichnen. Die Herausforderungen der Beschreibung nachträglich als mehr als tierisch erkannter Tiere werden erläutert.
2 Konzepte von Fremdartigkeit: Dieser Abschnitt stellt einen Katalog denkbarer fremdartiger Wesen vor, wobei die Bewertung erst später erfolgt. Er beginnt mit klassischen Konzepten immaterieller Wesen.
2.1 Klassische Konzepte immaterieller Wesen: Hier werden klassische Konzepte immaterieller Wesen wie Götter, Engel und Dämonen vorgestellt. Die Autorin betont, dass diese Konzepte bereits vor dem naturwissenschaftlichen Fortschritt existierten und daher nicht mit modernen Konzepten wie Energiewesen oder Geistern gleichgesetzt werden sollten.
2.1.1 Götter: Dieser Unterabschnitt konzentriert sich auf die besondere Stellung von Göttern, insbesondere des theistischen Gottes, der als vollkommen gut und als Grundlage moralischer Verpflichtung gilt. Die Autorin diskutiert die Bedeutung von Gotteskonzepten für die Akzeptanz fremdartiger Wesen mit gleichem oder höherem moralischem Status als der Mensch. Schöpfungsmythen und Inkarnationsmythen werden als Beispiele für den Versuch, das besondere Verhältnis zwischen Göttern und Menschen zu begründen, angeführt. Engel werden als eine Art dauerhafte Brückenstellung zwischen Göttern und Menschen betrachtet.
2.1.2 Engel und Dämonen: Dieser Abschnitt befasst sich mit Engeln und Dämonen als klassische Beispiele immaterieller Wesen. Obwohl empirisch ungreifbar, betont die Autorin ihre Bedeutung in früheren ethischen Theorien, die zeigen, dass auch zu Zeiten, in denen man über fremde Wesen materieller Art nicht nachdachte, Geltung für nichtmenschliche Personen angestrebt wurde.
2.2 Konzepte materieller Wesen außerhalb der irdischen Evolution: Dieser Abschnitt beginnt mit der Diskussion über außerirdisches Leben.
2.2.1 Außerirdisches Leben: Dieser Abschnitt behandelt die philosophischen Implikationen von außerirdischem Leben. Die Autorin hinterfragt die Annahme anthropomorpher Außerirdischer und diskutiert die Möglichkeit völlig anderer biologischer Existenzen, Wahrnehmungen und Erkenntnisformen. Voltaires Mikromegas und Kants Überlegungen zu den Bewohnern der Gasriesen werden als Beispiele herangezogen, um die potenziellen Unterschiede in Wahrnehmung und Fähigkeiten hervorzuheben.
Schlüsselwörter
Moralische Status, Fremdartigkeit, Embryonen, immaterielle Wesen, materielle Wesen, außerirdisches Leben, Intelligenz, Person, Ethik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Der moralische Status fremdartiger Wesen
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den moralischen Status von Wesen, die weder Mensch, Tier noch Sache sind. Sie beleuchtet verschiedene Konzepte von Fremdartigkeit und deren Auswirkungen auf die Zuerkennung moralischer Statusprädikate. Die Arbeit bezieht sowohl philosophische Primärquellen als auch spekulativen Fiktion ein.
Welche Arten von "fremdartigen Wesen" werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet sowohl immaterielle Wesen (Götter, Engel, Dämonen) als auch materielle Wesen außerhalb der irdischen Evolution (außerirdisches Leben) und Wesen, die aus dem irdischen Evolutionsprozess hervorgegangen sind (z.B. modifizierte Tiere und Menschen). Der Fokus liegt auf Wesen, die möglicherweise einen moralischen Status beanspruchen könnten.
Welche konkreten Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den moralischen Status von Embryonen, Konzepte immaterieller und materieller Wesen, Kriterien zur Bestimmung des moralischen Status, die Bedeutung von Sprachregelungen in der ethischen Diskussion, sowie philosophische Implikationen von außerirdischem Leben und die Herausforderungen der Beschreibung nachträglich als mehr als tierisch erkannter Tiere.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Motivation, die den Ansatz und die verwendeten Sprachregelungen erläutert. Im Hauptteil werden verschiedene Konzepte von Fremdartigkeit vorgestellt, beginnend mit klassischen immateriellen Wesen (Götter, Engel, Dämonen) und fortführend mit materiellen Wesen außerhalb der irdischen Evolution (außerirdisches Leben). Jedes Konzept wird detailliert diskutiert.
Welche methodische Grundlage verwendet die Arbeit?
Die Arbeit nutzt sowohl philosophische Primärquellen als auch spekulativen Fiktion als methodische Grundlage. Das Ziel ist, eine saubere Basis für Rechtssätze zu schaffen, die den Umgang mit Embryonen und anderen fremdartigen Wesen regeln.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Moralische Status, Fremdartigkeit, Embryonen, immaterielle Wesen, materielle Wesen, außerirdisches Leben, Intelligenz, Person, Ethik.
Welche Beispiele aus der Philosophie und Literatur werden genannt?
Die Arbeit bezieht sich auf Voltaire's Mikromegas und Kants Überlegungen zu den Bewohnern der Gasriesen, um die potenziellen Unterschiede in Wahrnehmung und Fähigkeiten außerirdischen Lebens hervorzuheben. Schöpfungs- und Inkarnationsmythen werden als Beispiele für den Versuch angeführt, das besondere Verhältnis zwischen Göttern und Menschen zu begründen.
Welches Ziel verfolgt die Autorin?
Das Ziel der Arbeit ist es, verschiedene Konzepte von Fremdartigkeit zu beleuchten und deren Auswirkungen auf die Zuerkennung moralischer Statusprädikate zu diskutieren. Die Autorin beabsichtigt, eine fundierte Basis für ethische Überlegungen zum Umgang mit fremdartigen Wesen zu schaffen.
Warum ist die Wahl der Begrifflichkeiten wichtig?
Die Arbeit betont die Bedeutung präziser Sprachregelungen, um begriffliche Fußangeln zu vermeiden. Der Begriff "fremdartige Wesen" wird als neutraler Oberbegriff verwendet, und der Begriff "Person" wird als neutrale Alternative zu "Menschenwürde" eingesetzt, um den besonderen Status von Menschen zu bezeichnen.
- Quote paper
- Matthias Warkus (Author), 2005, Nicht Mensch, nicht Tier, nicht Sache. Zum moralischen Status fremdartiger Wesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38752