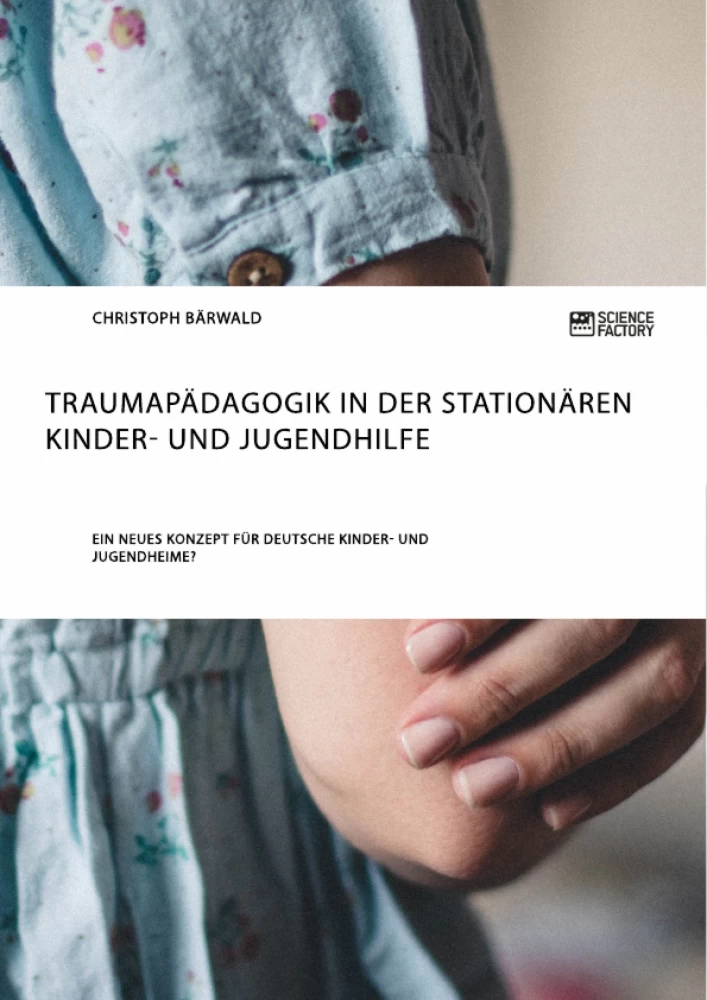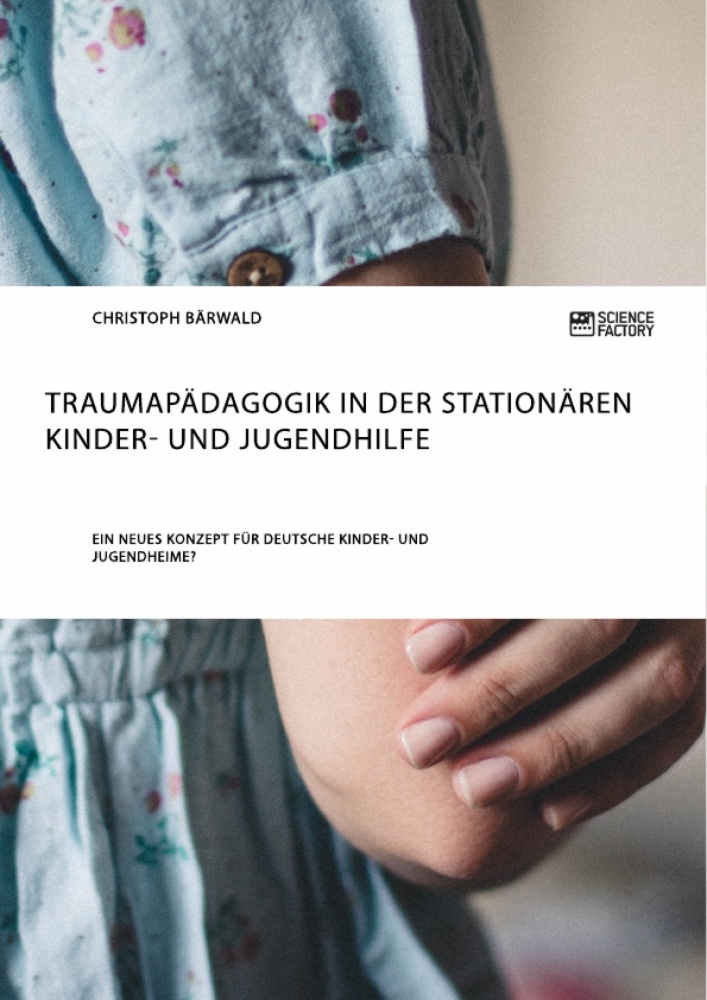Traumatisierte Mädchen und Jungen sind in der stationären Kinder- und Jugendhilfe eher die Regel als die Ausnahme. Häufig wurden sie Opfer von Vernachlässigung, häuslicher Gewalt oder sexuellem Missbrauch. Die Anforderungen an Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und Betreuer in deutschen Heimeinrichtungen sind dadurch enorm. Für eine gute und zukunftsorientierte Unterstützung benötigen psychosoziale Fachkräfte ein zusätzliches (trauma-)therapeutisches Know-how. Doch Soziale Arbeit und Psychotraumata wurden bisher kaum zusammengedacht.
Der Autor Christoph Bärwald fragt daher, wie die Traumapädagogik im Alltag von Kinder- und Jugendheimen eingesetzt werden kann. Er vermittelt Grundlagenwissen über kindliche Entwicklungstraumata durch sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt und Kindesvernachlässigung im sozialen Nahraum. Anhand eines klinischen Verlaufs beschreibt er anerkannte posttraumatische Störungsbilder und stellt die zentralen Aspekte der Traumapädagogik vor. Durch traumaspezifische Konzepte und erprobte traumasensible Interventionen zeigt der Autor Möglichkeiten auf, wie die Traumahilfe in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe gelingen kann.
Aus dem Inhalt:
- Das psychische Kindheitstrauma,
- Posttraumatische Störungen und Persönlichkeitsänderungen,
- Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern
- Ottawa-Charta versus Traumapädagogik
- Methoden, Möglichkeiten und Grenzen traumapädagogischer Arbeit
Christoph Bärwald studierte „Therapeutische Soziale Arbeit“ und hat den Alltag in deutschen Heimen selbst miterlebt. In seiner Bachelorarbeit befasste er sich primär mit den psychosozialen Langzeitfolgen von sexualisierter Gewalt in der Kindheit sowie der Ego-State-Therapie. In seiner Masterarbeit legte er den Fokus auf die noch junge Fachdisziplin der Traumapädagogik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Das psychische Kindheitstrauma – Ein Überblick
- 1.1 Begriffsbestimmung „Psychotrauma“
- 1.2 Epidemiologische Aspekte
- 1.3 Traumatische Situations- und Risikofaktoren
- 1.4 Schutzfaktoren (Salutogenese - Resilienz - Posttraumatic Growth)
- 1.5 Trauma und Entwicklung
- 1.6 Trauma und Bindung
- 1.7 Die strukturelle Dissoziationstheorie
- 1.8 Pathogene Dynamiken schwerer Kindheitstraumatisierungen im sozialen Nahraum
- 2 Klassifikation posttraumatischer Störungen - Möglichkeit eines klinischen Verlaufs in chronologischer Sequenz
- 2.1 Akute Belastungsreaktion (ICD-10 F43.0)
- 2.2 Anpassungsstörung (ICD-10 F43.2)
- 2.3 Posttraumatische Belastungsstörung (ICD-10 F43.1)
- 2.4 Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (ICD-10 F62.0)
- 3 Traumapädagogik – Eine junge Fachdisziplin im stationären Setting psychosozialer Handlungsfelder
- 3.1 Begriffsbestimmung „Gesundheitsförderung“
- 3.2 Begriffsbestimmung „Traumapädagogik“
- 3.3 Aufgaben und Zielsetzung der Traumapädagogik
- 3.4 Abgrenzung zur Traumatherapie
- 3.5 Die traumapädagogische Grundhaltung
- 3.6 Kernelemente traumapädagogischer Arbeit
- 3.7 Ausgewählte Methoden der Traumapädagogik
- 4 Traumapädagogik – Ein gesundheitsförderndes Gesamtkonzept innerhalb der stationären Kinder- und Jugendhilfe?
- 4.1 Ottawa-Charta versus Traumapädagogik
- 4.2 Evaluationsbezogene Erkenntnisse
- 5 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Traumapädagogik im stationären Setting der Kinder- und Jugendhilfe. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die traumatisierte Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung durchleben, und untersucht die Möglichkeiten, wie traumapädagogische Ansätze zu einer ganzheitlichen und gesundheitsfördernden Unterstützung beitragen können.
- Das psychische Kindheitstrauma und seine Folgen
- Die Relevanz von Schutzfaktoren und Resilienz im Umgang mit Traumatisierungen
- Die Entwicklung und Umsetzung traumapädagogischer Konzepte
- Die Bedeutung einer traumasensitiven und -informierten Arbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Evaluationsbezogene Erkenntnisse zur Wirksamkeit traumapädagogischer Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel bietet eine umfassende Einführung in das Thema des psychischen Kindheitstraumas. Es beleuchtet die Begriffsbestimmung, epidemiologische Aspekte, traumatische Situations- und Risikofaktoren sowie Schutzfaktoren wie Salutogenese, Resilienz und Posttraumatic Growth. Zudem werden die Auswirkungen von Trauma auf die Entwicklung und die Bindungsbeziehungen von Kindern und Jugendlichen erläutert.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Klassifikation posttraumatischer Störungen und deren möglichen klinischen Verlaufsformen. Dabei werden die Akute Belastungsreaktion, Anpassungsstörung, Posttraumatische Belastungsstörung sowie die Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung näher betrachtet.
- Das dritte Kapitel stellt die Traumapädagogik als junge Fachdisziplin im stationären Setting der Kinder- und Jugendhilfe vor. Es definiert die Begriffe Gesundheitsförderung und Traumapädagogik, erläutert die Aufgaben und Ziele der Traumapädagogik und grenzt sie von der Traumatherapie ab. Darüber hinaus werden die traumapädagogische Grundhaltung sowie Kernelemente traumapädagogischer Arbeit und ausgewählte Methoden vorgestellt.
- Das vierte Kapitel diskutiert die Frage, ob Traumapädagogik als gesundheitsförderndes Gesamtkonzept innerhalb der stationären Kinder- und Jugendhilfe verstanden werden kann. Es setzt sich mit der Ottawa-Charta auseinander und beleuchtet evaluationsbezogene Erkenntnisse.
Schlüsselwörter
Traumapädagogik, Kindheitstrauma, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitsförderung, Resilienz, Schutzfaktoren, Traumasensitive Arbeit, Posttraumatische Belastungsstörung, Traumatherapie, Evaluationsbezogene Erkenntnisse, Ottawa-Charta
- Arbeit zitieren
- Christoph Bärwald (Autor:in), 2016, Traumapädagogik in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387767