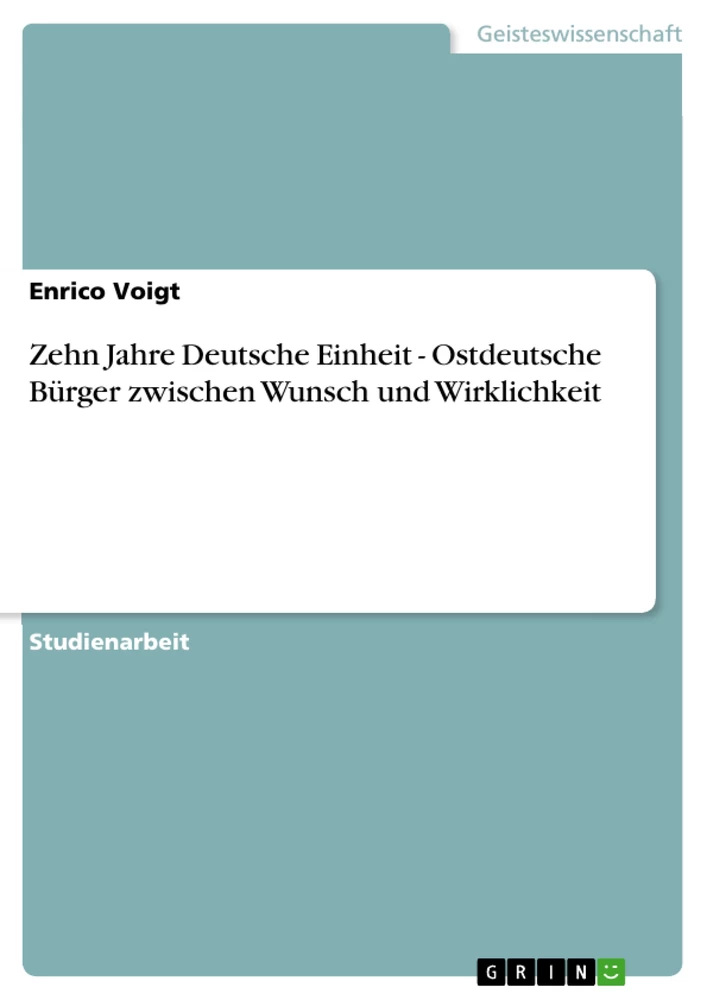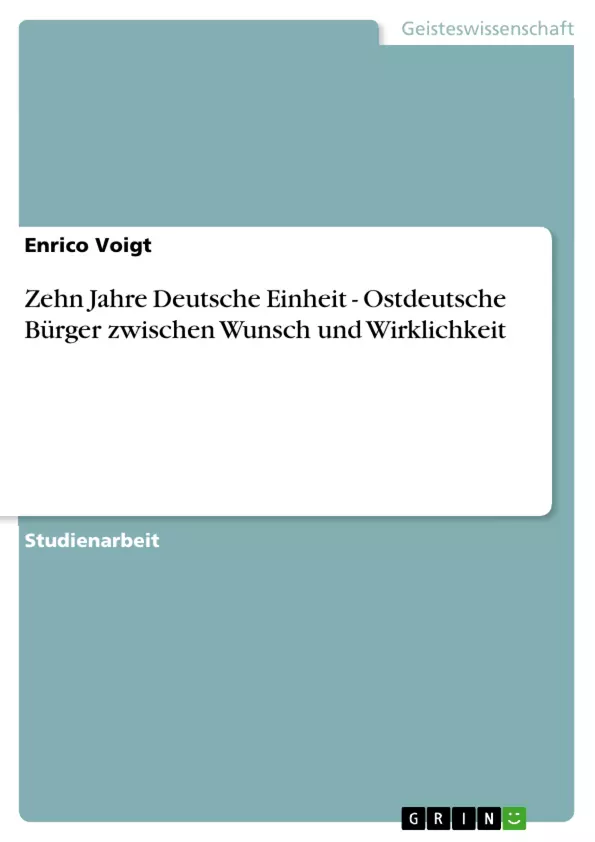Mit dem 3. Oktober 1990, dem Tag der deutschen Einheit, waren vierzig Jahre deutscher Zweistaatlichkeit beendet. Dieser Tag war das herausragende Ereignis der deutschen Geschichte seit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989. Die offiziell bis zum 3. Oktober 1990 existierende Deutsche Demokratische Republik wurde Teil der Bundesrepublik Deutschland und trat dieser gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes bei.1 Vom Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 bis zur Herstellung der deutschen Einheit vergingen somit nicht einmal zwölf Monate. Die staatliche Vereinigung beider deutscher Staaten war somit relativ schnell vollzogen, die Herstellung der ,,inneren Einheit" erwies sich jedoch als ein langer und schwieriger Weg.
Die deutsche Wiedervereinigung erfolgte nach den Vorgaben des Gesellschafts- und Staatssystems der Bundesrepublik Deutschland, basierend auf der parlamentarischen Demokratie und geprägt von der sozialen Marktwirtschaft.2
Die Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR erlebten in ihrem Alltag nach dem Fall der Berliner Mauer einen regelrechten Umbruch, der unter anderem durch das Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vom 1. Juli 1990 und auch später am 3. Oktober 1990 durch den Einigungsvertrag erheblich beeinflusst wurde.
Durch die Neuanpassung an das Gesellschafts- und Staatssystem der Bundesrepublik Deutschland und dem damit verbundenen staatlichen als auch gesellschaftlichen Strukturwandel standen die neuen Bundesbürger nun vor einem radikalen Neuanfang. Sämtliche Institutionen des sozialen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens der Deutschen Demokratischen Republik wurden ab dem 3. Oktober 1990 durch solche der Bundesrepublik Deutschland ersetzt. Das Gewohnte verschwand gänzlich und der Alltag brachte so tiefgreifende Einschnitte mit sich. Die ostdeutschen Bundesbürger waren gewissermaßen gezwungen, sich schnell an dem Gesellschafts- und Staatssystem der Bundesrepublik Deutschland und westdeutschen Standards neu zu orientieren, was nach vierzig Jahren Gewohnheit und Gegensätzen nicht leicht war.
Hinzu kamen Ängste bei diesen Menschen, ihren Arbeitsplatz und die soziale Sicherung zu verlieren und ferner auch im vereinten Deutschland als ,,Bürger zweiter Klasse"3 dazustehen, nachdem sich das erhebliche Strukturgefälle zwischen West- und Ostdeutschland darstellte.
Inhaltsverzeichnis:
- Einleitung
- Die Situation der DDR-Bürger vor der Wiedervereinigung
- Das Wohlstandsgefälle zwischen der BRD und der DDR als eine der Ursachen der Unzufriedenheit
- Massenflucht und Montagsdemonstrationen als Ausdruck der Unzufriedenheit - Der Fall der Berliner Mauer
- Der Fortgang der Demonstrationen - Der Wunsch nach der Wiedervereinigung
- Die Situation der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung - Der Verlauf der Herstellung der inneren Einheit
- Die Angleichung der Lebensverhältnisse an das westdeutsche Niveau - Das Wohlstandsgefälle zwischen West- und Ostdeutschland
- Die eigene Einschätzung der Lebenssituation aus Sicht der Ostdeutschen in den neuen Bundesländern
- Ein schwieriger Weg des Zusammenwachsens - Trotz Wiedervereinigung einander noch fremd
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte:
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Lebensbedingungen der Ostdeutschen vor und nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990. Sie analysiert die Ursachen für die Unzufriedenheit in der DDR, insbesondere das Wohlstandsgefälle zwischen Ost- und Westdeutschland und die fehlenden Freiheitsrechte. Weiterhin untersucht die Arbeit die Entwicklung der Lebenssituation der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung, einschließlich der Angleichung der Lebensverhältnisse an das westdeutsche Niveau und der eigenen Einschätzung der Lebensbedingungen durch die Ostdeutschen.
- Das Wohlstandsgefälle zwischen Ost- und Westdeutschland vor der Wiedervereinigung
- Die Unzufriedenheit der DDR-Bürger und die Ursachen für die Massenflucht und die Montagsdemonstrationen
- Die Auswirkungen der Wiedervereinigung auf die Lebenssituation der Ostdeutschen
- Die Einschätzung der Lebenssituation in den neuen Bundesländern aus Sicht der Ostdeutschen
- Der Prozess des Zusammenwachsens von Ost- und Westdeutschland nach der Wiedervereinigung
Zusammenfassung der Kapitel:
Die Einleitung stellt den Kontext der deutschen Wiedervereinigung und die zentralen Themen der Hausarbeit vor. Kapitel 2 beleuchtet die Situation der DDR-Bürger vor der Wiedervereinigung. Dabei wird das Wohlstandsgefälle zwischen der BRD und der DDR als eine der Ursachen für die Unzufriedenheit der DDR-Bürger dargestellt. Massenflucht und Montagsdemonstrationen werden als Ausdruck der Unzufriedenheit der Bürger interpretiert. Kapitel 3 analysiert die Situation der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung. Es wird die Angleichung der Lebensverhältnisse an das westdeutsche Niveau, die eigene Einschätzung der Lebenssituation aus Sicht der Ostdeutschen und die Herausforderungen des Zusammenwachsens von Ost- und Westdeutschland untersucht.
Schlüsselwörter:
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Deutsche Einheit, Wiedervereinigung, Ostdeutsche, Westdeutsche, Wohlstandsgefälle, Unzufriedenheit, Massenflucht, Montagsdemonstrationen, Lebenssituation, Angleichung, Zusammenwachsen, innere Einheit.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptgründe für die Unzufriedenheit in der DDR?
Das erhebliche Wohlstandsgefälle zur BRD, fehlende Freiheitsrechte sowie die wirtschaftliche und politische Stagnation führten zur Massenflucht und den Montagsdemonstrationen.
Was bedeutete die "innere Einheit" nach 1990?
Sie beschreibt den schwierigen Prozess des sozialen und kulturellen Zusammenwachsens von Ost- und Westdeutschen nach der staatlichen Vereinigung.
Wie erlebten Ostdeutsche den radikalen Neuanfang?
Der Alltag änderte sich durch den Ersatz aller DDR-Institutionen durch westdeutsche Standards schlagartig, was oft mit Ängsten vor Arbeitsplatzverlust verbunden war.
Was ist das Wohlstandsgefälle zwischen Ost und West?
Es beschreibt die unterschiedlichen Lebensstandards und wirtschaftlichen Bedingungen, die auch zehn Jahre nach der Einheit noch spürbar waren.
Fühlten sich Ostdeutsche als "Bürger zweiter Klasse"?
Die Arbeit thematisiert die Wahrnehmung vieler Ostdeutscher, im vereinten Deutschland aufgrund wirtschaftlicher Unterschiede und Vorurteile benachteiligt zu sein.
- Quote paper
- Enrico Voigt (Author), 2001, Zehn Jahre Deutsche Einheit - Ostdeutsche Bürger zwischen Wunsch und Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3878