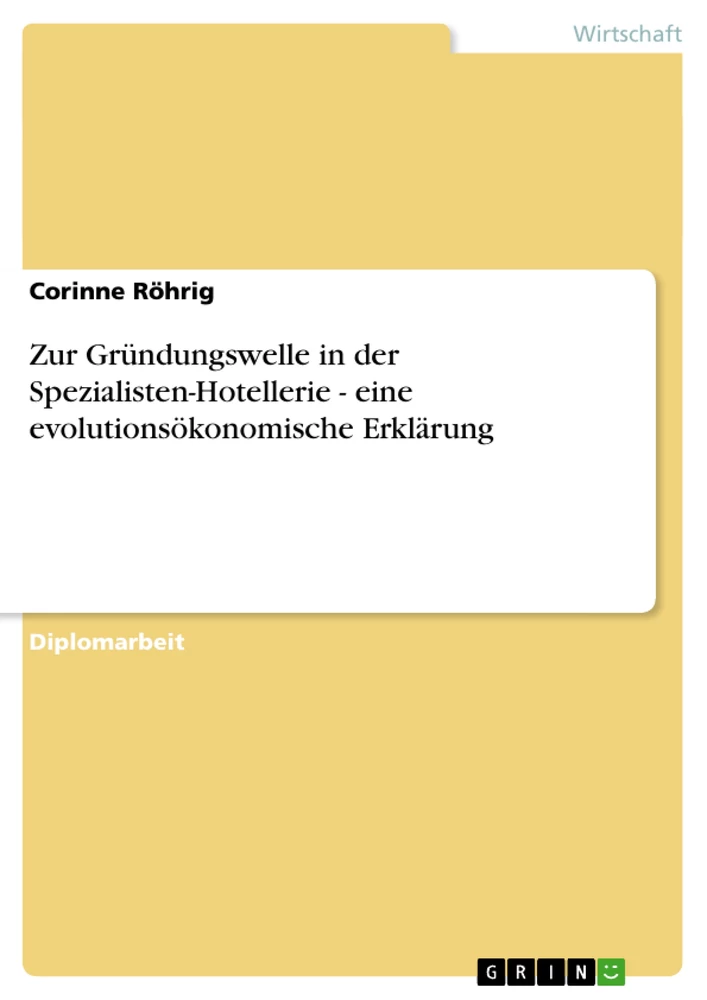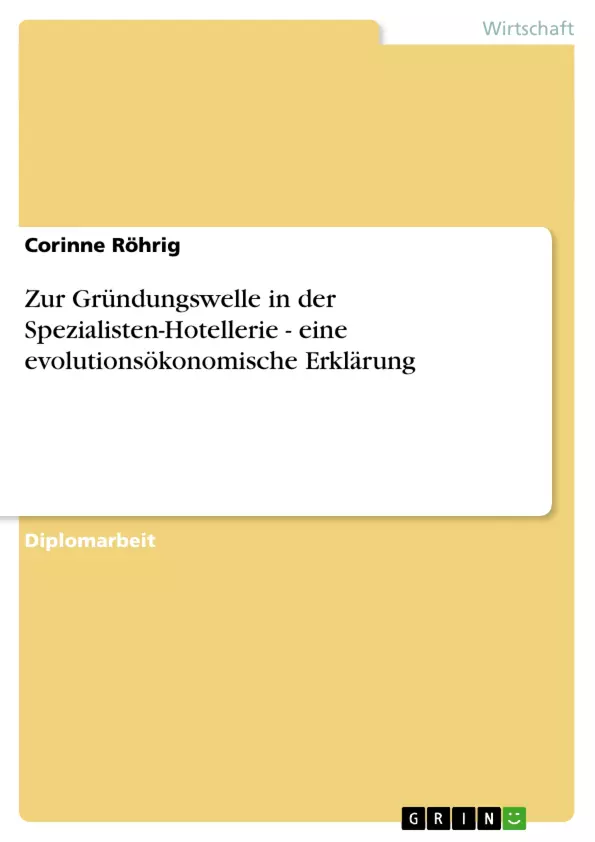[...] Ziel dieser Arbeit ist es, mit Hilfe der Organisationsökologie die Gründungswelle in der Spezialisten-Hotellerie evolutionsökonomisch zu erklären. Hierzu bietet die Organisationsökologie verschiedene Ansätze. [...] Zunächst wird in die Organisationsökologie kurz eingeführt. In Anlehnung an biologische Konzepte werden Populationen als Analyseeinheiten gewählt, im Rahmen dieser Arbeit die Hotellerie; die Organisationen sind die Hotels. Darauf folgend werden Formen der Hotellerie vorgestellt. Im Anschluss daran wird die Hotellerie aus evolutionsökonomischer Sicht betrachtet. Die oben genannten Ansätze der Organisationsökologie werden auf die Hotellerie übertragen. Entsprechend dem Dichteabhängigkeitsmodell wird die Entwicklung der Hotellerie in eine Phase zunehmender Legitimation und in eine Phase zunehmenden Wettbewerbs unterteilt. Anschließend soll anhand des Konzeptes der ökologischen Nische gezeigt werden, wie die Veränderung der Umwelt durch gewandelte Ansprüche der potentiellen Hotelgäste zur Öffnung von Nischen auf dem Hotelmarkt führt. Diese Marktnischen führen zu einer erhöhten Vielfalt der Organisationsformen innerhalb der Hotellerie. Mit Hilfe der Theorie der Ressourcenteilung soll das Nebeneinander der Generalisten- und der Spezialisten-Hotellerie erklärt werden. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen der Zielerreichung dieser Arbeit und sollen die Gründungswelle in der Spezialisten-Hotellerie evolutionsökonomisch erklären. Betrachtet wird der Hotelmarkt Deutschland. Als Beispiel dient der Berliner Hotelmarkt. Den Abschluss bildet eine Zusammenfassung mit Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 DIE ORGANISATIONSÖKOLOGIE
- 2.1 Einordnung der Organisationsökologie in die Gründungsforschung
- 2.2 Die Evolution von Organisationen und Populationen
- 3 FORMEN DER HOTELLERIE
- 3.1 Das Hotel
- 3.2 Die Generalisten-Hotellerie
- 3.2.1 Die Hotelkette
- 3.2.2 Die Hotelkooperation
- 3.2.3 Die Markenhotellerie
- 3.3 Die Spezialisten-Hotellerie
- 4 DIE HOTELLERIE AUS EVOLUTIONSÖKONOMISCHER SICHT
- 4.1 Das Dichteabhängigkeitsmodell
- 4.1.1 Theoretischer Rahmen
- 4.1.2 Die Phase der Legitimation
- 4.1.3 Die Phase zunehmenden Wettbewerbs
- 4.2 Das Konzept der ökologischen Nische
- 4.2.1 Theoretischer Rahmen
- 4.2.2 Die Öffnung von Nischen
- 4.2.3 Marktsegmente in der Hotellerie
- 4.3 Die Theorie der Ressourcenteilung
- 4.3.1 Theoretischer Rahmen
- 4.3.2 Spezialisten- und Generalistenmärkte
- 4.3.3 Kundenorientierung
- 4.3.4 Kulturelle Ablehnung von Massenprodukten
- 4.3.5 Demonstrativer Statuskonsum
- 4.4 Beispiel: Der Berliner Hotelmarkt
- 4.4.1 Charakteristika
- 4.4.2 Entwicklung
- 4.4.3 Die Öffnung von Nischen
- 4.4.4 Spezialisten-Hotellerie
- 4.1 Das Dichteabhängigkeitsmodell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Gründungswelle in der Spezialisten-Hotellerie aus evolutionsökonomischer Sicht. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung dieser neuen Hotelform, die sich von der traditionellen Generalisten-Hotellerie durch die Konzentration auf spezielle Zielgruppen und Bedürfnisse abhebt.
- Einführung und Einordnung der Organisationsökologie in die Gründungsforschung
- Analyse der Evolution von Organisationen und Populationen im Kontext der Hotellerie
- Untersuchung des Dichteabhängigkeitsmodells und seiner Relevanz für die Entwicklung der Spezialisten-Hotellerie
- Anwendung des Konzepts der ökologischen Nische auf den Hotelmarkt und die Identifizierung von Nischen für Spezialisten-Hotellerie
- Analyse der Theorie der Ressourcenteilung im Zusammenhang mit der Spezialisierung von Hotels und der Bedeutung von Kundenorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema einführt und die Forschungsfrage formuliert. Anschließend wird die Organisationsökologie als theoretischer Rahmen für die Analyse der Gründungswelle in der Spezialisten-Hotellerie vorgestellt. In Kapitel 3 werden verschiedene Formen der Hotellerie, darunter die Generalisten- und Spezialisten-Hotellerie, beschrieben.
Kapitel 4 widmet sich der Analyse der Hotellerie aus evolutionsökonomischer Sicht. Es untersucht das Dichteabhängigkeitsmodell, das Konzept der ökologischen Nische und die Theorie der Ressourcenteilung. Weiterhin wird anhand des Berliner Hotelmarktes exemplarisch die Entwicklung der Spezialisten-Hotellerie dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Organisationsökologie, Evolutionstheorie, Spezialisten-Hotellerie, Dichteabhängigkeitsmodell, ökologische Nische, Ressourcenteilung, Kundenorientierung und Gründungswelle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Generalisten- und Spezialisten-Hotellerie?
Generalisten bedienen einen breiten Massenmarkt (z. B. Hotelketten), während Spezialisten sich auf nischenspezifische Bedürfnisse und Zielgruppen konzentrieren.
Was besagt das Dichteabhängigkeitsmodell in der Hotellerie?
Es beschreibt die Entwicklung einer Branche von einer Phase der Legitimation (Zunahme der Gründungen) hin zu einer Phase des intensiven Wettbewerbs bei hoher Marktdichte.
Warum entstehen immer mehr Spezialisten-Hotels?
Durch gewandelte Kundenansprüche und die Ablehnung von Massenprodukten öffnen sich ökologische Nischen, die von spezialisierten Anbietern besetzt werden.
Welche Rolle spielt die Theorie der Ressourcenteilung?
Sie erklärt das Nebeneinander von großen Ketten und kleinen Spezialisten: Während Ketten Skaleneffekte nutzen, punkten Spezialisten durch hohe Kundenorientierung in Nischen.
Welcher Hotelmarkt dient als Praxisbeispiel?
Die Arbeit nutzt den Berliner Hotelmarkt als Beispiel, um die Öffnung von Nischen und die Vielfalt der Organisationsformen zu illustrieren.
- Arbeit zitieren
- Corinne Röhrig (Autor:in), 2004, Zur Gründungswelle in der Spezialisten-Hotellerie - eine evolutionsökonomische Erklärung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38794