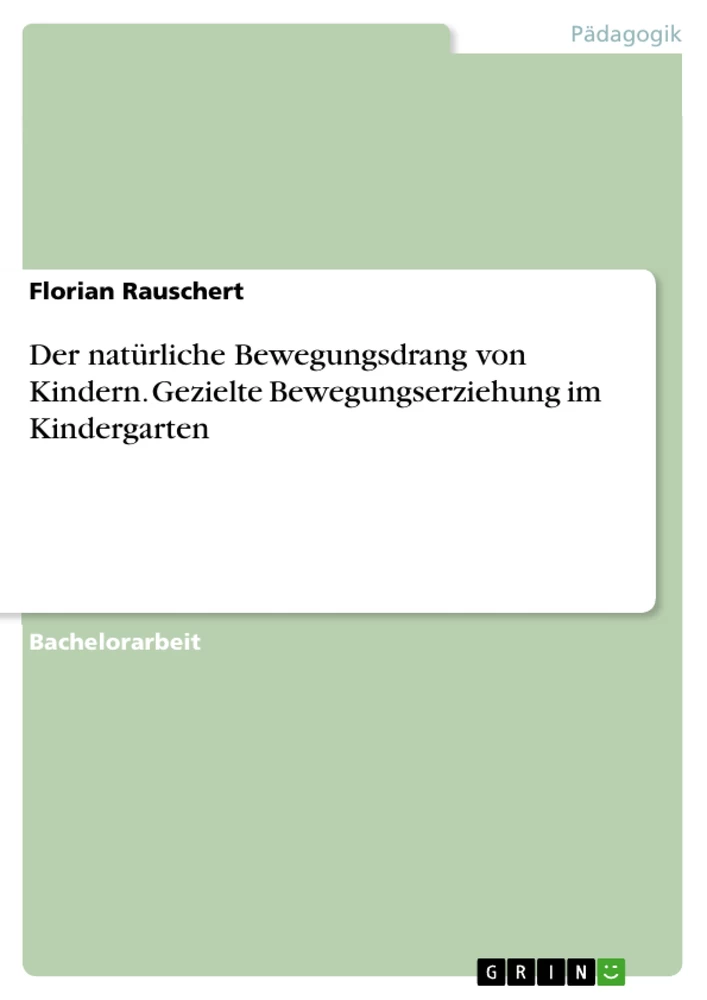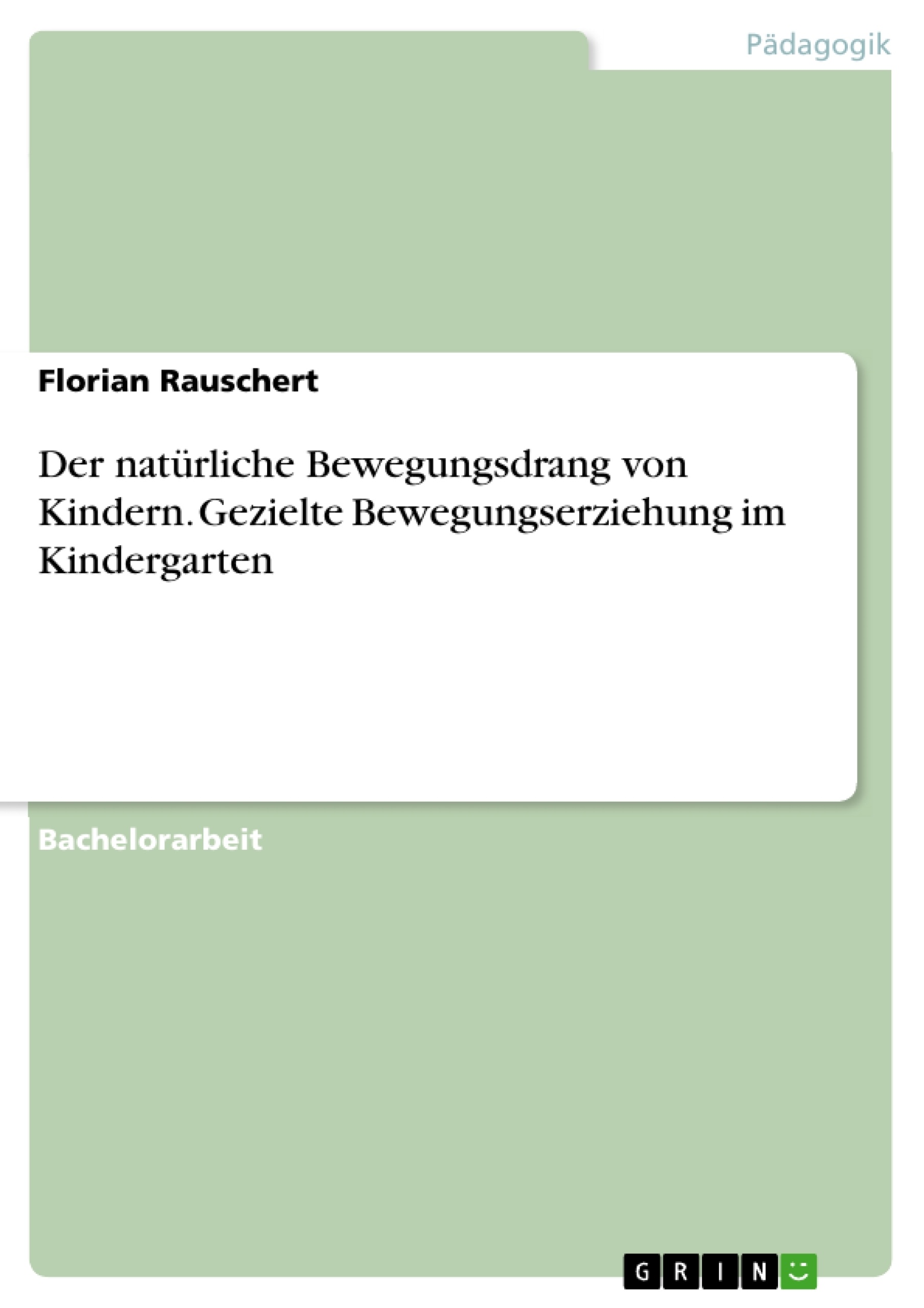Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Bewegung und Bewegungserziehung im Kindergarten. Sie greift dabei auf den Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) und das Motorik-Modul (MoMo) zurück. Der interdisziplinäre Zugang zur Thematik Bewegung wird vor allem in den Erkenntnissen der Elementarpädagogik, der Naturwissenschaft, der Sportwissenschaft und der Entwicklungspsychologie deutlich.
Sport und Bewegung nehmen heutzutage einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft ein. Allein die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 verfolgten über 3,2 Milliarden Menschen – darunter auch viele Kinder - weltweit. Dies allerdings vor heimischen TV-Geräten, Smartphones oder Tablets. In diesem (medialen) Kontext bewegt Sport wohl eher im Sinne der Emotionalität, denn 2014 ist auch das Jahr, in dem die AOK-Familienstudie veröffentlicht, dass jedes vierte Kind in Deutschland übergewichtig ist.
Der höchste Handlungsbedarf liegt bei Kinder von Familien mit niedrigem Bildungsniveau. Hier sind bereits 26% der Kinder übergewichtig. Übergewichtigkeit lediglich auf Bewegungsmangel zu schieben, wäre an dieser Stelle zu pauschal gedacht und würde der Bewegungserziehung eine Bedeutung zuschreiben, welcher sie nicht gerecht werden könnte. Das Phänomen Übergewicht bei Kindern lässt aber Rückschlüsse auf die heutige Kindheit zu. Die moderne Kindheit, so scheint es, bedeutet eine veränderte Lebens- und Bewegungswelt für Kinder.
Dabei spielt in der Lebenswelt von Kindern und in deren Entwicklung doch Bewegung eine elementare Rolle. In fachspezifischen Veröffentlichungen ist von einem natürlichen Bewegungsdrang zu lesen. Bewegung in der Kindheit hat einen signifikanten Bedeutungshorizont. Bewegung fördert die Motorik des Kindes, hilft, die Lebenswelt ganzheitlich zu begreifen und zu erforschen. Darüber hinaus können Bewegung und das etwaige Verbessern von motorischen Leistungen das Selbstbild sowie das Vertrauen in sich selbst prägen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Der natürliche Bewegungsdrang
- 2.1. Ein interdisziplinärer Blick auf den Begriff natürlicher Bewegungsdrang
- 2.2. Begriffsbestimmung – Sport, körperliche Aktivität und Alltagsbewegung
- 2.3. Bewegungserziehung
- 3. Aktueller Forschungsstand
- 3.1. Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS)
- 3.2 Ergebnisse der MoMo - Studie
- 4. Auswirkungen gezielter Bewegungserziehung
- 4.1. Auswirkungen von Bewegungserziehung auf die motorische Leistungsfähigkeit
- 4.2 Reziprozität Bewegung und Gesundheit
- 4.3 Bewegung und sozial-emotionale Kompetenz
- 4.4 Bewegung und Lernen
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Bewegungserziehung im Kindergarten. Ziel ist es, den substantiellen Einfluss von Bewegung auf die kindliche Entwicklung aufzuzeigen und die Notwendigkeit einer verstärkten Bewegungsförderung im Kindergartenalltag zu belegen. Der Fokus liegt auf der Analyse des aktuellen Forschungsstandes und der Diskussion der Herausforderungen bei der Umsetzung von Bewegungserziehung in Kindergärten.
- Der natürliche Bewegungsdrang von Kindern und seine Bedeutung für die Entwicklung.
- Der aktuelle Forschungsstand zu Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern.
- Die Auswirkungen gezielter Bewegungserziehung auf motorische Fähigkeiten, Gesundheit und sozial-emotionale Kompetenz.
- Herausforderungen bei der Implementierung von Bewegungserziehung im Kindergarten.
- Die Rolle des Kindergartens als Institution der Bewegungsförderung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Sport und Bewegung in der Gesellschaft und führt in die Thematik der vorliegenden Arbeit ein. Es wird anhand von Statistiken zum Übergewicht bei Kindern der dringende Handlungsbedarf im Bereich der Bewegungsförderung herausgestellt und die Notwendigkeit der Bewegungserziehung im Kindergarten kontextualisiert. Der Bezug auf die "moderne Kindheit" mit ihren veränderten Lebensumständen für Kinder wird hergestellt.
2. Der natürliche Bewegungsdrang: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff des "natürlichen Bewegungsdrangs" aus interdisziplinärer Perspektive. Es werden verschiedene Definitionen von Sport, körperlicher Aktivität und Alltagsbewegung abgegrenzt. Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Bewegungserziehung in der kindlichen Entwicklung und deren Bedeutung für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes, inklusive der Förderung von Motorik, Selbstbild und sozialer Kompetenz. Die elementare Bedeutung von Bewegung als Ausdrucksmittel und Kommunikationsmedium für Kinder wird hervorgehoben.
3. Aktueller Forschungsstand: Dieses Kapitel analysiert den aktuellen Forschungsstand zur Thematik Bewegung anhand von Studien wie dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) und der MoMo-Studie. Die Ergebnisse dieser Studien liefern wichtige Daten zum Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern und bilden die Grundlage für die Argumentation der Bedeutung von Bewegungserziehung.
4. Auswirkungen gezielter Bewegungserziehung: In diesem Kapitel werden die positiven Auswirkungen gezielter Bewegungserziehung auf verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung untersucht. Es werden die positiven Effekte auf die motorische Leistungsfähigkeit, die Gesundheit, die sozial-emotionale Kompetenz und den Lernprozess detailliert dargestellt und durch Studien belegt. Die Reziprozität von Bewegung und Gesundheit wird hervorgehoben, und es werden Zusammenhänge zwischen Bewegung und anderen wichtigen Entwicklungsbereichen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Bewegungserziehung, Kindergarten, kindliche Entwicklung, Motorik, Gesundheit, Übergewicht, Bewegungsmangel, Forschungsstand, KiGGS, MoMo-Studie, Sozialisation, Bildung, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bedeutung von Bewegungserziehung im Kindergarten
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Bewegungserziehung im Kindergarten. Sie zeigt den substantiellen Einfluss von Bewegung auf die kindliche Entwicklung und belegt die Notwendigkeit einer verstärkten Bewegungsförderung im Kindergartenalltag. Der Fokus liegt auf der Analyse des aktuellen Forschungsstandes und der Herausforderungen bei der Umsetzung von Bewegungserziehung.
Welche Aspekte der Bewegungserziehung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern, den aktuellen Forschungsstand zu Bewegungsmangel und Übergewicht, die Auswirkungen gezielter Bewegungserziehung auf motorische Fähigkeiten, Gesundheit und sozial-emotionale Kompetenz sowie Herausforderungen bei der Implementierung von Bewegungserziehung im Kindergarten und die Rolle des Kindergartens als Institution der Bewegungsförderung.
Welche Studien werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert den aktuellen Forschungsstand anhand von Studien wie dem Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) und der MoMo-Studie. Die Ergebnisse dieser Studien liefern wichtige Daten zum Bewegungsmangel und Übergewicht bei Kindern.
Welche positiven Auswirkungen von Bewegungserziehung werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt detailliert die positiven Auswirkungen gezielter Bewegungserziehung auf die motorische Leistungsfähigkeit, die Gesundheit, die sozial-emotionale Kompetenz und den Lernprozess. Die Reziprozität von Bewegung und Gesundheit wird hervorgehoben, und es werden Zusammenhänge zwischen Bewegung und anderen wichtigen Entwicklungsbereichen aufgezeigt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: 1. Einführung, 2. Der natürliche Bewegungsdrang, 3. Aktueller Forschungsstand, 4. Auswirkungen gezielter Bewegungserziehung und 5. Fazit (letzteres ist im vorliegenden Auszug nicht enthalten).
Was ist der natürliche Bewegungsdrang und welche Bedeutung hat er?
Das Kapitel "Der natürliche Bewegungsdrang" betrachtet diesen Begriff aus interdisziplinärer Sicht. Es werden Sport, körperliche Aktivität und Alltagsbewegung abgegrenzt und die Rolle der Bewegungserziehung in der kindlichen Entwicklung für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes (Motorik, Selbstbild, soziale Kompetenz) hervorgehoben. Bewegung als Ausdrucksmittel und Kommunikationsmedium wird ebenfalls thematisiert.
Welche Herausforderungen bei der Umsetzung von Bewegungserziehung werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert die Herausforderungen bei der Implementierung von Bewegungserziehung im Kindergarten, ohne diese im Detail im vorliegenden Auszug zu spezifizieren. Diese werden jedoch als wichtiger Bestandteil der Analyse genannt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bewegungserziehung, Kindergarten, kindliche Entwicklung, Motorik, Gesundheit, Übergewicht, Bewegungsmangel, Forschungsstand, KiGGS, MoMo-Studie, Sozialisation, Bildung, Inklusion.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit der kindlichen Entwicklung, Bewegungserziehung im Kindergarten, Gesundheitsförderung und der Bedeutung von Bewegung für Kinder auseinandersetzen, inklusive Erzieher*innen, Pädagog*innen, Wissenschaftler*innen und Eltern.
- Quote paper
- Florian Rauschert (Author), 2017, Der natürliche Bewegungsdrang von Kindern. Gezielte Bewegungserziehung im Kindergarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387968