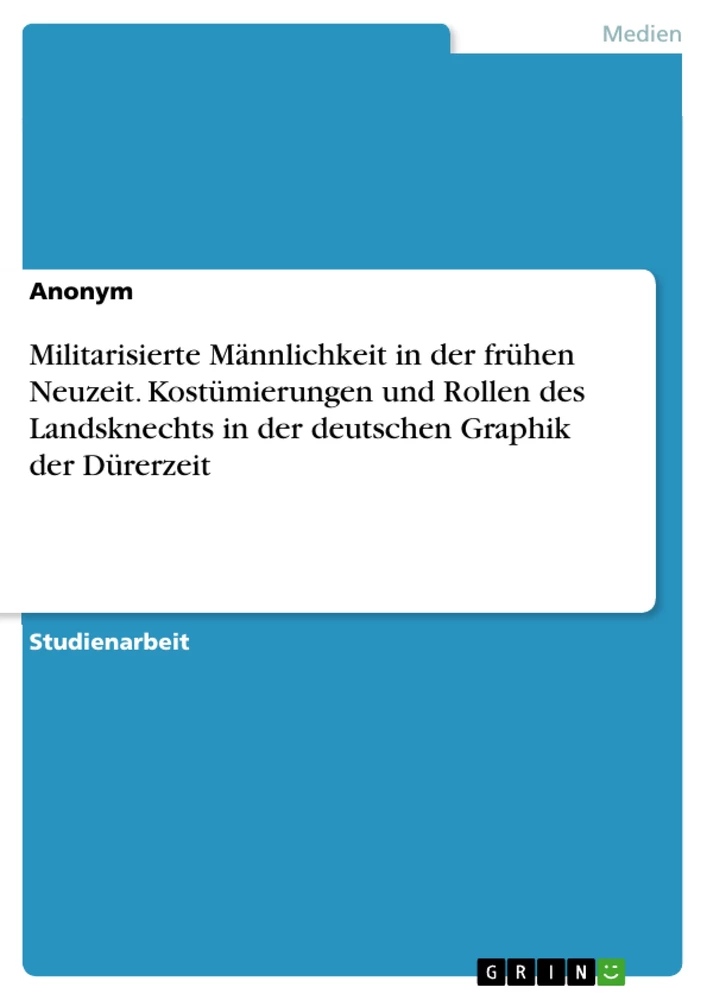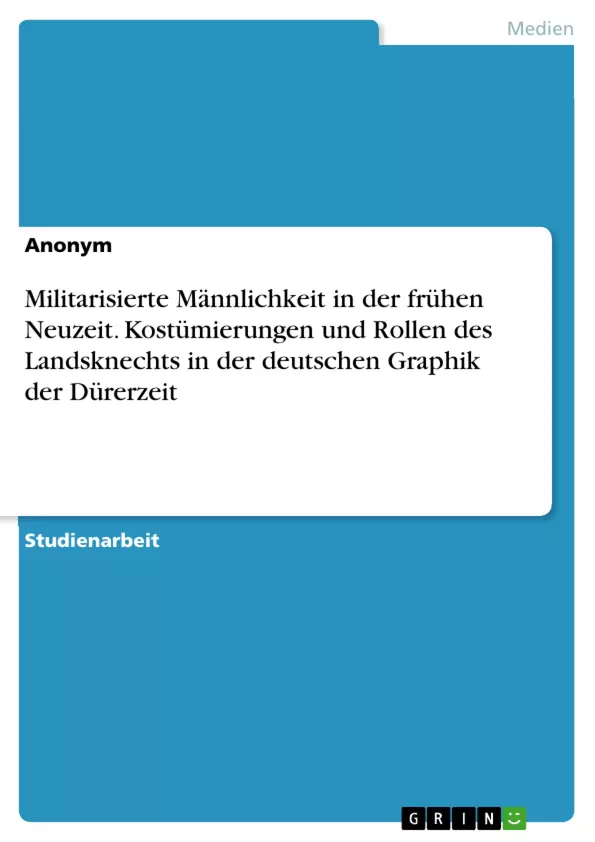In der Blütezeit der Landsknechte – zwischen den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts und dem ausgehenden 16. Jahrhundert – dürfen wir uns das Kriegsvolk der Landsknechte als eine ungemein farbenfrohe und pompöse Erscheinung vorstellen. Hält man sich den Umstand vor Augen, dass es nie zuvor und niemals wieder nach der Zeit des ‚Landsknechtswesens‘ Armeen von solcher Buntheit und profilierter Selbstdarstellung des einzelnen Soldaten / Kriegers gab, ist das Phänomen des Landsknechts einzigartig in der Geschichte der Europäischen Kriegervölker. Aus dem 16. Jahrhundert ist uns eine große Zahl von bildlichen Darstellungen von Fußknechten und Kriegsvolk überliefert. Die Mehrheit dieser Zeugnisse ist in Form von Druckgrafiken anzutreffen, aber auch Feder-, Rötel und Kohlezeichnungen fanden zu Studienzwecken und Entwürfen bei den damaligen Künstlern reichlich Verwendung. Vor allem auf dem günstigen Medium der Holzschnitte ist der Kriegsknecht vermehrt in der Anfangszeit anzutreffen. Erst nach und nach eroberte das Bildthema des gemeinen, bunten Fußknechts auch die teureren Bildmedien, so etwa die Druckerplatten der alten Meister mit ihren Kupferstichen und Radierungen. Berühmte Holzschnitte und Stiche von Albrecht Dürrer z.B. aber auch von Hans Burgkmair, Hans Schäuffelein, Albrecht Altdorfer und andere berichten uns vom Erscheinungsbild der ersten Landsknechte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitendes
- Begriffsklärung des frühneuzeitlichen „Landsknechts“
- Halbhose und Hosenlatz, Langspieß und Luntenschlossgewehr
- Landsknechte in der deutschen Graphik der Dürerzeit
- Vom autonomen Soldatenbild zur Bilderserie
- Kriegsmann zu Fuß (ca. 1490)
- Erste Phase - Albrecht Dürer und sein Zirkel
- Landsknecht von rückwärts gesehen' (um 1500)
- Schreitender Landsknecht (1502)
- Fahnenspiel und Fähnrich – „ein erbar / ehrlich und ru[e]hmliches Ampt“
- Fahnenschwinger (nach 1500)
- ‚Der Fahnenschwinger‘ (um 1502/1503)
- Gruppenbilder
- Drei Kriegsleute' (1489)
- Italienische Landsknechte' (1495)
- Vom autonomen Soldatenbild zur Bilderserie
- Abschließendes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung des Landsknechts in der deutschen Graphik der Dürerzeit und beleuchtet die Entwicklung des Bildes des Landsknechts von einem autonomen Soldatenbild zu einer komplexen Bilderserie.
- Die Entstehung und Entwicklung des Landsknechtswesens im Kontext der europäischen Kriegsführung
- Die Rolle des Landsknechts in der deutschen Graphik der Dürerzeit
- Die ikonographische Entwicklung des Landsknechts in der Bilderserie
- Die Symbolik und Bedeutung der Kostümierung und Ausstattung des Landsknechts
- Die militärische Rolle des Landsknechts im Vergleich zu anderen europäischen Streitkräften
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in das Thema und beleuchtet die Entwicklung des Landsknechtswesens in der europäischen Kriegsführung am Ende des Spätmittelalters. Kapitel zwei erläutert den Begriff „Landsknecht“ und die Herausforderungen seiner Definition in zeitgenössischen Quellen. In Kapitel drei wird die Ausstattung und Bewaffnung des Landsknechts im Detail beschrieben. Kapitel vier widmet sich der Darstellung des Landsknechts in der deutschen Graphik der Dürerzeit und analysiert verschiedene Bilderserien und Einzelbilder.
Schlüsselwörter
Landsknecht, deutsche Graphik, Dürerzeit, Kostümierung, Militärgeschichte, Söldner, Bilderserie, Ikonographie, Kriegsführung, Schweizer Eidgenossen, Langspieß, Luntenschlossgewehr
Häufig gestellte Fragen
Wer waren die Landsknechte?
Landsknechte waren Söldner des späten 15. und 16. Jahrhunderts, bekannt für ihre bunten Trachten und ihre Rolle in der Infanterie der frühen Neuzeit.
Warum trugen Landsknechte so auffällige Kleidung?
Kaiser Maximilian I. befreite sie von den strengen Kleiderordnungen, damit sie ihre Todesmutigkeit und ihren sozialen Status als stolze Krieger demonstrieren konnten.
Welche Künstler stellten Landsknechte dar?
Berühmte Darstellungen stammen von Albrecht Dürer, Hans Burgkmair, Hans Schäuffelein und Albrecht Altdorfer.
Welche Waffen nutzten die Landsknechte?
Zentral waren der Langspieß (Pike), das Kurzschwert (Katzbalger) und zunehmend das Luntenschlossgewehr (Arkebuse).
Was ist die Bedeutung des Fähnrichs?
Der Fähnrich war ein angesehenes Amt; er trug die Fahne der Kompanie, die als heiliges Symbol der Einheit galt und im Kampf bis zum Tod verteidigt werden musste.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2017, Militarisierte Männlichkeit in der frühen Neuzeit. Kostümierungen und Rollen des Landsknechts in der deutschen Graphik der Dürerzeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387981