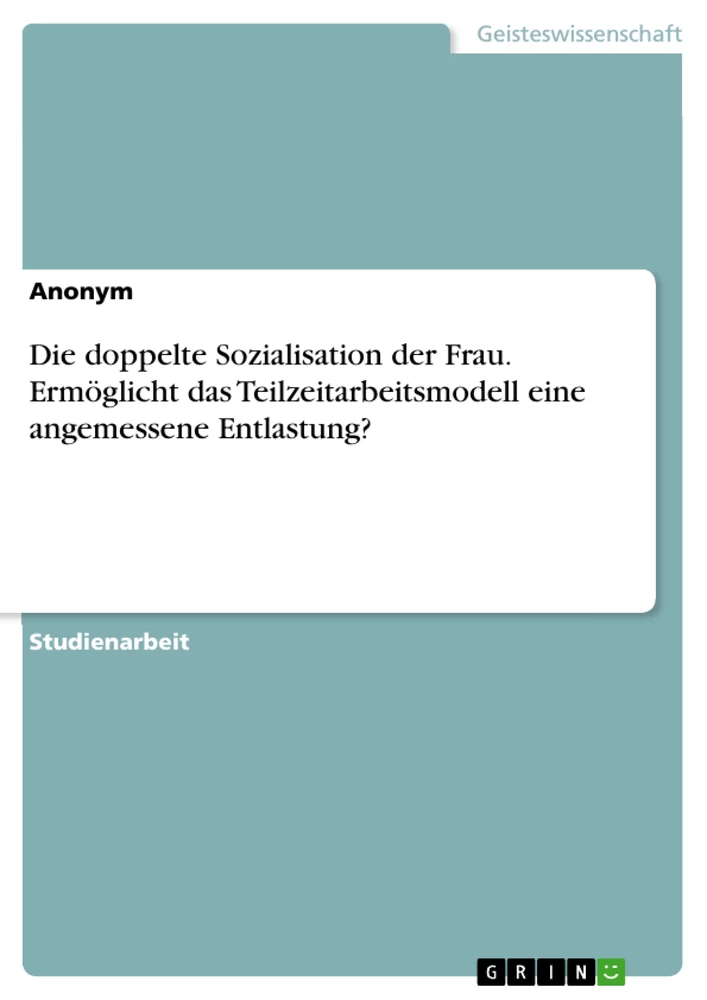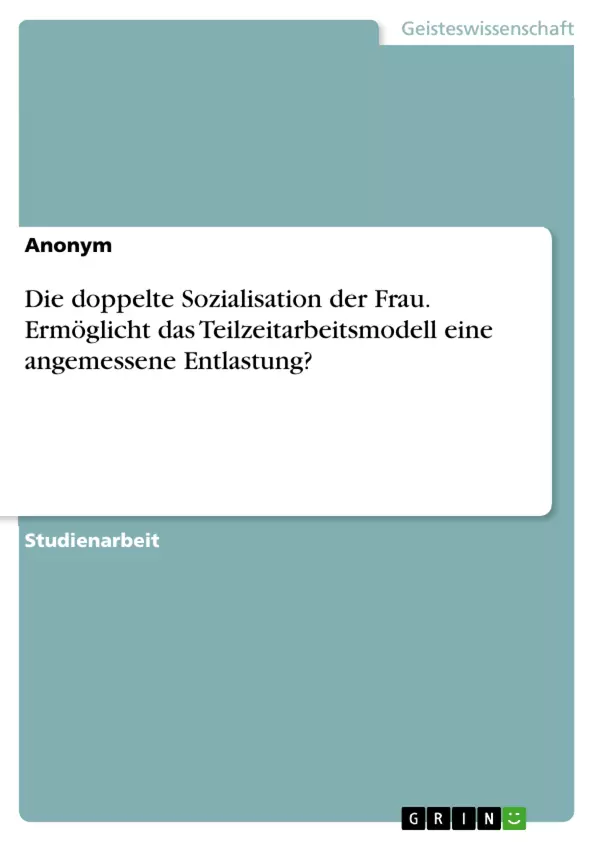Das Besondere an weiblicher Sozialisation ist, dass Frauen doppelt vergesellschaftet werden. "Frauen erfahren ihre Sozialisation sowohl in der Familie, im sozioökonomischen Umfeld als auch in schulischen und beruflichen Ausbildungsgängen; sie werden sowohl auf reproduktive Arbeit im Privaten wie auf Anforderungen der Erwerbssphäre vorbereitet" (Knapp 1990).
In diesem Sozialisationsprozess sind Frauen spezifischen Ambiguitätserfahrungen ausgesetzt, die als Lernerfahrungen eingeordnet werden können. Die doppelte Orientierung an zwei Tätigkeitsfeldern führt dazu, dass dieser Sozialisationsprozess nicht linear erfolgt, sondern – anders als bei der männlichen Sozialisation - von Diskontinuitäten, Brüchen und Unvereinbarkeiten gekennzeichnet ist. Hierbei handelt es sich nicht um nacheinander geschaltete Orientierungswechsel zwischen Beruf und Familie – viel mehr läuft die Arbeit in den Tätigkeitsfeldern Hausarbeit, Reproduktionsarbeit und Erwerbstätigkeit parallel zueinander ab.
Diese Tätigkeitsfelder sind teilweise widersprüchlich und stellen eine Doppelbelastung für Frauen dar. In dieser Ausarbeitung soll der Frage nachgegangen werden, ob das Teilzeitarbeitsmodell eine Entlastung für erwerbstätige Mütter sein kann. Hierzu wird zunächst der historische Ursprung der doppelten Vergesellschaftung von Frauen beschrieben. Anschließend wird das Projekt "Erfahrungen lohnabhängig arbeitender Mütter" als empirisches Referenzsystem für das Theorem der doppelten Vergesellschaftung beschrieben. Im Anschluss daran werden Vor- und Nachteile der Teilzeitarbeit für Frauen erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Ursprung der doppelten Vergesellschaftung von Frauen
- „Erfahrungen lohnabhängig arbeitender Mütter“: das empirische Referenzsystem für das Theorem von der doppelten Vergesellschaftung
- Teilzeitarbeit als Lösung der doppelten Sozialisation von Frauen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der doppelten Vergesellschaftung von Frauen und untersucht, ob das Teilzeitarbeitsmodell eine Entlastung für erwerbstätige Mütter darstellen kann.
- Der historische Ursprung der doppelten Vergesellschaftung von Frauen
- Das empirische Referenzsystem des „Erfahrungen lohnabhängig arbeitender Mütter“ Projektes
- Vor- und Nachteile der Teilzeitarbeit für Frauen
- Die Auswirkungen der doppelten Vergesellschaftung auf die Lebensrealität von Frauen
- Die Ambiguitätstoleranz von Frauen im Kontext der doppelten Vergesellschaftung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der doppelten Vergesellschaftung von Frauen ein und stellt die Fragestellung der Arbeit dar.
- Historischer Ursprung der doppelten Vergesellschaftung von Frauen: Dieses Kapitel beschreibt die historischen Entwicklungen, die zur Entstehung der doppelten Vergesellschaftung von Frauen führten, insbesondere im Kontext der Industrialisierung und der damit verbundenen Veränderungen in der Familien- und Arbeitswelt.
- „Erfahrungen lohnabhängig arbeitender Mütter“: das empirische Referenzsystem für das Theorem von der doppelten Vergesellschaftung: Dieses Kapitel stellt das Projekt „Erfahrungen lohnabhängig arbeitender Mütter“ vor und erläutert, wie es als empirisches Referenzsystem für das Konzept der doppelten Vergesellschaftung von Frauen dient.
Schlüsselwörter
Doppelte Vergesellschaftung, Frauen, Sozialisation, Teilzeitarbeit, Erwerbstätigkeit, Familienarbeit, Ambiguitätstoleranz, „Erfahrungen lohnabhängig arbeitender Mütter“, Akkordarbeit, Hausarbeit, Industrielle Revolution, Geschlechterordnung, Arbeitsbelastung, Mehrproduktion.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „doppelte Vergesellschaftung“ von Frauen?
Es beschreibt, dass Frauen parallel für die reproduktive Arbeit im Privaten (Familie) und für die Anforderungen der Erwerbssphäre (Beruf) sozialisiert werden.
Wie unterscheidet sich die weibliche von der männlichen Sozialisation?
Frauen erleben oft Brüche und Unvereinbarkeiten durch die Orientierung an zwei Tätigkeitsfeldern, während die männliche Sozialisation meist linearer auf den Beruf ausgerichtet ist.
Bietet Teilzeitarbeit eine echte Entlastung für Mütter?
Die Arbeit untersucht kritisch Vor- und Nachteile und hinterfragt, ob das Modell die strukturelle Doppelbelastung tatsächlich löst oder neue Probleme schafft.
Was ist der historische Ursprung der doppelten Vergesellschaftung?
Der Ursprung liegt in der Industriellen Revolution, die zu einer Trennung von privatem Haushalt und öffentlicher Arbeitswelt sowie einer neuen Geschlechterordnung führte.
Was versteht man unter Ambiguitätstoleranz im Kontext von Frauen?
Es ist die Fähigkeit, widersprüchliche Anforderungen aus Beruf und Familie auszuhalten und als Lernerfahrung in die eigene Identität zu integrieren.
Welches empirische Projekt dient als Referenz für diese Arbeit?
Die Arbeit stützt sich auf das Projekt „Erfahrungen lohnabhängig arbeitender Mütter“ als empirisches Referenzsystem.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Die doppelte Sozialisation der Frau. Ermöglicht das Teilzeitarbeitsmodell eine angemessene Entlastung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388126