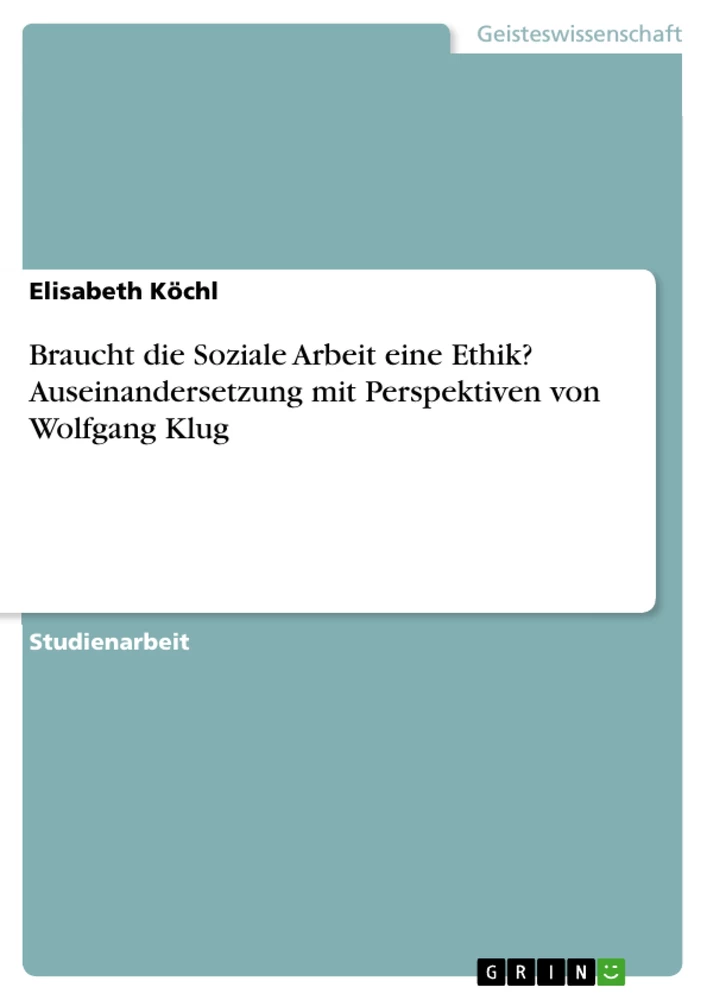In der vorliegenden Arbeit gebe ich die Ansichten von Wolfgang Klug, aus seinem Beitrag „Braucht die Soziale Arbeit eine Ethik? - Ethische Fragestellungen als Beitrag zur Diskussion der Sozialarbeitswissenschaft im Kontext ökonomischer Herausforderungen,“ wieder und gehe dabei zuerst auf zwei Einwände gegen eine wissenschaftliche Ethik ein, mit denen sich Klug beschäftigt. Anschliessend schildere ich meine eigene Sichtweise und bewerte diese Einwände.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Autor
- Vorbemerkungen
- Zwei Einwände gegen eine wissenschaftliche Ethik in der Sozialen Arbeit
- Klugs Betrachtungsweise der Ethik – Abgrenzung zur transzendentalen Ethik
- Berufsethik als Mindestvoraussetzung für die Soziale Arbeit
- Reichen Verpflichtungen des Berufcodes bis ins Privatleben?
- Problematik eines Konflikts mit den Dienstgebern – helfen die deutsche Berufsordnung?
- Weshalb sollte die philosophische Reflexion empirischer Daten helfen?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Wolfgang Klugs Position zur Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Ethik in der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet Klugs Argumentation gegen zwei zentrale Einwände und untersucht seine Methodik der ethischen Betrachtung, im Vergleich zur transzendentalen Ethik. Die Arbeit diskutiert zudem die Rolle der Berufsethik und die Bedeutung der philosophischen Reflexion empirischer Daten im Kontext der Sozialen Arbeit.
- Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Ethik in der Sozialen Arbeit
- Klugs Abgrenzung von einer transzendentalen Ethik
- Bedeutung von Berufsethik und professionellen Codes
- Philosophische Reflexion empirischer Daten in der Sozialen Arbeit
- Soziale Gerechtigkeit als Leitprinzip der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Arbeit ein und beschreibt den Fokus auf Klugs Beitrag zur Diskussion um die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Ethik in der Sozialen Arbeit. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit zwei Einwänden gegen eine solche Ethik auseinandersetzt und anschließend Klugs Betrachtungsweise und ihre Abgrenzung von der transzendentalen Ethik darstellt. Die Bedeutung der Berufsethik und die Reflexion empirischer Daten werden als weitere zentrale Themen genannt.
Zwei Einwände gegen eine wissenschaftliche Ethik in der Sozialen Arbeit: Dieses Kapitel präsentiert zwei gegensätzliche Argumentationen gegen eine wissenschaftliche Ethik in der Sozialen Arbeit. Der erste Einwand betrachtet Soziale Arbeit als reine Technik, die durch methodisch abgesicherte Programme eine ethische Reflexion überflüssig macht. Der zweite Einwand beruft sich auf die Pluralisierung der Lebensentwürfe und die kulturelle Vielfalt, die eine eindeutige Bestimmung eines „geglückten Lebens“ unmöglich machen. Klug widerlegt diese Einwände, indem er die soziale und politische Einbettung der Sozialen Arbeit sowie die Notwendigkeit einer gemeinsamen Vernunft für ethische Argumentation hervorhebt.
Berufsethik als Mindestvoraussetzung für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel analysiert Klugs Argumentation für eine Berufsethik als unverzichtbare Grundlage der Sozialen Arbeit. Es untersucht die Reichweite von Verpflichtungen aus Berufscodes, mögliche Konflikte mit Arbeitgebern und die Rolle der philosophischen Reflexion empirischer Daten. Die Bedeutung von "sozialer Gerechtigkeit" als Leitprinzip wird diskutiert, und wie ethische Entscheidungen die Grenzen des Aufgabenbereichs der Sozialen Arbeit definieren. Die Notwendigkeit, ethische und moralische Kriterien in der Praxis der Sozialen Arbeit zu berücksichtigen, wird betont.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Ethik, Berufsethik, wissenschaftliche Ethik, transzendentale Ethik, soziale Gerechtigkeit, Berufscodes, empirische Daten, philosophische Reflexion, Pluralisierung, technizistische Orientierung, Menschenwürde, Humanität.
Häufig gestellte Fragen zu "Zwei Einwände gegen eine wissenschaftliche Ethik in der Sozialen Arbeit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Position von Wolfgang Klug zur Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Ethik in der Sozialen Arbeit. Sie untersucht seine Argumentation gegen Einwände gegen eine solche Ethik, seine ethische Betrachtungsweise im Vergleich zur transzendentalen Ethik, die Rolle der Berufsethik und die Bedeutung der philosophischen Reflexion empirischer Daten in der Sozialen Arbeit.
Welche Einwände gegen eine wissenschaftliche Ethik in der Sozialen Arbeit werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zwei zentrale Einwände: Erstens, die Auffassung, dass Soziale Arbeit eine reine Technik ist, die durch methodisch abgesicherte Programme eine ethische Reflexion überflüssig macht. Zweitens, die Argumentation, dass die Pluralisierung der Lebensentwürfe und die kulturelle Vielfalt eine eindeutige Bestimmung eines „geglückten Lebens“ unmöglich machen. Klug widerlegt diese Einwände.
Wie grenzt Klug seine ethische Betrachtungsweise von der transzendentalen Ethik ab?
Die Arbeit beleuchtet Klugs Methodik der ethischen Betrachtung und vergleicht sie mit der transzendentalen Ethik. Die genaue Abgrenzung wird im Text detailliert dargestellt, jedoch wird hier nicht im Detail erläutert.
Welche Rolle spielt die Berufsethik in Klugs Argumentation?
Klug argumentiert für eine Berufsethik als unverzichtbare Grundlage der Sozialen Arbeit. Die Arbeit untersucht die Reichweite der Verpflichtungen aus Berufscodes, mögliche Konflikte mit Arbeitgebern und die Rolle der philosophischen Reflexion empirischer Daten in Bezug auf die Berufsethik.
Welche Bedeutung hat die philosophische Reflexion empirischer Daten in der Sozialen Arbeit laut Klug?
Die Arbeit betont die Bedeutung der philosophischen Reflexion empirischer Daten im Kontext der Sozialen Arbeit und untersucht, wie diese Reflexion ethische Entscheidungen und die Abgrenzung des Aufgabenbereichs der Sozialen Arbeit beeinflusst.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte umfassen Soziale Arbeit, Ethik, Berufsethik, wissenschaftliche Ethik, transzendentale Ethik, soziale Gerechtigkeit, Berufscodes, empirische Daten, philosophische Reflexion, Pluralisierung, technizistische Orientierung, Menschenwürde und Humanität.
Was ist die Hauptthese der Arbeit?
Die Hauptthese besteht darin, die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Ethik in der Sozialen Arbeit zu begründen und Klugs Argumentation sowie dessen Methodik zu analysieren und zu bewerten, insbesondere im Hinblick auf die behandelten Einwände und die Rolle der Berufsethik und der Reflexion empirischer Daten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit folgt einer klaren Struktur mit Einleitung, Darstellung der Einwände gegen eine wissenschaftliche Ethik, Analyse von Klugs Position, einer Diskussion der Berufsethik und einem Schluss. Kapitelzusammenfassungen sind im HTML-Dokument enthalten.
- Arbeit zitieren
- Elisabeth Köchl (Autor:in), 2010, Braucht die Soziale Arbeit eine Ethik? Auseinandersetzung mit Perspektiven von Wolfgang Klug, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388197