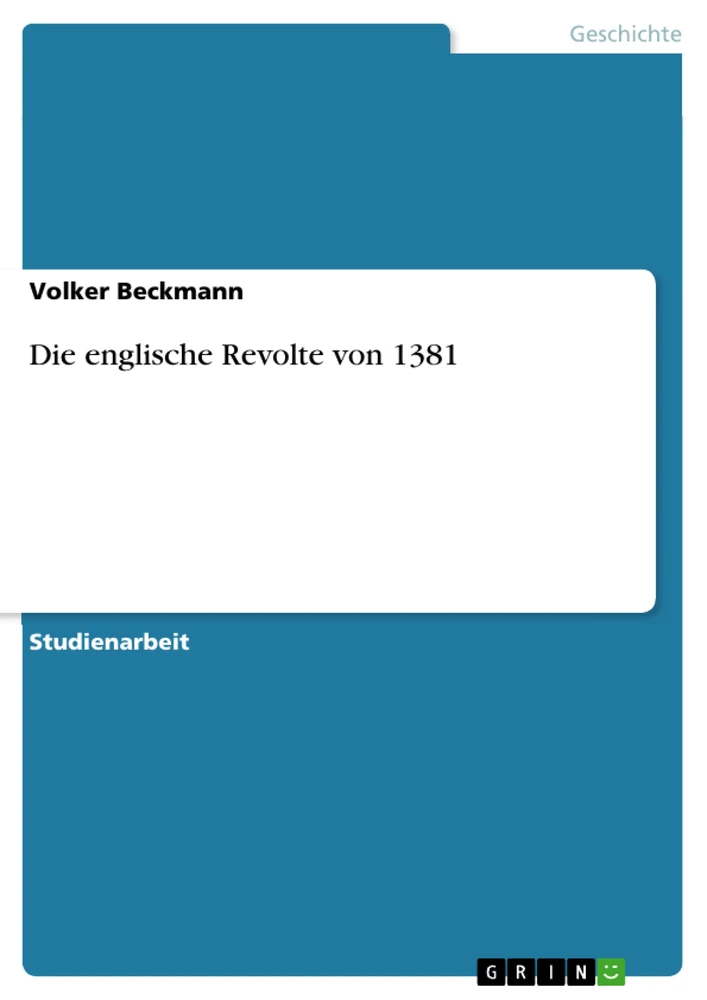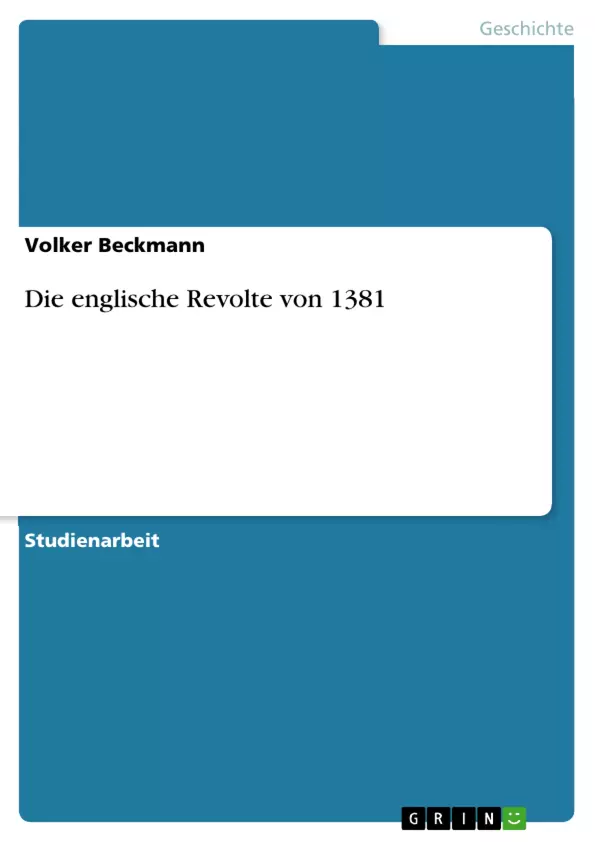Schon im England des 12. Jahrhunderts begannen die Grundherren Arbeitsrenten, die ihre Hörigen zu leisten hatten, in Geldrenten umzuwandeln. Die Erfahrung hatte die Gutsverwalter gelehrt, daß die grundherrschaftliche Domäne wirtschaftlicher mit Arbeitskräften bearbeitet werden konnte, die jedes Jahr gemietet wurden, als auf die Frondienste von unwilligen Hörigen zu vertrauen. Eine Ursache der Wiedereinführung der Arbeitsdienste und ihrer Erhöhung im 13. Jahrhundert war die allgemeine Bevölkerungszunahme, die zu verstärkter Konkurrenz der Bauern untereinander in der Landnachfrage führte, aber auch die Löhne drückte. Der Bevölkerungsrückgang nach der Pestwelle von 1348/49 verbesserte die langfristige Situation der Hörigen insofern, als die Gutsverwalter wegen der hohen Löhne der Landarbeiter bevorzugt wieder Geldrenten anstelle von Arbeitsrenten von ihren Hörigen verlangten oder die Domäne verpachteten. Das Landangebot schuf eine neue Klasse von wohlhabenden Bauern, die oft selbst Landarbeiter einstellten. Das Stigma des Hörigenstatus mußte die Bauern umso schwerer belasten, als die Möglichkeiten des Landerwerbs sich mehrten und die bäuerliche Arbeitskraft umso höher bewertet wurde. Die Forderungen englischer Lohnarbeiter nach höheren Löhnen, die von den Arbeitgebern gewährt werden mußten, wurden durch das Inkrafttreten des Statute of Labourers (1351) gedämpft. Die königlichen Beamten, die sheriffs, die Sheriffoffiziere, die Kollektoren und die Arbeits- und Friedensrichter waren zur Durchführung der Bestimmungen des Statutes beauftragt, Lohnfestsetzungen zum Wohle der Arbeitgeber und der königlichen Einkünfte zu erzwingen. Langfristig stiegen die Löhne der Landarbeiter und Handwerker dennoch an. In London standen den kleinen in Zünften organisierten Handwerkern, die in Livery companies zusammengefaßten Seiden-, Tuch- und Lebensmittelgroßhändler gegenüber, die den Stadtrat und die politischen Ämter der Stadt beherrschten. Die alten Handwerksbetriebe waren immer mehr in eine Zulieferrolle gedrängt und sahen Konkurrenz durch eigene Gesellen, die sich selbstständig machen wollten, ungern. Gesellen hatten sich schon seit dem frühen 14. Jahrhundert in eigenen Vereinen assoziiert und solidarische Aktionen gegen die Preispolitik der Meister durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen und Vorgeschichte der Revolte von 1381
- Englische Politik am Vorabend der Revolte
- Grundherrschaftliche Konflikte vor 1381
- Städtische Konflikte und Interessengruppen
- Auswirkungen des Bevölkerungsrückganges im England des 14. Jahrhunderts
- Sozialkritik in Predigt und Literatur im England des 14. Jahrhunderts
- Der Verlauf der Revolte. Die Forderungen der Rebellen
- Der Ausbruch der Revolte in Kent und Essex. Der Zug der Rebellen nach London
- Die Ereignisse in London am 13., 14. und 15. Juni 1381
- Die Rebellion in Suffolk und Norfolk
- Die Rebellion in St. Albans und Cambridge
- Die Reaktion
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen, den Verlauf und die Folgen der englischen Revolte von 1381. Sie analysiert die komplexen sozialen und politischen Spannungen, die zu diesem Aufstand führten, und beleuchtet die unterschiedlichen Interessen und Motive der beteiligten Gruppen, darunter Bauern, Handwerker, Lohnarbeiter und städtische Eliten.
- Die Rolle des Hundertjährigen Krieges in der Entstehung sozialer Konflikte
- Die Auswirkungen von Bevölkerungsrückgang und Pest auf die englische Gesellschaft
- Die Konflikte zwischen Grundherren und Hörigen
- Die Rolle der städtischen Zünfte und die Konflikte innerhalb der Städte
- Die Reaktion des englischen Königtums auf die Revolte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der englischen Revolte von 1381 ein und stellt die wichtigsten Aspekte der Arbeit vor. Sie beleuchtet die historischen Umstände, die zum Ausbruch des Aufstandes führten, und skizziert die zentralen Themen der Arbeit.
Kapitel 2.0: Ursachen und Vorgeschichte der Revolte von 1381: Dieses Kapitel analysiert die sozialen und politischen Ursachen der Revolte. Es untersucht die Auswirkungen des Hundertjährigen Krieges auf die englische Gesellschaft und die Spannungen zwischen Grundherren und Hörigen.
Kapitel 2.1: Englische Politik am Vorabend der Revolte: Dieses Kapitel beleuchtet die englische Politik im Vorfeld der Revolte und die Rolle des Königs in den Konflikten mit Frankreich. Es analysiert die Steuerpolitik und die Versuche des Königs, die Finanzmittel für den Krieg zu sichern.
Kapitel 2.2: Grundherrschaftliche Konflikte vor 1381: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Konflikte zwischen Grundherren und Hörigen im 14. Jahrhundert. Es untersucht die verschiedenen Formen der Frondienste und die Spannungen, die durch die Umwandlung von Arbeitsrenten in Geldrenten entstanden.
Kapitel 2.3: Städtische Konflikte und Interessengruppen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Konflikten innerhalb der Städte und den Interessen der verschiedenen städtischen Gruppen. Es analysiert die Rolle der Zünfte, die Auseinandersetzungen zwischen Handwerkern und Großhändlern sowie die Konflikte zwischen städtischen Eliten und der Bevölkerung.
Kapitel 2.4: Auswirkungen des Bevölkerungsrückganges im England des 14. Jahrhunderts: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Bevölkerungsrückgangs nach der Pest auf die englische Gesellschaft. Es beleuchtet die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Arbeitsverhältnisse und die sozialen Strukturen.
Kapitel 2.5: Sozialkritik in Predigt und Literatur im England des 14. Jahrhunderts: Dieses Kapitel analysiert die soziale Kritik, die in Predigten und literarischen Werken des 14. Jahrhunderts zum Ausdruck kommt. Es untersucht, wie die Zeitgenossen die sozialen Missstände wahrnahmen und kritisierten.
Kapitel 3.0: Der Verlauf der Revolte. Die Forderungen der Rebellen: Dieses Kapitel beschreibt den Ausbruch der Revolte und den Verlauf der Ereignisse. Es analysiert die Forderungen der Rebellen und die Reaktionen der königlichen Behörden.
Kapitel 3.1: Der Ausbruch der Revolte in Kent und Essex. Der Zug der Rebellen nach London: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die frühen Phasen der Revolte in Kent und Essex. Es beleuchtet die Ereignisse, die zum Aufstand führten, und den Vormarsch der Rebellen nach London.
Kapitel 3.2: Die Ereignisse in London am 13., 14. und 15. Juni 1381: Dieses Kapitel beschreibt die Ereignisse in London während der Revolte und die Auseinandersetzungen zwischen den Rebellen und den königlichen Truppen.
Kapitel 3.3: Die Rebellion in Suffolk und Norfolk: Dieses Kapitel analysiert die Ausbreitung der Revolte in Suffolk und Norfolk und die lokalen Besonderheiten des Aufstandes in diesen Regionen.
Kapitel 3.4: Die Rebellion in St. Albans und Cambridge: Dieses Kapitel beleuchtet die Ereignisse in St. Albans und Cambridge während der Revolte und die Rolle der Universität Cambridge.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Englische Revolte von 1381, Hundertjähriger Krieg, soziale Konflikte, Grundherrschaft, Hörigkeit, Arbeitsrenten, Geldrenten, Stadtgesellschaft, Zünfte, Pest, Bevölkerungsrückgang, soziale Kritik, Predigten, Literatur, Rebellion, Forderungen der Rebellen, Reaktion des Königtums.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Ursache der englischen Revolte von 1381?
Hauptursachen waren die wirtschaftlichen Folgen der Pest, die hohe Steuerlast durch den Hundertjährigen Krieg und Konflikte um Frondienste.
Welche Rolle spielte der Bevölkerungsrückgang durch die Pest?
Der Arbeitskräftemangel stärkte die Verhandlungsposition der Bauern, was zu Konflikten mit den Grundherren führte, die alte Abhängigkeiten erzwingen wollten.
Wer waren die Rebellen?
Die Bewegung bestand aus Bauern, Handwerkern und Lohnarbeitern, die gegen soziale Ungerechtigkeit und die Privilegien der Eliten aufbegehrten.
Was geschah im Juni 1381 in London?
Die Rebellen zogen nach London, besetzten wichtige Punkte und verhandelten direkt mit dem jungen König Richard II. über ihre Forderungen.
Wie reagierte das Königtum auf den Aufstand?
Nach anfänglichen Zugeständnissen schlug die Krone die Revolte militärisch nieder und nahm die versprochenen Reformen größtenteils wieder zurück.
- Arbeit zitieren
- Dr. phil. Volker Beckmann (Autor:in), 1979, Die englische Revolte von 1381, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388657