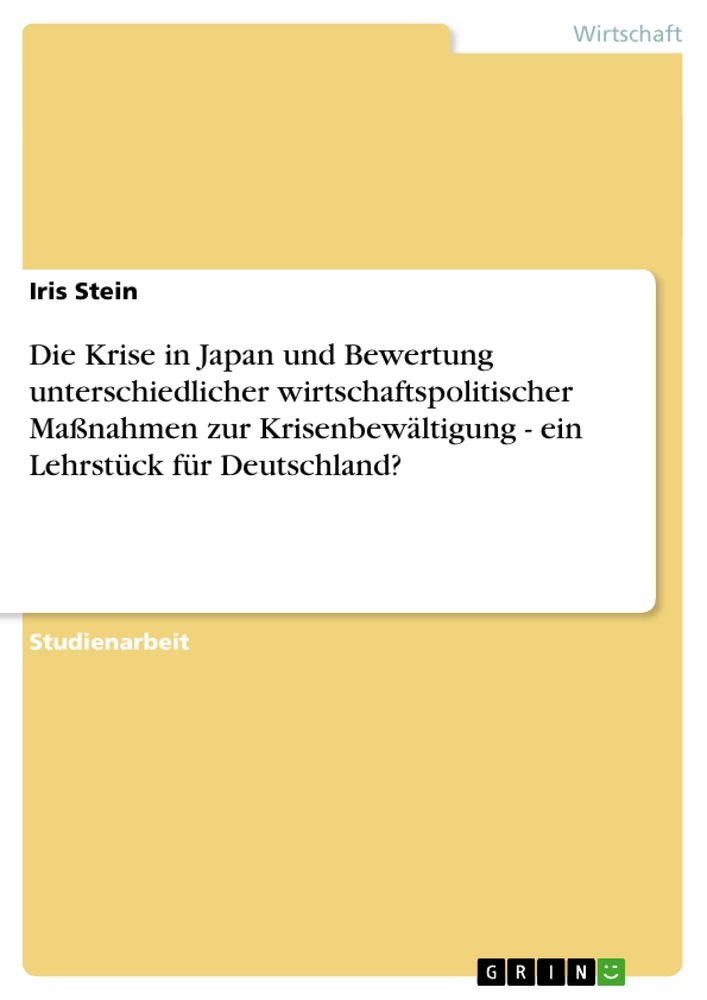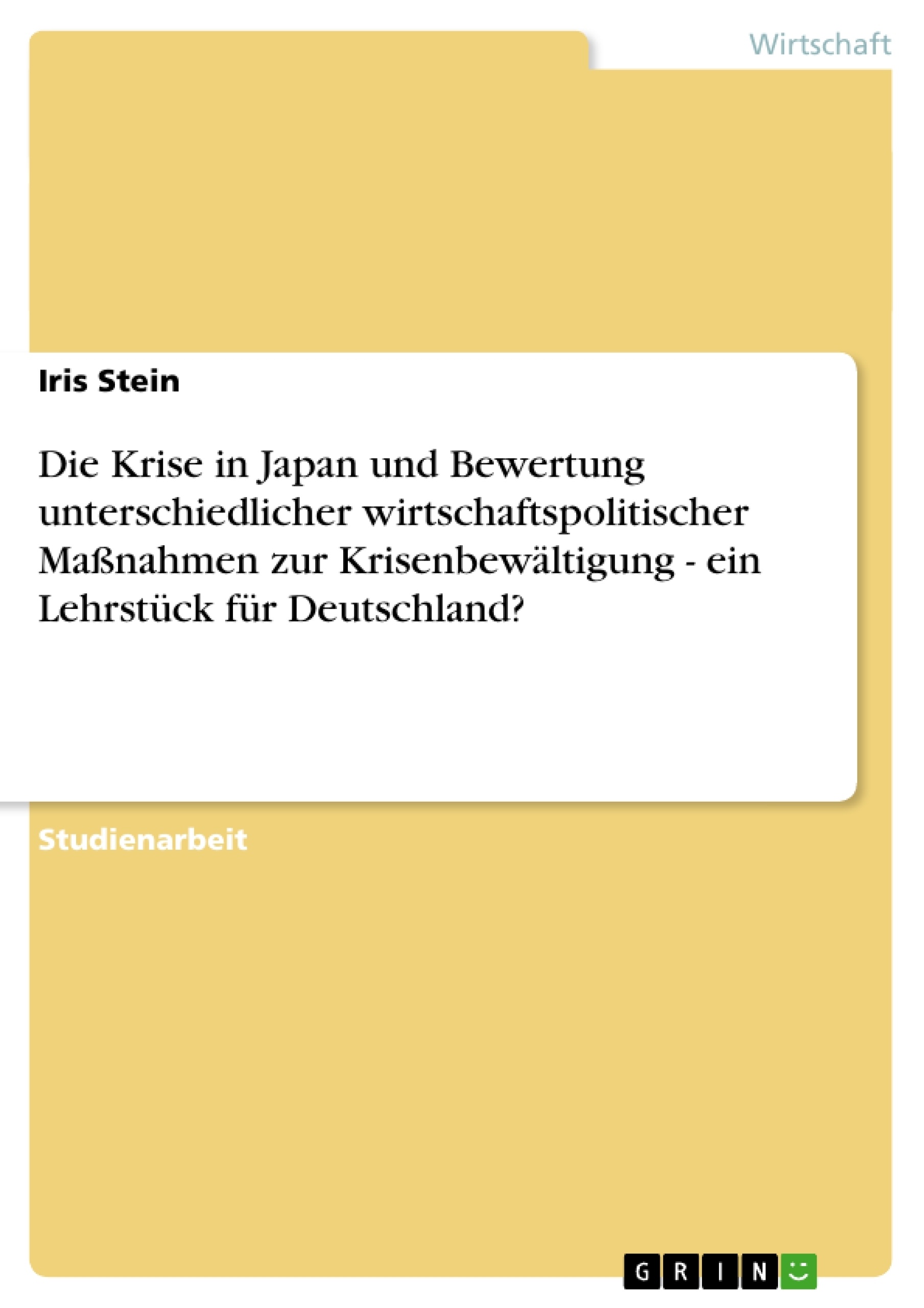„Japan rutscht erneut in die Rezession“ so oder ähnlich titeln derzeit einschlägige Wirtschaftsblätter. Werden sie Recht behalten oder handelt es nur um eine vorübergehende Abschwächung des BIP, hinter welcher erneut das Schreckgespenst der Rezession auftaucht? Noch immer liegen die Zinsen um den Nullpunkt. Der Regierung fehlt es in Anbetracht der Wirkungslosigkeit der klassischen Makrosteuerungselemente an effizienten Konzepten. Welche Handlungsmöglichkeiten hat sie noch? Was ist bisher erreicht worden und welche Fehlschläge mussten hingenommen werden?
Die Heisei-Rezession hielt Japan Anfang der Neunziger drei Jahre am Boden. Durch ihre Besonderheiten in Bezug auf Länge, Tiefe und mehrfach enttäuschte Aufschwungerwartungen hat sie das Vertrauen in die Entwicklung der einstigen Wachstumsnation nachhaltig erschüttert. An ihrem Beginn stand das Platzen der „economy bubble“ im April 1991. Doch versteht man Krise im strengen Sinne des Wortes als „Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung“, machte Japan seine Krise zu einem viel früheren Zeitpunkt durch.
1985 wurden im Zuge des „Plaza-Abkommens“ zur Stärkung des Dollars Yen und DM aufgewertet. Als Folge davon senkte die Bank of Japan (BOJ) die Leitzinsen drastisch. So hoffte man, entstehende Exporteinbußen kompensieren zu können. Die niedrigen Zinsen führten zu einer unnatürlich hohen Nachfrage nach Krediten zur Finanzierung von Immobilen- und Aktienanlagen; es bildete sich eine Spekulationsblase. Eine kurzsichtige Geldmarktpolitik bildete somit den Nährboden für die Überschätzung und Überschuldung Japans.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemstellung und Vorgehensweise
- 3. Grundlagen
- 3.1 Bruttoinlandsprodukt (BIP)
- 3.2 Konjunktur und Rezession
- 4. Die Wirtschaft Japans
- 4.1 Allgemeine Besonderheiten
- 4.2 Die wirtschaftliche Entwicklung seit 1945
- 4.3 Krise und Crash - Entwicklung und Folgen der „economy bubble“
- 4.4 Versuche zu regulieren – Wirtschaftpolitische Maßnahmen und ihre Wirkung
- 5. Was Deutschland von der Wirtschaft Japans lernen kann
- 5.1 Entwicklung und Situation der deutschen Wirtschaft - 1945 und heute
- 5.2 Die japanische Krise – ein Lehrstück für Deutschland?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die japanische Wirtschaftskrise der 1990er Jahre, insbesondere die "economy bubble" und die darauf folgende Heisei-Rezession. Ziel ist es, die Ursachen und Folgen dieser Krise zu untersuchen, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der japanischen Regierung zu bewerten und Parallelen sowie Unterschiede zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft zu beleuchten. Die Arbeit fragt schließlich danach, welche Lehren Deutschland aus der japanischen Krisenbewältigung ziehen kann.
- Die Entstehung und Folgen der japanischen "economy bubble"
- Wirtschaftspolitische Maßnahmen Japans zur Krisenbewältigung
- Vergleich der japanischen und deutschen Wirtschaftsentwicklung
- Analyse der Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen
- Ableitung von Lehren für Deutschland aus der japanischen Erfahrung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den aktuellen Zustand der japanischen Wirtschaft, die anhaltende Diskussion um eine mögliche Rezession und die damit verbundenen wirtschaftspolitischen Herausforderungen. Sie führt in die Thematik der Heisei-Rezession ein und betont deren Besonderheiten hinsichtlich Länge, Tiefe und die enttäuschten Erwartungen an eine schnelle Erholung. Die Entstehung der "economy bubble" im Zusammenhang mit dem Plaza-Abkommen von 1985 wird kurz angerissen, sowie die Frage nach Parallelen zur deutschen Wirtschaft und deren aktuellem Wachstumsproblem mit steigender Arbeitslosigkeit.
2. Problemstellung und Vorgehensweise: Dieses Kapitel definiert die Forschungsfrage und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Es werden die Ziele der Arbeit präzise benannt: Beschreibung der japanischen Krise ("economy bubble" und Heisei-Rezession), Analyse der Ursachen und Folgen, Untersuchung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen und ein Vergleich mit der deutschen Wirtschaft. Die Methodik umfasst Literaturrecherche, Recherche bei Institutionen und im Internet sowie vergleichende und beschreibende Methoden.
3. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Maß für die wirtschaftliche Leistung und erklärt zwei Ansätze zur Berechnung. Es erläutert außerdem den Konjunkturzyklus, definiert Rezessionen und verdeutlicht deren Auswirkungen auf das Produktionspotential. Der Zusammenhang zwischen BIP und Wohlstand wird kritisch beleuchtet, unter Hinweis auf den Human Development Index als eine alternative Messgröße.
4. Die Wirtschaft Japans: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der japanischen Wirtschaft. Es analysiert allgemeine Besonderheiten des japanischen Wirtschaftssystems, die wirtschaftliche Entwicklung seit 1945, die Entstehung und die Folgen der "economy bubble", sowie die verschiedenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die die japanische Regierung zur Bewältigung der Krise ergriffen hat. Dieser Abschnitt dürfte einen detaillierten Einblick in die Ursachen und die Auswirkungen der Krise liefern. Die Effektivität der einzelnen Maßnahmen wird analysiert und bewertet.
5. Was Deutschland von der Wirtschaft Japans lernen kann: Dieses Kapitel vergleicht die japanische und die deutsche Wirtschaftsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die jeweiligen Krisen und die angewandten oder möglichen Maßnahmen zur Krisenbewältigung. Es wird untersucht, ob und inwieweit sich die Erfahrungen Japans auf die deutsche Wirtschaft übertragen lassen und welche Lehren Deutschland daraus ziehen kann. Die Parallelen und Unterschiede zwischen den beiden Volkswirtschaften werden herausgearbeitet, um Schlussfolgerungen für die deutsche Wirtschaftspolitik abzuleiten.
Schlüsselwörter
Japanische Wirtschaftskrise, Heisei-Rezession, Economy Bubble, Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik, Geldpolitik, BIP, Konjunktur, Rezession, Deutschland, Wirtschaftsvergleich, Krisenbewältigung, Lehren aus der Krise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Analyse der japanischen Wirtschaftskrise der 1990er Jahre
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert die japanische Wirtschaftskrise der 1990er Jahre, insbesondere die "economy bubble" und die darauf folgende Heisei-Rezession. Sie untersucht die Ursachen und Folgen dieser Krise, bewertet die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der japanischen Regierung und beleuchtet Parallelen und Unterschiede zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Schließlich werden Lehren abgeleitet, die Deutschland aus der japanischen Krisenbewältigung ziehen kann.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Entstehung und Folgen der japanischen "economy bubble", wirtschaftspolitische Maßnahmen Japans zur Krisenbewältigung, ein Vergleich der japanischen und deutschen Wirtschaftsentwicklung, die Analyse der Wirksamkeit wirtschaftspolitischer Maßnahmen und die Ableitung von Lehren für Deutschland aus der japanischen Erfahrung. Die Arbeit umfasst auch eine Einleitung, die Problemstellung und Vorgehensweise, sowie grundlegende Definitionen von BIP und Konjunkturzyklen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den aktuellen Zustand der japanischen Wirtschaft und führt in die Heisei-Rezession ein. Kapitel 2 (Problemstellung und Vorgehensweise) definiert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Kapitel 3 (Grundlagen) legt die theoretischen Grundlagen dar (BIP, Konjunkturzyklen). Kapitel 4 (Die Wirtschaft Japans) analysiert die japanische Wirtschaft umfassend, einschließlich der "economy bubble" und der ergriffenen Maßnahmen. Kapitel 5 (Was Deutschland von der Wirtschaft Japans lernen kann) vergleicht die japanische und deutsche Wirtschaftsentwicklung und leitet Lehren für Deutschland ab.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Methodik umfasst Literaturrecherche, Recherche bei Institutionen und im Internet sowie vergleichende und beschreibende Methoden.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Japanische Wirtschaftskrise, Heisei-Rezession, Economy Bubble, Wirtschaftspolitik, Fiskalpolitik, Geldpolitik, BIP, Konjunktur, Rezession, Deutschland, Wirtschaftsvergleich, Krisenbewältigung, Lehren aus der Krise.
Welche Ziele verfolgt die Seminararbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die japanische Wirtschaftskrise zu beschreiben und zu analysieren, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu bewerten und einen Vergleich mit der deutschen Wirtschaft zu ziehen. Das übergeordnete Ziel ist es, Lehren für die deutsche Wirtschaftspolitik abzuleiten.
Wie wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Arbeit behandelt?
Das BIP wird als Maß für die wirtschaftliche Leistung definiert und es werden zwei Ansätze zur Berechnung erläutert. Der Zusammenhang zwischen BIP und Wohlstand wird kritisch beleuchtet, unter Hinweis auf den Human Development Index als alternative Messgröße.
Wie wird der Konjunkturzyklus in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit erläutert den Konjunkturzyklus, definiert Rezessionen und verdeutlicht deren Auswirkungen auf das Produktionspotential.
Welche Rolle spielt der Vergleich zwischen der japanischen und der deutschen Wirtschaft?
Die Arbeit vergleicht die japanische und die deutsche Wirtschaftsentwicklung, insbesondere im Hinblick auf die jeweiligen Krisen und die angewandten oder möglichen Maßnahmen zur Krisenbewältigung. Es wird untersucht, ob und inwieweit sich die Erfahrungen Japans auf die deutsche Wirtschaft übertragen lassen.
- Citar trabajo
- Iris Stein (Autor), 2005, Die Krise in Japan und Bewertung unterschiedlicher wirtschaftspolitischer Maßnahmen zur Krisenbewältigung - ein Lehrstück für Deutschland?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38892