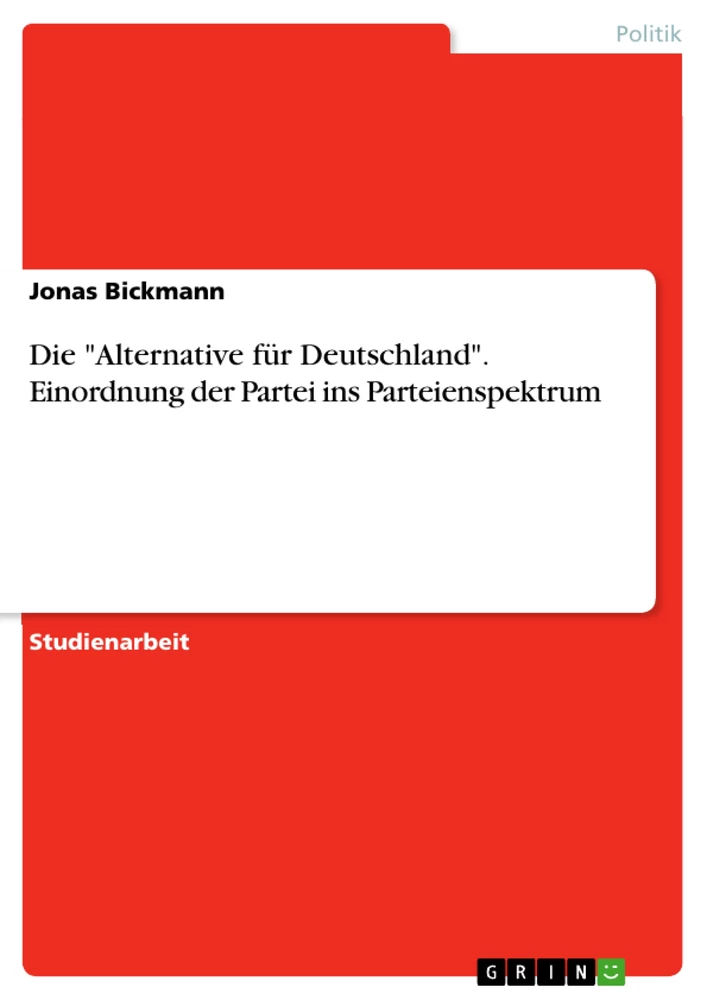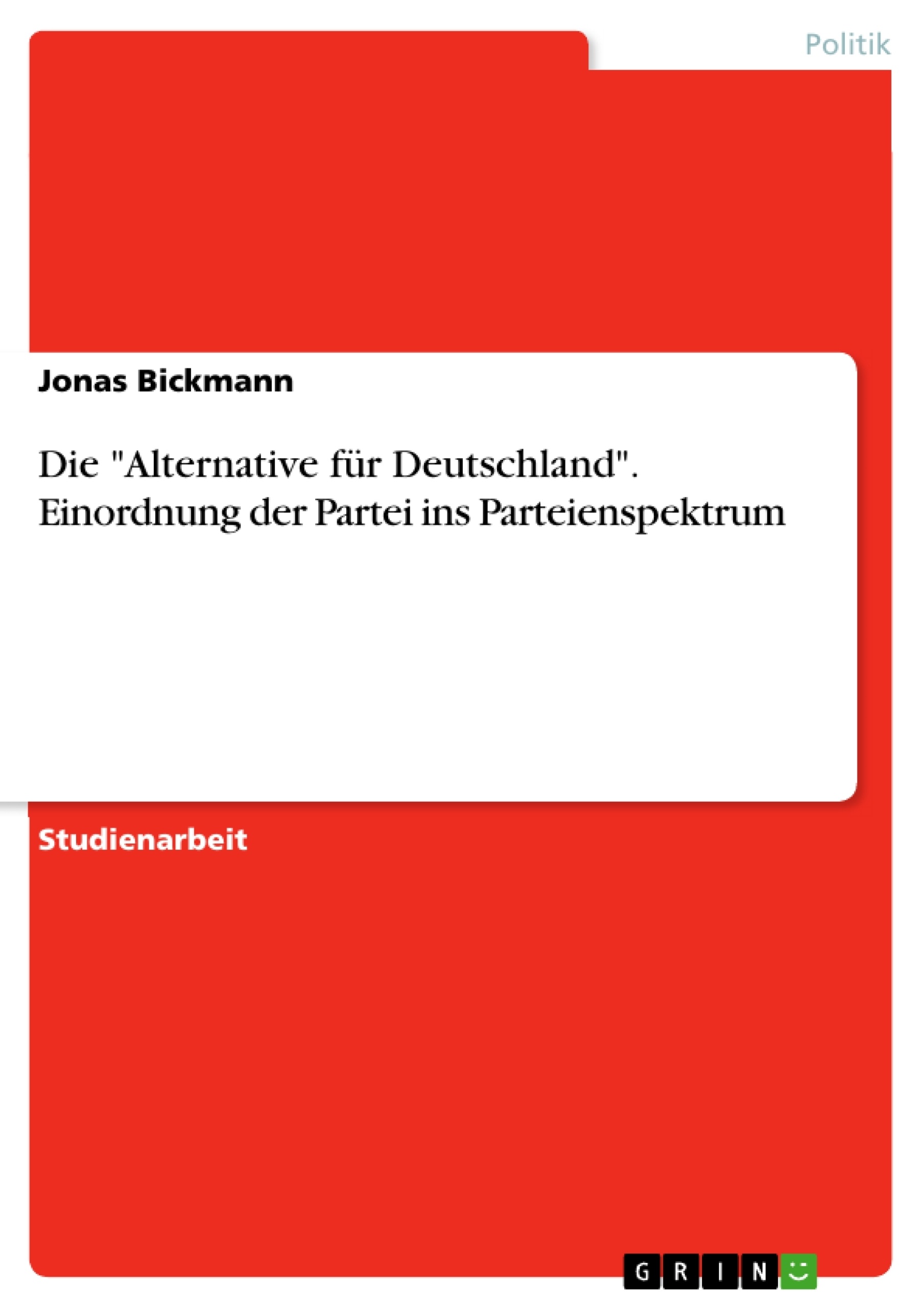Die Partei 'Alternative für Deutschland' (AfD) sorgt seit ihrer Gründung 2013 für großes mediales Aufsehen in der Gesellschaft. Innerhalb kürzester Zeit konnte sie in das Europaparlament, sowie in mehrere Landtage einziehen. Den Einzug in den Bundestag verfehlte sie nur knapp. Die vorliegende Hausarbeit versucht eine Einordnung der AfD in das deutsche Parteienspektrum bzw. die Zuordnung zu einer Parteienfamilie. Da die AfD oftmals mit dem Rechtspopulismus in Verbindung gebracht wird, ist die Frage nach der Zugehörigkeit der AfD zu diesem der thematische Schwerpunkt der Einordnung. Ausgangspunkt ist die Darstellung der rechtspopulistischen Parteienfamilie nach Decker.
Hierzu wird zunächst eine Definition des Rechtspopulismus angeführt. Im weiteren werden die Grundzüge Deckers Darstellung der rechtspopulistischen Parteienfamilie dargelegt und Kriterien aufgestellt, die die Zugehörigkeit zu einer solchen bedingen.
Im Weiteren wird die AfD mit diesen Kriterien verglichen. Hierzu werden sowohl die Programmatik der AfD, als auch Wählerstruktur und die Aussagen einiger Parteifunktionäre betrachtet.
Zusätzlich erfolgt ein Vergleich der AfD mit einer anderen, in der Politikwissenschaft als klar rechtspopulistisch definierten Partei, dem Front National. Abschließend wird anhand der Kriterien eine Zuordnung der AfD zu der Parteifamilie des Rechtspopulismus oder ggf. einer anderen Parteifamilie vorgenommen. Relevant ist dies vor allem, um im Falle einer Zuordnung zur rechtspopulistischen Parteienfamilie oder eines anderen rechten Milieus angemessene Prävention leisten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtspopulismus
- Parteienfamilien
- Die rechtspopulistische Parteienfamilie
- Organisatorische Merkmale
- Wählerstruktur und Entstehungshintergrund
- Ideologische Merkmale
- Die rechtspopulistische Parteienfamilie
- Die 'Alternative für Deutschland'
- Entstehungshintergrund der 'Alternative für Deutschland'
- Chronik der AfD
- Analyse der 'Alternative für Deutschland' im Bezug auf rechtspopulistische Merkmale
- Programmatik und politische Leitlinien
- Entstehungshintergrund
- Mitglieder
- Mitglieder aus rechten Vereinigungen
- Mitgliederaussagen
- Wählerschaft
- Vergleich mit anderen rechtspopulistischen Parteien Europas am gewählten Beispiel des Front National
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die „Alternative für Deutschland“ (AfD) und ordnet sie in das deutsche Parteienspektrum ein. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob die AfD der rechtspopulistischen Parteienfamilie zuzuordnen ist. Dabei werden die Definition von Rechtspopulismus sowie die Kriterien der rechtspopulistischen Parteienfamilie nach Decker berücksichtigt. Anhand dieser Kriterien wird die AfD anhand ihrer Programmatik, Wählerstruktur und Aussagen von Parteifunktionären untersucht. Darüber hinaus erfolgt ein Vergleich mit dem Front National, einer weiteren Partei, die in der Politikwissenschaft als klar rechtspopulistisch eingestuft wird. Das Ziel ist es, die AfD einer Parteifamilie zuzuordnen und somit die Möglichkeit für angemessene Präventionsmaßnahmen im Falle einer Zuordnung zu einer rechten Gruppierung zu schaffen.
- Einordnung der AfD in das deutsche Parteienspektrum
- Zuordnung der AfD zu einer Parteifamilie
- Analyse der AfD anhand von Programmatik, Wählerstruktur und Parteifunktionärsaussagen
- Vergleich der AfD mit dem Front National
- Bedeutung der Zuordnung für Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit stellt die AfD und deren rasante Entwicklung seit ihrer Gründung 2013 vor. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die in der Einordnung der AfD in das deutsche Parteienspektrum und der Frage nach ihrer Zugehörigkeit zur rechtspopulistischen Parteienfamilie liegt.
- Rechtspopulismus: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Populismus und dessen soziale Basis. Die Bedeutung der Modernisierung und der damit verbundenen Auflösung traditioneller Strukturen für die Entstehung von Rechtspopulismus wird beleuchtet. Des Weiteren werden die wichtigsten Merkmale von Rechtspopulismus, wie die Abgrenzung zwischen Volk und Elite, die Anti-Establishment-Orientierung, die Verwendung von Feindbildern und die Anti-Pluralistische-Haltung, erläutert.
- Parteienfamilien: Hier werden verschiedene Kriterien zur Typologisierung von Parteien vorgestellt, wobei der Fokus auf der ideologischen Ausrichtung liegt. Es wird die Unterscheidung zwischen Parteienfamilien, die regional getrennt sind, und Parteienfamilien, die ideologisch differenziert sind, erklärt.
- Die rechtspopulistische Parteienfamilie: Dieses Kapitel stellt Deckers Typologisierungsvorschlag der rechtspopulistischen Parteienfamilie vor, der neben dem ideologischen Merkmal auch Organisation, Wählerstruktur und Entstehungshintergrund einer Partei berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Rechtspopulismus, Parteienfamilien, 'Alternative für Deutschland' (AfD), Front National, Programmatik, Wählerstruktur, Parteifunktionäre, Prävention, politische Einordnung.
Häufig gestellte Fragen
Ist die AfD eine rechtspopulistische Partei?
Die Arbeit analysiert die AfD anhand von Kriterien wie Anti-Establishment-Orientierung, Verwendung von Feindbildern und der Abgrenzung zwischen „Volk“ und „Elite“, um sie dem Rechtspopulismus zuzuordnen.
Welche Kriterien definieren die rechtspopulistische Parteienfamilie?
Nach Decker gehören dazu ideologische Merkmale (Nationalismus, Anti-Pluralismus), spezifische Organisationsformen, die Wählerstruktur und der Entstehungshintergrund.
Wie wird die AfD mit dem Front National verglichen?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen der AfD und dem französischen Front National, der als klassisches Beispiel einer rechtspopulistischen Partei in Europa gilt.
Welche Rolle spielen Parteifunktionäre bei der Einordnung?
Neben dem offiziellen Programm werden auch Aussagen von Parteifunktionären und deren Verbindungen zu rechten Vereinigungen zur Analyse herangezogen.
Warum ist die Einordnung in eine Parteienfamilie wichtig?
Die wissenschaftliche Zuordnung hilft dabei, politische Entwicklungen zu verstehen und gegebenenfalls angemessene Präventionsmaßnahmen gegen extremistische Tendenzen zu entwickeln.
- Citar trabajo
- Jonas Bickmann (Autor), 2015, Die "Alternative für Deutschland". Einordnung der Partei ins Parteienspektrum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/389016