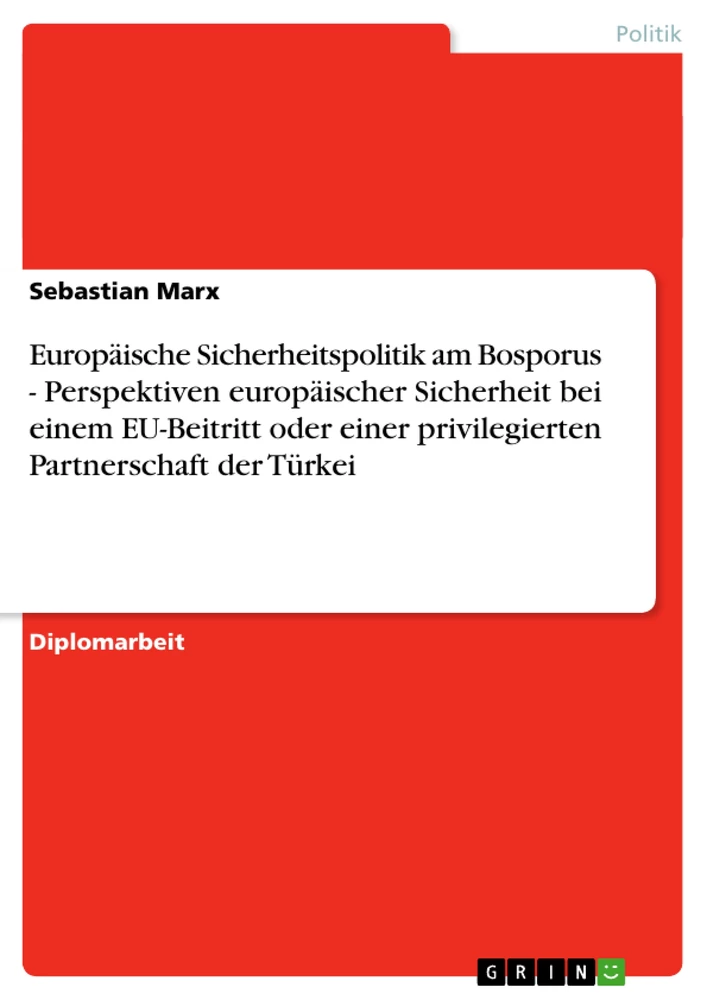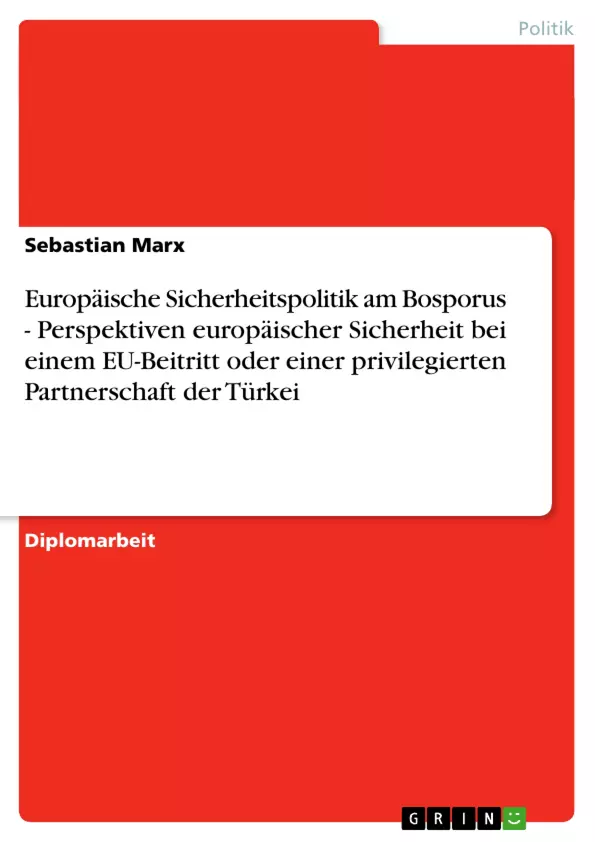Um das Jahr 1839 berichtet Helmuth von Moltke, der vom Osmanischen Reich als Militärberater engagiert ist, von der militärischen Macht der Osmanen am Bosporus, an dessen Meerenge die Türken versuchen die europäischen Staaten davon abzuhalten ihren Fuß auf den asiatischen Kontinent zu setzen.
Was vor rund 170 Jahren ein schwelender Konflikt war, hat sich während der letzten Jahrzehnte aus europäischer Sicht zu einer kooperativen Allianz auf der sicherheitspolitischen Ebene gewandelt. Nachdem die Türkei während des Kalten Krieges einer der strategisch wichtigen Staaten in der NATO gegenüber dem Warschauer Pakt gewesen ist, bereitet sie sich rund zwölf Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion darauf vor ein Vollmitglied der Europäischen Union zu werden.
Der jetzige deutsche Außenminister Fischer hat für den Beitritt der Türkei zur EU vor allem auch aus sicherheitspolitischen Gründen mit den Worten geworben, dass „die für die Europäische Union entscheidende Sicherheitsfrage in diesem Raum entschieden“ werde. Auch Bundeskanzler Schröder hat betont, dass jenseits materieller Interessen für ihn „das strategische und sicherheitspolitische Argument entscheidend“ sei.
Mit einem Beitritt der Türkei würde sich die EU darauf einstellen den Bosporus zu überschreiten. Infolgedessen sähe sich die EU mit neuen Herausforderungen auf dem asiatischen Kontinent, dem Nahen und Mittleren Osten konfrontiert, an dessen Grenzen entlang die neuen Außengrenzen der Union verlaufen würden.
Die geostrategische Bedeutung der Türkei für die EU wird von allen Parteien anerkannt und eine verstärkte Zusammenarbeit gefordert. Strittig ist alleine die Frage, ob man der Türkei eine Vollmitgliedschaft zugesteht oder eine Kooperation, welche inhaltlich unterhalb einer Vollmitgliedschaft angesiedelt ist, eine sogenannte „Privilegierte Partnerschaft“, wie sie derzeit von der deutschen CDU/CSU und der französischen Regierungspartei UMP gefordert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Der Ordnungsfaktor Europäische Union und Akteurszentrierter Institutionalismus
- Mögliche Zukunftsszenarien für die EU als sicherheitspolitischer Akteur
- Sicherheitspolitische Konzeptionen für und wider eine EU- Vollmitgliedschaft der Türkei
- Status quo der GASP/ESVP und die Einbindung der Türkei
- Europäische und amerikanische Sicherheitsmotive
- Ziele Europäischer Sicherheitspolitik – Das Solana- Papier, die EU-Verfassung und die ESVP
- Die Rolle der Türkei in der euro- transatlantischen Sicherheitsarchitektur
- Die Türkei als ESVP- Mitglied
- Die Türkei als politischer Akteur
- Innenpolitische Konflikte und Sicherheitsinteressen
- Das innerstaatliche System - wechselnde Machthaber
- Konfliktfelder in Anatolien
- Der politische Islam und das Militär
- Zwischenergebnis
- Außenpolitische Konflikte und Sicherheitsinteressen
- Die Bedeutung natürlicher Ressourcen - Wasser, Gas und Öl
- Das Verhältnis der Türkei zu den New Independent States
- Das Verhältnis der Türkei zu Israel
- Das Verhältnis der Türkei zu Iran
- Das Verhältnis der Türkei zu Irak
- Das Verhältnis der Türkei zu Syrien
- Zwischenergebnis
- Die Türkei als Modellstaat
- Innenpolitische Konflikte und Sicherheitsinteressen
- Perspektiven europäischer Sicherheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den sicherheitspolitischen Folgen eines möglichen EU-Beitritts der Türkei. Sie verfolgt die These, dass die von den Beitrittsbefürwortern beschriebenen positiven Auswirkungen auf die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) unwahrscheinlich sind und stattdessen eine Reihe von Problemen innerhalb und außerhalb der Türkei verursachen könnten, mit negativen Folgen für die europäische Sicherheit.
- Die Rolle der Türkei als strategischer Akteur im Nahen und Mittleren Osten
- Die Auswirkungen eines EU-Beitritts auf die GASP und ESVP
- Die innen- und außenpolitischen Konflikte der Türkei
- Das Potenzial der Türkei als demokratisches und islamisches Modell für die islamische Welt
- Die Risiken einer verstärkten Renationalisierung europäischer Außen- und Sicherheitspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit beleuchtet die sicherheitspolitischen Implikationen eines möglichen EU-Beitritts der Türkei, wobei sie die These verfolgt, dass die befürworteten positiven Auswirkungen eher unwahrscheinlich sind und negative Folgen für die europäische Sicherheit haben könnten.
- Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Theoriemodelle zum Ordnungsfaktor EU, stellt den Akteurszentrierten Institutionalismus als Analysebasis dar und erörtert mögliche Zukunftsszenarien für die EU als sicherheitspolitischer Akteur.
- Status quo der GASP/ESVP und die Einbindung der Türkei: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Situation der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) sowie die bisherige Einbindung der Türkei in die westliche Sicherheitsarchitektur.
- Die Türkei als politischer Akteur: Dieses Kapitel untersucht die Türkei auf zwei Ebenen: intern, durch die Analyse des innenpolitischen Systems und der Rolle des Militärs sowie der Kurdenproblematik und des Verhältnisses zum Islamismus, und extern, durch die Betrachtung der außenpolitischen Beziehungen der Türkei zu ihren Nachbarstaaten und die Rolle der natürlichen Ressourcen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die europäische Sicherheitspolitik im Kontext eines möglichen EU-Beitritts der Türkei. Wichtige Schlüsselwörter sind: Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), Akteurszentrierter Institutionalismus, Türkei, EU-Beitritt, Sicherheitsinteressen, Konfliktfelder, Modellstaat, islamische Welt, Renationalisierung europäischer Außen- und Sicherheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Türkei für die europäische Sicherheitspolitik?
Die Türkei gilt aufgrund ihrer geostrategischen Lage am Bosporus als entscheidender Akteur für die Sicherheit der EU, insbesondere im Hinblick auf den Nahen und Mittleren Osten.
Was ist der Unterschied zwischen einer Vollmitgliedschaft und einer privilegierten Partnerschaft?
Während die Vollmitgliedschaft die vollständige Integration in EU-Strukturen bedeutet, ist die privilegierte Partnerschaft eine Kooperation unterhalb dieser Ebene, wie sie etwa von der CDU/CSU gefordert wurde.
Wie beeinflusst ein möglicher EU-Beitritt der Türkei die GASP?
Ein Beitritt könnte die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) vor neue Herausforderungen stellen, da die EU-Außengrenzen direkt an Krisenregionen im Osten grenzen würden.
Welche Rolle spielt das türkische Militär in der Sicherheitspolitik?
Das Militär ist traditionell ein starker innenpolitischer Akteur in der Türkei, was im Kontext europäischer Demokratie- und Sicherheitsstandards kritisch analysiert wird.
Was sind die zentralen Konfliktfelder in Anatolien?
Zu den internen Konfliktfeldern gehören unter anderem die Kurdenproblematik, der politische Islam und die Verteilung natürlicher Ressourcen wie Wasser.
Warum wird die Türkei oft als „Modellstaat“ bezeichnet?
Die Türkei wird oft als potenzielles Modell für die Vereinbarkeit von Demokratie und Islam in der islamischen Welt diskutiert, wobei diese Rolle in der Arbeit kritisch hinterfragt wird.
- Quote paper
- Sebastian Marx (Author), 2005, Europäische Sicherheitspolitik am Bosporus - Perspektiven europäischer Sicherheit bei einem EU-Beitritt oder einer privilegierten Partnerschaft der Türkei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38943