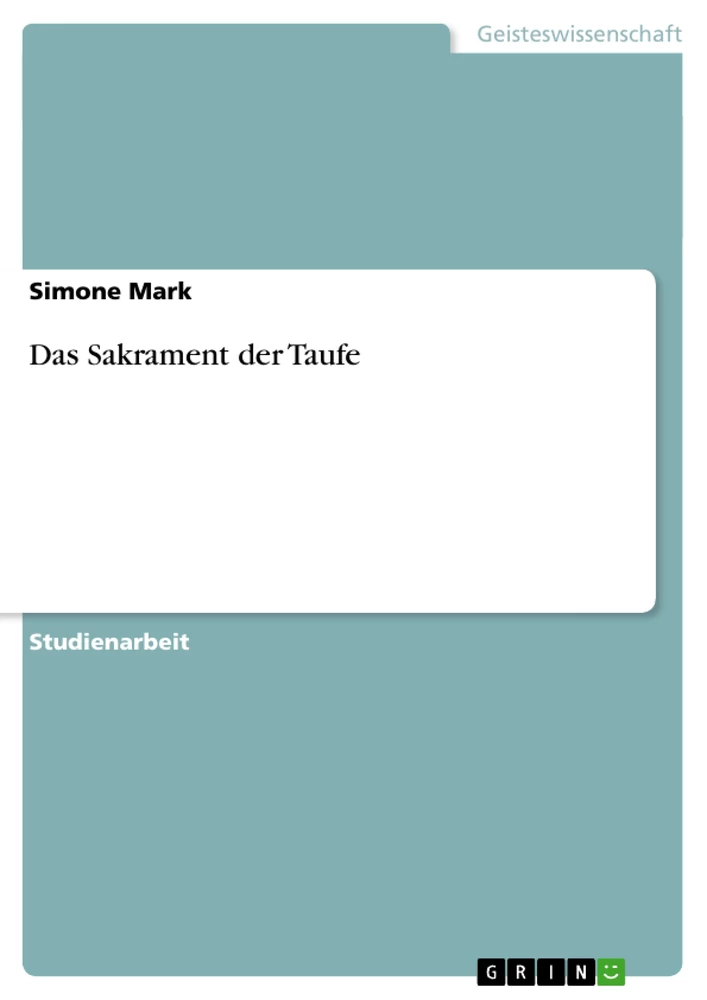Anknüpfend an unser Blockseminar „Mit Gott auf Buchfühlung„ möchte ich zunächst die von uns im Seminar besprochene erste detaillierte Beschreibung einer christlichen Taufe wiedergeben. Dazu gehört zum einen die Vorbereitung zur Taufe; zum anderen die eigentliche Spendung der Taufe. Hierbei beziehe ich mich auf die von uns besprochene Apostolische Überlieferung (Traditio Apostolica). Anschließend möchte ich mich mit dem Sakrament der Firmung, dem ursprünglichen Teilaspekt der Taufe, näher beschäftigen. Mit Hilfe verschiedener Lexikonartikel werde ich versuchen, eine genaue Beschreibung von „Firmung„ zu geben, die mir im folgenden dazu dient, die Eigenständigkeit der Firmung als Sakrament zu diskutieren. Wie kam es dazu, dass sich die Firmung zu einem eigenständigen Sakrament entwickelt hat? Dazu werde ich den abendländischen Firmritus mit dem der Ostkirche vergleichen, um herauszufinden, wie er sich verändert hat. Zum Schluss möchte ich ein Fazit ziehen und schauen, ob sich die Frage nach der Eigenständigkeit der Firmung wirklich klären lässt.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Taufritus um 220 n. Chr. in Rom
2.1. Vorbereitungen zur heiligen Taufe
2.2. Die Spendung der heiligen Taufe
3. Zum Begriff der Firmung
4. Die Liturgie der Firmung
4.1. Die Firmung als abendländischer Ritus
4.2. Der Ritus in der Ostkirche
5. Die Sakramentalität der Firmung
5.1 Die Theorie von Thomas von Aquin
5.2 Zum Verhältnis von Taufe und Firmung
6. Schlusswort
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Anknüpfend an unser Blockseminar „Mit Gott auf Buchfühlung„ möchte ich zunächst die von uns im Seminar besprochene erste detaillierte Beschreibung einer christlichen Taufe wiedergeben. Dazu gehört zum einen die Vorbereitung zur Taufe; zum anderen die eigentliche Spendung der Taufe. Hierbei beziehe ich mich auf die von uns besprochene Apostolische Überlieferung (Traditio Apostolica).
Anschließend möchte ich mich mit dem Sakrament der Firmung, dem ursprünglichen Teilaspekt der Taufe, näher beschäftigen. Mit Hilfe verschiedener Lexikonartikel werde ich versuchen, eine genaue Beschreibung von „Firmung„ zu geben, die mir im folgenden dazu dient, die Eigenständigkeit der Firmung als Sakrament zu diskutieren. Wie kam es dazu, dass sich die Firmung zu einem eigenständigen Sakrament entwickelt hat? Dazu werde ich den abendländischen Firmritus mit dem der Ostkirche vergleichen, um herauszufinden, wie er sich verändert hat.
Zum Schluss möchte ich ein Fazit ziehen und schauen, ob sich die Frage nach der Eigenständigkeit der Firmung wirklich klären lässt.
2. Der Taufritus um 220 n. Chr. in Rom
(erste detaillierte Beschreibung einer christlichen Taufe)
2.1. Vorbereitungen zur heiligen Taufe
Wollte ein Mensch getauft werde, so musste er in der Regel eine „Wartezeit„ von drei Jahren ablegen. Bei besonderem Eifer und Engagement des Katechumenen konnte diese Wartezeit verkürzt werden. Waren die drei Jahre vorbei, so musste der zukünftige Christ alleine beten, hierbei waren Männer und Frauen voneinander getrennt. Die Köpfe der Frauen waren bedeckt. Nach dem Gebet legte der Priester jedem einzelnen Katechumenen die Hand auf. Wichtig war, dass der Katechumene während der Vorbereitungszeit christlich handelte und dass dies von einem Zeugen bestätigt werden konnte. Denn nur dann war es ihnen erlaubt, das heilige Evangelium zu hören. An ihnen wurde des weiteren ein Exorzismus durchgeführt. Am Donnerstag vor der Taufe musste der Täufling sich waschen. Am Freitag fastete er, bevor am Samstag eine große Versammlung stattfand. Bei der Handauflegung des Bischofs wurde ein weiteres Mal der Exorzismus gesprochen. Anschließend tauchte dieser das Gesicht des Täuflings in das Wasser und kreuzigte Stirn, Nase und Ohren. Die Nacht vor der Taufe mussten die Täuflinge wach bleiben.
2.2. Die Spendung der heiligen Taufe
Die Taufe wird in der Osternacht vollzogen. Zunächst wird das Wasser gesegnet. Es ist darauf zu achten, dass es sich bei dem Wasser um frisches Wasser aus einer Quelle handelt. Es werden zuerst alle Kinder getauft. Dabei tragen sie keine Kleider. Ihre Eltern müssen für sie sprechen. Anschließend werden die Männer, dann erst die Frauen getauft.
Auch diese tragen weder Kleidung noch Schmuck. Der Bischof spricht den Dank und gießt Öl in ein Gefäß. Dabei handelt es sich um das Öl der Danksagung. Anschließend spricht der Bischof den Exorzismus über ein anderes Öl; er erhält das Öl des Exorzismus . Dann ist der Täufling an der Reihe. Er muss dem Satan widersagen mit den Worten:
„Ich widersage Dir, Satan, Deinem Pomp und all Deinen Werken.„
Anschließend salbt der Priester den Täufling mit dem Öl des Exorzismus. Dann steigt der Diakon mit dem Täufling in das Wasser hinab. Dort legt er ihm die Hand auf. Beantwortet der Täufling die Frage, ob er an Gott glaubt mit ja, so wird er zum ersten Mal getauft. Bejaht er auch die Frage nach seinem Glauben an Jesus Christus, erfolgt die zweite Salbung durch den Priester. Glaubt der Täufling auch an den heiligen Geist, so salbt man ihn ein drittes Mal. Anschließend salbt der Priester den Täufling mit dem Öl der Danksagung. Der Täufling kann sich nun wieder ankleiden.
Getauft wurden zu der damaligen Zeit keine Schauspieler, Wettkämpfer, Soldaten und Lehrer, da sie alle dem Staat dienten. Dies war für Christen nicht erlaubt, da sich das Staatsoberhaupt als Gott sah und dies nicht mit dem monotheistischen christlichen Glauben vereinbar ist. Ebenfalls ausgeschlossen von der Taufe waren Prostituierte, Homosexuelle und Abergläubige.
3. Zum Begriff der Firmung
Im Folgenden möchte ich mich mit der Firmung und dem Zusammenhang Firmung und Taufe beschäftigen. Zum Einstieg möchte ich zunächst den Begriff „Firmung„ näher erläutern:
Die Firmung ist eines der sieben Sakramente. Sie wird verstanden als Glaubensstärkung durch den heiligen Geist. Ihren Ursprung hat die Firmung in Jesus Christus, der den Aposteln zweimal „den heiligen Geist mitteilte„.
Die Firmung ist außerdem Teil der „Eingliederung in Christus„, welche aus Taufe, Firmung, Eucharistie besteht. Es ist nämlich so, dass die Verbundenheit zu Gott nicht nur durch das Wasserbad ausgedrückt wird, sondern auch durch eine Reihe anderer Zeichen, wie z.B. durch die Handauflegung während der Firmung.
Die Firmung darf nur einmal vollzogen werden. Ihr Wirkung ist bleibend, ebenso wie die der Taufe. Der Grund hierfür ist, dass nach theologischer Ansicht diese Sakramente (ebenso wie die Priesterweihe) dem Christen seinen Charakter verleihen; „...d.h., ein gewisses, von anderen unterscheidendes geistiges und unauslöschliches Merkmal eindrücken.„
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie sah der Taufritus um 220 n. Chr. in Rom aus?
Der Ritus basierte auf der Apostolischen Überlieferung und umfasste eine dreijährige Vorbereitungszeit (Katechumenat), Exorzismen und die eigentliche Taufe in der Osternacht.
Warum wurde die Firmung zu einem eigenständigen Sakrament?
Ursprünglich war die Firmung ein Teilaspekt der Taufe. Im Abendland trennten sich die Riten zeitlich voneinander, was zur theologischen Diskussion über die Eigenständigkeit führte.
Was unterscheidet den Firmritus der Ostkirche von dem des Abendlandes?
In der Ostkirche (orthodoxe Tradition) werden Taufe und Firmung (Myronsalbung) meist unmittelbar nacheinander gespendet, während sie im Westen oft Jahre auseinanderliegen.
Welche Bedeutung haben die verschiedenen Öle bei der Taufe?
Es wird zwischen dem Öl des Exorzismus (zur Reinigung) und dem Öl der Danksagung (Chrisam, zur Besiegelung mit dem Heiligen Geist) unterschieden.
Wer war im frühen Christentum von der Taufe ausgeschlossen?
Personen in Berufen, die dem Staat dienten (Soldaten, Lehrer, Schauspieler), sowie Prostituierte und Magier waren ausgeschlossen, da ihr Handeln als unvereinbar mit dem monotheistischen Glauben galt.
Was lehrt Thomas von Aquin über die Sakramentalität der Firmung?
Thomas von Aquin entwickelte Theorien zum Verhältnis von Taufe und Firmung und begründete die Firmung als Sakrament der Glaubensstärkung.
- Arbeit zitieren
- Simone Mark (Autor:in), 2002, Das Sakrament der Taufe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39020