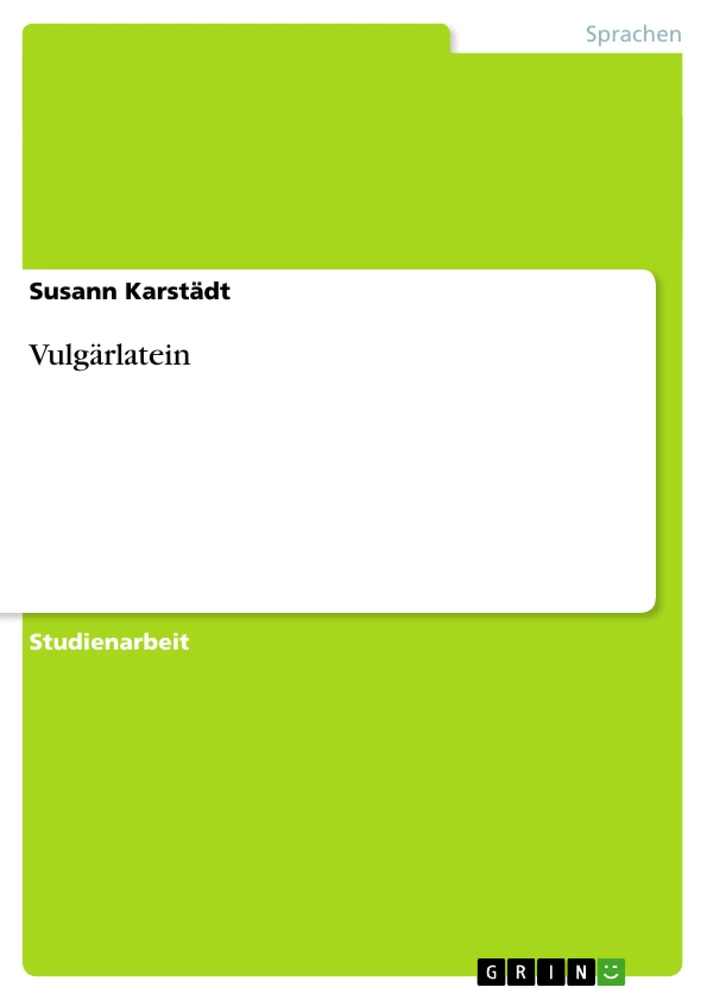Die lateinische Sprache kann sich auf eine jahrtausendelange Tradition berufen. Kaum eine andere historische Sprache zeigt eine vergleichbare Kontinuität in ihrer Entwicklung und hat sich derart prägend auf die heutigen Sprachen ausgewirkt. Das Latein hat dabei – bedingt durch politische und kulturelle Einflüsse - die unterschiedlichsten lexikalischen Entwicklungsphasen durchlaufen. Darüber hinaus muss zwischen zwei Ausprägungen, dem klassischen und dem Vulgärlatein, unterschieden werden.
Das klassische Latein, wie es heutzutage in den Schulen unterrichtet wird, wurde vor allen Dingen in der Schriftsprache verwendet und war damit hauptsächlich die Sprache der Philosophen, Dichter und Politiker, also der gebildeten Oberschicht. Im Gegensatz zu diesem geschriebenen, literarischen Latein steht die gesprochene Form, das Vulgärlatein. Dieses wurde im Alltag gebraucht und von allen Bevölkerungsschichten gesprochen. Der Begriff ‚Vulgärlatein’ kann von den klassisch-lateinischen Wörtern ‚vulgare’ bzw. ‚vulgaris’ abgeleitet werden, die beide mit der deutschen Bedeutung „gemein, öffentlich, gewöhnlich alltäglich“ übersetzt werden können. Das Vulgärlatein war also die Sprache der Mehrheit des Volkes, die Umgangssprache.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass sich langfristig die häufiger verwendete Form, das Sprechlatein, durchsetzte. Auch die heutigen romanischen Sprachen lassen sich deshalb auf das Vulgärlatein und nicht auf das klassische Latein zurückführen.
Gliederung
1. Einleitung
2. Neuerungen
2.1 Der Artikel
2.2 Entlehnung
2.3 Bedeutungswandel
2.4 Vereinfachung des Wortschatzes
2.5 Intensivbildungen
3. Variationen des Vulgärlatein
3.1 Chronologische Faktoren
3.2 Regionale Faktoren
3.3 Soziokulturelle Faktoren
4. Appendix Probi
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die lateinische Sprache kann sich auf eine jahrtausendelange Tradition berufen. Kaum eine andere historische Sprache zeigt eine vergleichbare Kontinuität in ihrer Entwicklung und hat sich derart prägend auf die heutigen Sprachen ausgewirkt. Das Latein hat dabei – bedingt durch politische und kulturelle Einflüsse - die unterschiedlichsten lexikalischen Entwicklungsphasen durchlaufen. Darüber hinaus muss zwischen zwei Ausprägungen, dem klassischen und dem Vulgärlatein, unterschieden werden.
Das klassische Latein, wie es heutzutage in den Schulen unterrichtet wird, wurde vor allen Dingen in der Schriftsprache verwendet und war damit hauptsächlich die Sprache der Philosophen, Dichter und Politiker, also der gebildeten Oberschicht. Im Gegensatz zu diesem geschriebenen, literarischen Latein steht die gesprochene Form, das Vulgärlatein. Dieses wurde im Alltag gebraucht und von allen Bevölkerungsschichten gesprochen. Der Begriff ‚Vulgärlatein’ kann von den klassisch-lateinischen Wörtern ‚vulgare’ bzw. ‚vulgaris’ abgeleitet werden, die beide mit der deutschen Bedeutung „gemein, öffentlich, gewöhnlich alltäglich“ übersetzt werden können. Das Vulgärlatein war also die Sprache der Mehrheit des Volkes, die Umgangssprache.
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass sich langfristig die häufiger verwendete Form, das Sprechlatein, durchsetzte. Auch die heutigen romanischen Sprachen lassen sich deshalb auf das Vulgärlatein und nicht auf das klassische Latein zurückführen.
Ich möchte im Folgenden sowohl auf die äußeren Einflüsse näher eingehen, die zu einem Wandel im Vulgärlatein führten, als auch auf lexikalische Veränderungen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Der Rest der Arbeit gliedert sich daher wie folgt: im zweiten Kapitel werde ich zunächst die lexikalischen Veränderungen in einzelne Abschnitte gegliedert behandeln, um mich anschließend mit räumlichen, zeitlichen und kulturellen Aspekten, die eine Rolle gespielt haben, zu befassen
2. Neuerungen
Das Vulgärlatein hat sich im Laufe einer langen Entwicklungsphase stark gewandelt. Die prägnantesten Neuerungen werde ich im Folgenden kurz darstellen.
2.1 Der Artikel
Als wichtigste Neuerung des Vulgärlateins kann der Artikel bezeichnet werden. Er bildet eine neue Wortart, die im klassischen Latein nicht zu finden ist, die sich aber trotzdem in fast allen romanischen Sprachen durchgesetzt hat. Der Artikel ist ein eindeutiges Indiz für die Entwicklung der romanischen Sprachen aus dem Vulgärlatein.
Es muss an dieser Stelle aber hinzugefügt werden, dass diese ihre Artikel, ähnlich den heutigen, erst im Mittelalter entwickelten. Es ist also ein Jahrhunderte andauernder Wandel zu beobachten. Einige lateinische Texte zeigen nach Renzi (1980), dass lateinisch ille in der Funktion, etwas Bekanntes zu bezeichnen, verwendet wurde. So schreibt er: „Man versteht deshalb, dass das lat. ille für die meisten romanischen Sprachen die materielle Basis für den Artikel geliefert hat.“ (Renzi, 1980, S. 77) Es führten jedoch nicht alle romanischen Sprachen als Vorstufe des heutigen Artikels ille weiter. Das Sardische und Katalanische orientierten sich an lat. ipse, das an die Stelle von idem getreten war und „das bereits Genannte“ (Renzi, 1980, S.77) bezeichnete.
2.2 Entlehnung
Vor allen Dingen das Griechische hatte einen großen Einfluss auf die Lateinische Sprache. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Griechen bereits vor der Existenz des Imperium Romanum eine Hochkultur entwickelt hatten und ab dem achten Jahrhundert v. Chr[1]. Kolonien im Nordosten Siziliens, dem Süden Kalabriens und Apuliens besetzt hielten. Dabei wurden Griechische Lehnwörter, sogenannte Gräzismen, aus dem Bereich der Gegenstandsbezeichnungen übernommen. Als Beispiel möchte ich die Nomen ‚camera’ und ‚lanterna’ anführen. Beide sind noch heute im Italienischen (‚camera’) und Französischen (‚chambre’, ‚lanterne’) zu finden. Darüber hinaus hat sich das Nomen ‚machina’ in fast allen Sprachen der Erde durchgesetzt. Auch aus den Bereichen der Seeterminologie und der Bildung bzw. Wissenschaft wurden griechische Wörter entlehnt. So nennt Lüdtke (1968) folgende Beispiele: delphinus (frz. dauphin), ballaena (frz. baleine), philosophia, philologia, schema, zona, schola und sphaera.
Aber auch Lehnbildungen und Lehnbedeutungen spielten nach Lüdtke (1968) eine große Rolle und hatten einen indirekten Einfluss auf die Lateinische Sprache. Das lateinische Wort ‚ars’ erhält demnach seine Bedeutung „Kunst“ (im weiteren Sinne) nach den griechischen Wörtern ‚techne’ und ‚causa’.[2]
2.3 Bedeutungswandel
Durch die geographische Ausdehnung des römischen Reiches, aber auch durch die Christianisierung im zweiten bis fünften Jahrhundert nach Christus, kam es zu einer bedeutenden Erweiterung des umgangssprachlichen Wortschatzes. Hinzu kam – und das ist an dieser Stelle viel wichtiger – der Bedeutungswandel aus früheren, konkreteren klassischlateinischen Wörtern. Es wurde bspw. das Wort ‚pensare’, das ursprünglich „wiegen, wägen“ bedeutete und die gleiche Wurzel wie ‚pondus’ (=Gewicht) hat, später mit der Bedeutung „denken“ gebraucht. Diese Verwendung findet auch das heutige italienische Verb ‚pensare’ noch. Der materielle Vorgang des Wiegens wurde also auf das Denken bzw. Abwägen übertragen.
Eine ähnliche Entwicklung machten nach Lüdtke (1968) auch die folgenden Verben durch: ‚cogitare’ (von co-agitare), das ursprünglich „zusammentreiben“ hieß, jetzt aber „denken“ bedeutet, und ‚putare’, das ebenfalls mit „denken“ übersetzt, später von ‚pensare’ aber verdrängt wurde und im heutigen Italienisch wieder mit der ursprünglichen Bedeutung „Bäume schneiden“ verwendet wird. In Zusammenhang mit dem Bedeutungswandel der Wörter muss aber auch die Vereinfachung des Wortschatzes gesehen werden.
2.4 Vereinfachung des Wortschatzes
Vergleicht man klassisches Latein und Vulgärlatein, kann man eine Vereinfachung des Wortschatzes von letzterem im Gegensatz zu ersterem feststellen. Dies geschieht entweder durch Reduktion, d.h., dass mit bedeutungsähnlichen Wörtern die Bedeutungsunterschiede verloren gehen, oder in Zusammenhang damit durch eine Bedeutungserweiterung. Als Beispiel hierfür möchte ich das Wort ‚urbs’ anführen, das „Stadt“ (als Gesamtheit der Gebäude) bedeutet. ‚urbs’ wurde im Zuge der Vereinfachung durch ‚civitas’ ersetzt, was aber ursprünglich nur für „Bürgerschaft, Einwohner einer Stadt“ verwendet wurde. Darüber hinaus wurde ‚vir’ durch ‚homo’ ersetzt, wodurch der Unterschied zwischen Mann und Mensch verloren ging. Für den lateinischen Begriff ‚equus’ verwendete man nun das Wort ‚caballus’. Zwischen dem „Reitpferd“ und dem ländlichen „Pferd“ als Nutztier wurde folglich sprachlich nicht mehr unterschieden.
Auch heute noch sind diese weniger präzisen Formen in den romanischen Sprachen zu erkennen bzw. wieder zu finden.
[...]
[1] Entlehnung als Oberbegriff für Lehnwörter, Lehnbildungen und Lehnbedeutungen
[2] Im Laufe der Jahrhunderte wurden aber auch Begriffe aus anderen Sprachen, wie dem Keltischen, entlehnt. Da dieser Einfluss aber nicht die Ausmaße des Griechischen annimmt, werde ich an dieser Stelle auf genauere Beispiele verzichten.
Was ist der Unterschied zwischen klassischem Latein und Vulgärlatein?
Klassisches Latein war die Schriftsprache der Oberschicht, während Vulgärlatein die gesprochene Umgangssprache des Volkes war, aus der die romanischen Sprachen entstanden.
Warum gibt es in romanischen Sprachen Artikel, im Lateinischen aber nicht?
Der Artikel ist eine Neuerung des Vulgärlateins, die sich aus Demonstrativpronomen wie „ille“ (jener) oder „ipse“ (selbst) über Jahrhunderte entwickelt hat.
Welchen Einfluss hatte das Griechische auf das Latein?
Durch Kolonien und kulturellen Austausch wurden viele griechische Lehnwörter (Gräzismen) übernommen, z.B. „camera“, „machina“ oder Begriffe aus Wissenschaft und Seefahrt.
Was versteht man unter Bedeutungswandel im Vulgärlatein?
Wörter veränderten ihren Sinn, z.B. bedeutete „pensare“ ursprünglich „wiegen“ und wandelte sich im Sprechlatein zur Bedeutung „denken“ (abwägen).
Was ist der „Appendix Probi“?
Ein historisches Dokument, das Fehlerlisten enthält und zeigt, wie sich die Aussprache und Schreibung vom klassischen zum vulgären Latein hin veränderte.