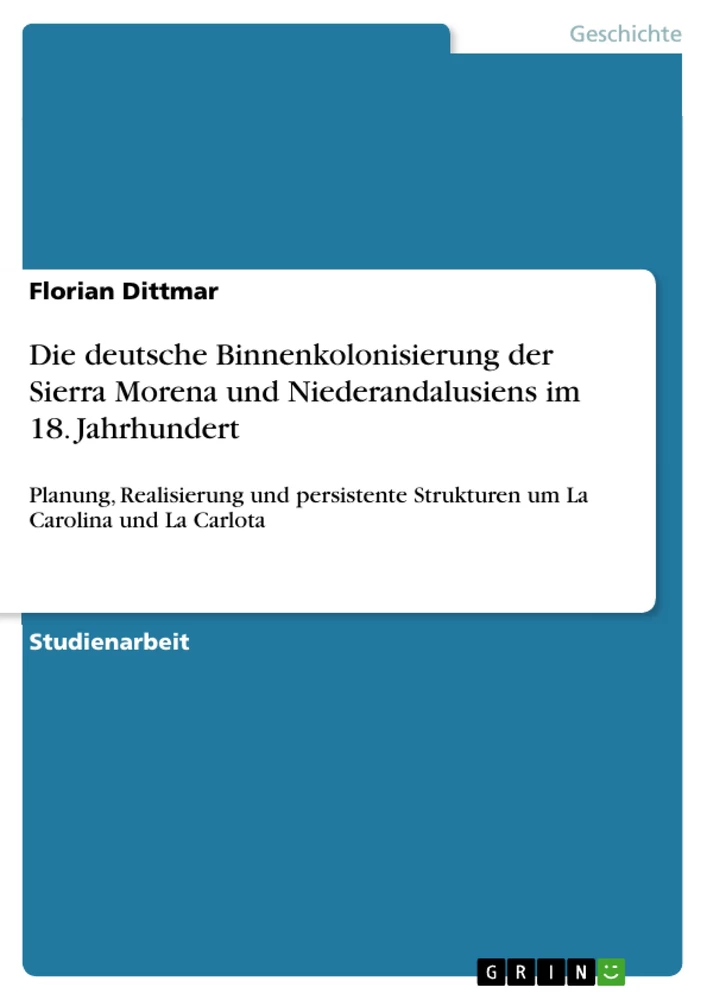Die sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte im Ausland in den verschiedensten Weltregionen gebildeten deutschen Kolonien und Sprachinseln waren von jeher Objekte der Forschung und des öffentlichen Interesses, welches sich jedoch regelmäßig primär auf bis heute überdauernde und kulturell sowie sprachlich persistente kulturelle Exklaven bezieht. Als weniger bekannt und mit weitgehendem öffentlichen Desinteresse belegt können indes einige historische Kolonisationsprojekte und -siedlungen bezeichnet werden, welche die aus dem Mutterland tradierte kulturelle Identität im Zuge von Assimilationsprozessen mittlerweile verloren haben, und deren ursprüngliche Wurzeln sich in der sich heute darstellenden kulturellen Landschaft nur noch schwerlich ableiten lassen. Doch nichtsdestotrotz sind es vielleicht gerade diese Gebiete, welche Forschern der verschiedensten Fachrichtungen interessante Ansatzpunkte liefern können, da auch der Verlust kultureller Identität unter dem Einfluss einer fremden Umwelt als Prozess wichtige Erkenntnisse zu liefern im Stande sein mag. Die vorliegende Arbeit nun beschäftigt sich mit einem Siedlungsprojekt des 18. Jahrhunderts im südlichen Spanien, namentlich in Niederandalusien sowie der Sierra Morena, welches den genannten Merkmalen weitgehend entspricht. In einem ersten Teil werden hierzu die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen darzustellen sein, welche zur Realisierung eines Kolonisierungsvorhabens dieser Größenordnung führte, sowie die konkrete Vorgeschichte des Projektes. Nach einer sich anschließenden Abhandlung des Besiedlungs- und Konsolidierungsprozesses werden die den Kolonien eigenen individuellen Strukturen und Eigenheiten - in Abgrenzung zu ihren altspanischen Nachbargemeinden - näher beleuchtet und erklärt werden. Hierauf wird die Sprache auf den Prozess der kulturellen Angleichung und die noch heute erhaltenen persistenten Strukturen und Eigenheiten der ehemaligen Abstammungen kommen. Das Interesse liegt hierbei auf der Frage, inwieweit sich auch Jahrhunderte nach dem erwähnten Verlust der kulturellen Identität an verschiedenen Merkmalen noch die historische Sonderstellung der Kolonien ablesen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Voraussetzungen der Kolonisation
- II.1 Die Lage in Deutschland
- II.2 Die Lage in Spanien
- III. Zentrale Akteure des Projektes
- III.1 Johann Kaspar Thürriegel - Vater der Kolonie
- III.2 Don Pablo de Ohvide
- IV. Geographische und naturräumliche Verortung des Kolonisationsgebietes
- V. Der ,,Fuero de las Nuevas Poblaciones''
- VI. Räumliche Muster der besiedelten Fläche
- VII. Entwicklung der Grundbesitzverteilung
- VIII. Persistenzen in der Bevölkerung
- VIII.1 Der Prozess der Hispanisierung
- VIII.2 Somatische und kulturelle Relikte
- IX. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht ein deutsches Kolonisationsprojekt im 18. Jahrhundert in Südspanien (Niederandalusien und Sierra Morena). Sie beleuchtet die Voraussetzungen für dieses Projekt, den Besiedlungs- und Konsolidierungsprozess, die spezifischen Strukturen der Kolonien im Vergleich zu ihren spanischen Nachbargemeinden, und schließlich den Prozess der kulturellen Angleichung und die bis heute sichtbaren Relikte der ursprünglichen Besiedlung. Das zentrale Interesse liegt auf der Frage, inwieweit sich die historische Sonderstellung der Kolonien noch nach Jahrhunderten des kulturellen Verlusts nachweisen lässt.
- Die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen der Kolonisation in Deutschland und Spanien.
- Der Prozess der Besiedlung und Konsolidierung der deutschen Kolonien in Südspanien.
- Die spezifischen Strukturen und Eigenheiten der Kolonien im Vergleich zu ihrer Umgebung.
- Der Prozess der kulturellen Angleichung (Hispanisierung) der deutschen Siedler.
- Persistente Strukturen und Relikte der deutschen Kolonisation in der heutigen Landschaft und Bevölkerung.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der deutschen Kolonien im Ausland ein und hebt den Fokus auf Kolonien, die ihre kulturelle Identität verloren haben. Die Arbeit konzentriert sich auf ein spezifisches Kolonisationsprojekt im 18. Jahrhundert in Südspanien, untersucht dessen Voraussetzungen, den Besiedlungsprozess und die bis heute sichtbaren kulturellen und sozialen Spuren. Sie stellt die Forschungsfrage nach der Nachvollziehbarkeit der historischen Sonderstellung der Kolonien trotz des Verlustes der kulturellen Identität.
II. Voraussetzungen der Kolonisation: Dieses Kapitel analysiert die Rahmenbedingungen des Kolonisationsprojektes, sowohl in Deutschland als auch in Spanien. In Deutschland werden Auswanderungswellen aufgrund von Kriegen, wirtschaftlicher Not und Überbevölkerung als Ursachen genannt. In Spanien hingegen wird die Unterbevölkerung, wirtschaftliche Probleme, Steuerlast und die Macht des Landadels als Gründe für die Notwendigkeit einer Binnenkolonisation hervorgehoben. Die Gegenüberstellung dieser Faktoren verdeutlicht die unterschiedlichen Ausgangslagen und die komplementäre Beziehung zwischen dem Angebot an Auswanderern und der Nachfrage nach Siedlern in Spanien.
III. Zentrale Akteure des Projektes: Dieses Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Persönlichkeiten, die das Kolonisationsprojekt vorangetrieben haben. Es werden die Rollen und der Einfluss von Johann Kaspar Thürriegel als Initiator und Don Pablo de Ohvide beleuchtet. Ihre Handlungen, Entscheidungen und die Interaktionen zwischen ihnen sind zentrale Bestandteile des Projekterfolgs und werden detailliert analysiert, um deren Beitrag zu dem Projekt zu verstehen. Es wird sich mit den Motivationen und Strategien der Akteure auseinandergesetzt, um ein vollständigeres Bild des geschichtlichen Kontextes zu liefern.
Schlüsselwörter
Deutsche Kolonisation, Spanien, Sierra Morena, Niederandalusien, 18. Jahrhundert, Binnenkolonisierung, Auswanderung, Merkantilismus, Hispanisierung, kulturelle Persistenz, Agrarkolonisten, Bevölkerungspolitik, soziale Strukturen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Deutschen Kolonisation in Südspanien im 18. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht ein deutsches Kolonisationsprojekt im 18. Jahrhundert in Südspanien (Niederandalusien und Sierra Morena). Der Fokus liegt auf den Voraussetzungen, dem Besiedlungs- und Konsolidierungsprozess, den spezifischen Strukturen der Kolonien im Vergleich zu spanischen Gemeinden und dem Prozess der kulturellen Angleichung (Hispanisierung) sowie den bis heute sichtbaren Relikten der ursprünglichen Besiedlung. Zentral ist die Frage, inwieweit sich die historische Sonderstellung der Kolonien trotz kulturellen Verlusts nachweisen lässt.
Welche Aspekte der Kolonisation werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Voraussetzungen in Deutschland (Auswanderungswellen) und Spanien (Unterbevölkerung, wirtschaftliche Probleme). Sie analysiert den Besiedlungsprozess, die spezifischen Strukturen der deutschen Kolonien, den Prozess der Hispanisierung und die bis heute sichtbaren kulturellen und sozialen Spuren (Persistenzen). Wichtige Akteure wie Johann Kaspar Thürriegel und Don Pablo de Ohvide werden vorgestellt und deren Rolle im Projekt analysiert.
Wer waren die wichtigsten Akteure des Kolonisationsprojekts?
Zu den zentralen Akteuren gehören Johann Kaspar Thürriegel, der als Initiator des Projekts gilt, und Don Pablo de Ohvide, dessen Rolle und Einfluss auf den Erfolg des Projekts detailliert untersucht werden. Die Arbeit analysiert deren Handlungen, Entscheidungen und Interaktionen.
Welche geographische Region wird untersucht?
Die Studie konzentriert sich auf ein spezifisches Kolonisationsprojekt in Südspanien, genauer gesagt in Niederandalusien und der Sierra Morena.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Einführung in das Thema und die Forschungsfrage), Voraussetzungen der Kolonisation (Analyse der Rahmenbedingungen in Deutschland und Spanien), Zentrale Akteure des Projekts (Analyse der Rollen von Thürriegel und Ohvide), Geographische und naturräumliche Verortung, Der ,,Fuero de las Nuevas Poblaciones'', Räumliche Muster der besiedelten Fläche, Entwicklung der Grundbesitzverteilung, Persistenzen in der Bevölkerung (Hispanisierung und Relikte), Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Kolonisationsprojekts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Kolonisation, Spanien, Sierra Morena, Niederandalusien, 18. Jahrhundert, Binnenkolonisierung, Auswanderung, Merkantilismus, Hispanisierung, kulturelle Persistenz, Agrarkolonisten, Bevölkerungspolitik, soziale Strukturen.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit lässt sich die historische Sonderstellung der deutschen Kolonien in Südspanien trotz des Verlusts der kulturellen Identität nach Jahrhunderten noch nachweisen?
Welche Quellen wurden verwendet? (Diese Frage wurde nicht explizit im Text beantwortet, kann aber in einer vollständigen Version ergänzt werden).
Diese Information fehlt im vorliegenden Text. Eine vollständige Version der Arbeit würde hier die verwendeten Quellen aufführen.
- Citar trabajo
- Florian Dittmar (Autor), 2004, Die deutsche Binnenkolonisierung der Sierra Morena und Niederandalusiens im 18. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39289